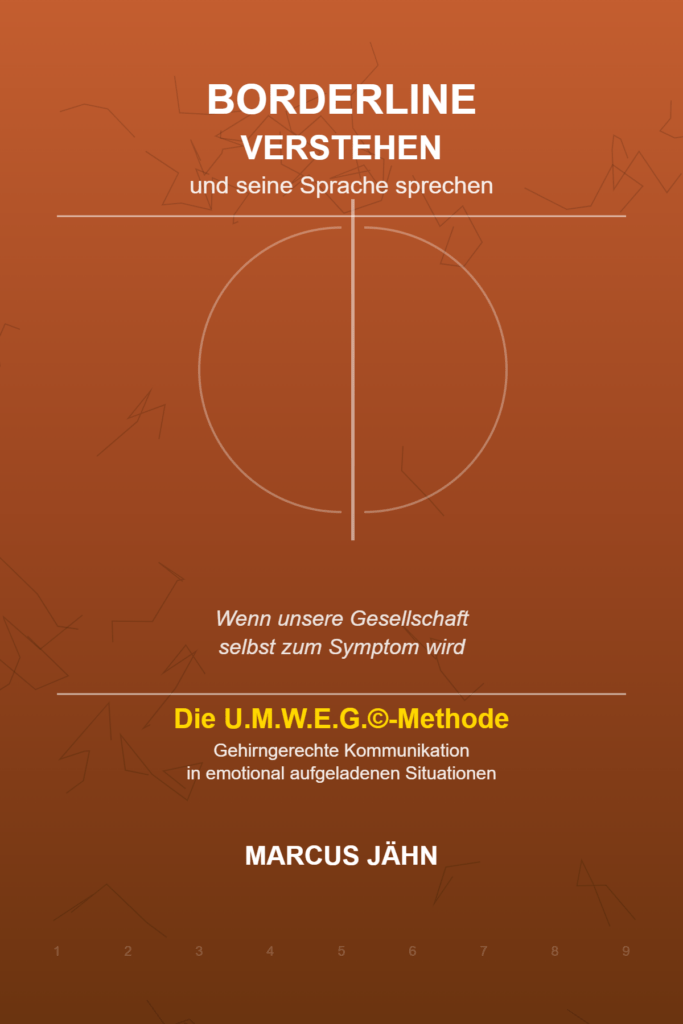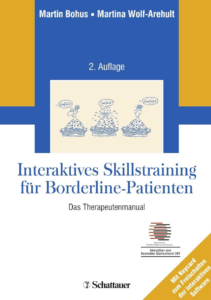Kapitel 1. Borderline – Beginnen wir von vorne
Lass mich ganz am Anfang mal mit einem alten Zitat aus der Bibel beginnen. Ich denke da an einen Gedanken des weisen Königs Salomo aus den Sprüchen 29:18 „Wo keine Vision ist, da wird das Volk zügellos“.
Mit diesem Zitat und dem Buch möchte ich dir zeigen, dass Borderline deutlich mehr ist als nur eine reine „Störung“. Borderline ist vielmehr der Spiegel unserer heutigen Zeit, unserer Gesellschaft, ja praktisch unserer gesamten Kultur. Und Borderline wird immer mehr, immer präsenter!
Ca. 3% der deutschen Bevölkerung leiden an den “Borderline”-Symptomen”. Und schauen wir auf die Gesamtzahl aller stationären Behandlungen im psychotherapeutischen Bereich, dann sind ca. 15 bis 20% der psychotherapeutischen Therapieplätze von Patienten mit Borderline Diagnosen, Borderline Symptomen und deren Leiden belegt.
Allein dieser gigantischen Menge wegen müssen wir uns fast schon zwangsläufig mit dieser Thematik auseinandersetzen!
Woher kommt Borderline und wie viel Schuld haben unsere Gesellschaft und unsere Kultur hieran? Lass uns hierfür gemeinsam einmal tiefer in dieses Thema eintauchen.
Kultur ist das, was eine Gemeinschaft künstlerisch, geistig gestaltet, um sich menschlich weiterzuentwickeln. Sie gibt Antwort auf Fragen wie: „Was macht den einzelnen Menschen / was macht die menschliche Gesellschaft besser?“
Und genau hier kommt jetzt Borderline mit ins Spiel … Borderline ist praktisch eine “Antikultur”, welche den Niedergang unseres Miteinanders sichtbar macht.
Warum ich dies sage, möchte ich einmal mit diesem Teil meines Buches aufzeigen. Im zweiten großen Teil werde ich dir mit Hilfe der “U.M.W.E.G.”-Methode ein Hilfsmittel an die Hand geben, damit du die „Sprache“ des Borderliners besser verstehst und auch besser händeln kannst.
1.1. Unsere Kultur löst sich immer mehr auf.
Wenn wir die Veränderungen in unserer Gesellschaft im Strome der Zeit einmal aus der psychologischen Perspektive betrachten, dann wird einem immer deutlicher bewusst, welch eine gewaltige Dimension an Veränderungen unsere Gesellschaft heute durchmacht.
Das war aber nicht immer so! Denn, machen wir nur mal einen kleinen Zeitsprung zurück in die nahe Vergangenheit und betrachten wir die Zeit, als der große Tiefenpsychologe Sigmund Freud lebte und wirkte. Wir befinden uns in der Zeit von 1856-1939. Es war eine Welt, die noch von den letzten Ausläufern der British-amerikanischen Kultur – der viktorianischen Epoche (1837 bis 1901) geprägt wurde. Das war eine ganz andere Kultur als die heutige … In seiner (Sigmund Freuds) Zeit war es nämlich noch völlig logisch, dass Neurosen (psychische Störungen ohne körperliche Ursachen) wegen der Unterdrückung „in der Gesellschaft nicht akzeptierter sexueller Gefühle und Gedanken“ entstehen würden.
Heute – etwa 100 Jahre weiter – werden sexuelle und andere Impulse deutlich offener ausgedrückt als damals. Aber ist dies wirklich eine reelle Befreiung???
Ist es nicht eher so, dass unsere soziale Gesellschaft / unser Miteinander / unsere Werte und Visionen eher unübersichtlicher geworden sind, als noch zu Freuds Zeiten oder früher?
Es ist nämlich gar nicht mehr so klar und deutlich, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein… Unsere Strukturen im politischen, wirtschaftlichen, religiösen aber auch im sozialen Bereich werden eher unklarer / undeutlicher.
Was heute noch „normal“ – also einer allgemeinen Norm entspricht – was zu einer „normalen Familie“ oder zur kulturellen Norm gehört, ist überhaupt nicht mehr so klar, wie es noch vor 100 Jahren war … Wurde früher noch von Familie als von denjenigen gesprochen, die zusammen leben – denn „famere“ kommt aus dem umbrischen Sprachraum und bedeutet genau dieses „diejenigen die miteinander wohnen“ – so muss heute für Familie eine völlig neue Bezeichnung gefunden werden. Familiengerichte haben sich derzeit auf folgende Bezeichnung geeinigt: Zur Familie zählen alle Personen, die dauerhaft und zuverlässig Verantwortung füreinander übernehmen. Dies schließt deutlich mehr ein und ist dem Umstand geschuldet, dass immer neue Formen von einem Miteinander aufkommen.
Und auch wenn diese sozialen / kulturellen Faktoren nicht als die eigentliche Ursache der Borderline – Persönlichkeitsstörung bezeichnet werden dürfen, so hat die Gesellschaft zweifelsohne einen direkten und auch indirekten Einfluss auf jeden Einzelnen von uns.
1.2. Was sind die Einflüsse der Gesellschaft auf den Einzelnen?
Erstens: Da die Borderline – Symptomatik, ihren Ursprung nach allen uns zur Verfügung stehenden Erkenntnissen in der frühesten Kindheit hat, müssen wir die sich verändernden sozialen Familienstrukturen und Eltern-Kind-Beziehungen hierbei genauer betrachten.
Es lohnt sich, einen tiefen Blick auf die sozialen Veränderungen bei der Kindererziehung / dem Familienleben, bei Kindesmissbrauch und Kindesvernachlässigung zu richten.
Zweitens: Wer an Borderline leidet, reagiert sehr feinfühlig auf alle sozialen Veränderungen… Und gerade deshalb stellt die fehlende Struktur in der heutigen westlichen Kultur gerade für diese Personengruppe ein großes Handicap dar… Diese fehlenden Strukturen fördern Identitätsprobleme und Identität benötigt nun mal feste Strukturen.
Leider beobachten wir aktuell eher den gegenteiligen Trend:
Die ursprüngliche Rolle der Frau und des Mannes verschiebt sich immer weiter durch andauernd neue gesellschaftliche und berufliche Anforderungen – Ich denke hier an das alte Thema „Karriere oder Haushalt?“ …
Wissenschaftler führen dieses Thema immer wieder an, um zu zeigen, dass Borderline besonders bei Frauen wegen dieses sozialen Rollenkonflikts immer stärker vorkommt.
Und als wenn dies noch nicht genug wäre … Da sich in der Regel zuerst die Mütter um die Erziehung ihrer Kinder kümmern, überträgt sich diese Störung fast schon zwangsläufig auch auf die zukünftige Generation.
Drittens: Es ist fast schon normal, dass Charakterstörungen durch die stetige Veränderung unserer Kultur im Allgemeinen zunehmen – und hier ganz speziell die Borderline- Störung.
Denn dies ist fast schon eine unausweichlich krankhafte Reaktion auf unsere heutige aktuelle Kultur. Nicht umsonst gibt es immer mehr Bücher zu diesem Thema, wie zum Beispiel das geniale Werk „Das Zeitalter des Narzissmus“ von Christopher Lasch.
Wie in dem Zitat am Anfang aus den Sprüchen (“Wo keine Vision besteht, werden Menschen und Völker zügellos / unkontrollierbar“) gesagt, werden ganze Kulturen brüchig und haltlos, wenn es keine Zukunftsvisionen mehr für sie gibt. Und genau das beobachten wir heute in unserer westlichen Kultur. Wir sehen immer deutlicher den Kontaktverlust sowohl zu unserer Vergangenheit aber auch zu unserer Zukunft …
Der heutige technologische Fortschritt und die immer mehr werdenden Informationen sind ein Kennzeichen der heutigen Zeit. Praktisch jeder hat einen Computer oder ein Handy. Damit ausgerüstet, glauben wir, dass wir einerseits in der Lage, andererseits aber auch dazu verpflichtet sind, selber auf die Suche nach den Lösungen unserer heutigen Fragen zu gehen… Jeder ist auf einmal ein „Doktor Google oder neuerdings Doktor Chat GPT”.
Was aber passiert, wenn jeder von uns zu einem eigenen Spezialisten / Experten / einem „Doktor Google“ in seiner Suche auf KI, Facebook, Twitter, YouTube oder TikTok wird? Werden wir dadurch zu aufgeklärten und kommunikativen Menschen? Eher das genaue Gegenteil scheint der Fall zu sein!
Wir werden immer mehr eine Gesellschaft voller Egoisten, Egozentrikern die immer weniger miteinander in einen echten ehrlichen zwischenmenschlichen Austausch gehen … Und dabei ist die größte Droge für einen Menschen doch genau das: der andere Mensch!
Durch das viele Senden von Nachrichten über Messenger-Dienste, durch das ständige Posten via Social Media Plattformen wie Twitter / Facebook und Co. unterbinden wir praktisch jeden direkten Augenkontakt. Jeglicher direkter Mensch-zu-Mensch-Kontakt wird vermieden… Gemeinsames Arbeiten in Gruppen gibt es praktisch nicht mehr… Wir vereinsamen in unseren Home-Office während der Pandemie und denken, dass Gespräche via Teams, Zoom etc. dem direkten Gespräch ebenbürtig sind.
1.3. Egoismus – die neue „Community“ – Wozu führt dieses egozentrische Denken und Handeln?
Dauerhaft hohe Scheidungsraten und auch die ständig wachsenden Erwartungen an eine praktisch unbegrenzte Mobilität haben in unserer Gesellschaft Eigenschaften wie z.B. Durchhaltevermögen und Authentizität in den Hintergrund treten lassen.
Die so genannten Babyboomer (Nachkriegskinder 1946 – 1964) waren wahrscheinlich die letzte Generation, welche noch dieselben Schulen und Kirchen wie ihre Eltern / bzw. ihre Großeltern besucht haben.
Lange, tiefe und auch vertrauensvolle Beziehungen oder Freundschaften sind durch immer häufigere Umzüge fast schon unmöglich … Die Folge davon ist, dass bei den Betroffenen dann eine tiefe Einsamkeit, Angst und Leere, aber auch Depressionen und der Verlust an Selbstachtung zurückbleiben. Und das Ergebnis? Immer mehr Menschen leiden an den Symptomen, die irgendwann – wenn alles zu viel wird – mit Borderline diagnostiziert werden.
Borderline wird in dem internationalen Klassifikations-Verzeichnis für Krankheiten, dem ICD 10 unter F60.31 kategorisiert. Die übergeordnete Kategorie (F60.30) ist bezeichnenderweise die emotionale Instabilität.
Borderline könnten wir – ganz vereinfacht ausgedrückt – auch als eine krankhafte / eine unreife Reaktion auf unsere neuen gesellschaftlichen Belastungen und Anforderungen bezeichnen.
Darum ist es fast schon konsequent logisch, dass wir heutzutage Borderline immer häufiger diagnostizieren.
- Dieses „Schwarz–Weiß“ / „Richtig-falsch“– Denken,
- diese Selbstzerstörung der eigenen Identität,
- diese emotionale Instabilität und nicht zuletzt diese Impulsivität
all das kommt zwangsläufig auf, wenn wir in unserer Gesellschaft immer weniger Stabilität und noch weniger eine Bestätigung des Selbstwertes erfahren.
Der Kern unserer gesellschaftlichen Problematik ist exakt dieses Fehlen von stabilisierenden Werten und Visionen. Das (!) ist das wahre Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft! Alles darf sein und nichts muss sein …
Von Alice Schwarzer bis Conchita Wurst ist praktisch alles erlaubt…
Aber hat uns das wirklich weitergebracht? Bringen uns unendliche Freiheiten, auch unendlich mehr Fortschritt / Freude / Sinn im Leben? Ist unendliche Freiheit wirklich eine Vision, die uns voranbringt? Etwas zynisch muss ich sagen: Nein!
Borderline wird meines Erachtens durch die vorherrschenden sozialen Bedingungen in großem Umfang nicht verhindert, sondern praktisch verursacht.
Zwar braucht jede Kultur ihren eigenen Sündenbock, um das Übel einer Gesellschaft zu beschreiben. Aber vielleicht ist Borderline – oder besser formuliert: die Borderline-Persönlichkeit, deren Identität ja in viele Fragmente gespalten ist – dass wohl zutreffendste Bild über das Zerbrechen von stabilen Einheiten in unserer Gesellschaft.
Borderline wird heute deutlich häufiger diagnostiziert als noch vor 10 oder vor 30 Jahren. Aber vielleicht waren zu den Zeiten von Sigmund Freud auch schon viele, die von ihm damals noch als Histrioniker bezeichnet wurden bereits Borderliner? Das kann schon sein, macht aber Borderline – egal wie lange es diese Störung bereits gibt – nicht weniger gefährlich…
Wir müssen uns darum einer Tatsache bewusst sein: Wir gehen einem neuen Zeitalter von Borderline mit offenen Augen entgegen.
Zusammenfassung Kapitel 1: Beginnen wir von vorne
Was Du aus diesem Kapitel mitnimmst: Dein praktischer Nutzen:
Du verstehst jetzt, dass Borderline keine isolierte “Störung” einzelner Menschen ist, sondern der Spiegel unserer gesamten Gesellschaft. Das nimmt Dir vielleicht ein Stück weit das Gefühl, allein mit diesem Problem zu sein. Du erkennst:
- Die Zahlen sind alarmierend: 3% der Bevölkerung haben eine BPS-Diagnose, aber 15-20% aller stationären Therapieplätze sind damit belegt
- Die Gesellschaft fördert Borderline aktiv durch fehlende Strukturen, Werteverlust und zunehmende Instabilität
- Deine Beobachtungen sind richtig: Die Welt wird tatsächlich “borderliner” – durch zersplitterte Familien, fehlende Traditionen und die Ich-Kultur der sozialen Medien
Der wichtigste Aha-Moment: Borderline ist die logische, krankhafte Reaktion auf unsere moderne Überforderungsgesellschaft. Du kannst aufhören, Dich oder den Betroffenen als “schuldig” zu sehen – das System ist krank, nicht ihr!
Warum Du jetzt Kapitel 2 lesen solltest:
Jetzt, wo Du den großen Zusammenhang verstehst, wird es konkret!
In Kapitel 2 erfährst Du:
- Wie genau unsere Gesellschaft auseinanderbricht (das “Aussterben” der Familie, der Verlust von Nähe, die Radikalisierung)
- Welche konkreten Mechanismen Dein Leben täglich beeinflussen (Polarisierung, fehlender Plan B, das Ende von Grautönen)
- Was der Preis für all diese Veränderungen ist – und wie Du ihn bereits zahlst
Du wirst verstehen, warum es immer schwieriger wird, stabile Beziehungen zu führen und warum gerade Du oder Dein Partner so reagiert, wie ihr reagiert.
Das ist die Grundlage, um später die U.M.W.E.G.©-Methode wirklich zu verstehen und anzuwenden. Denn erst wenn Du die Wurzeln kennst, kannst Du die Früchte beeinflussen.
Also: Weiter geht’s! Die Analyse wird noch spannender – und konkreter!
Kapitel 2 – Borderline – Der Zusammenbruch unserer zersplitterten Gesellschaft
2.1. Das „Aussterben“ der Familie
Ich denke, dass wir uns alle einer traurigen Tatsache immer deutlicher bewusst werden: Unsere westliche Kultur ist seit der Mitte des 20. Jahrhundert immer fragmentierter und zersplitterter geworden. Frühere noch stabilisierende Strukturen, die seit vielen vielen Jahrhunderten das Zentrum unserer Gesellschaft waren – ich denke, hier an die Kleinfamilie, die Familie überhaupt (Familie entstammt wie bereits gesagt aus dem umbrischen Sprachraum mit dem Begriff „fameria“ und bedeutet „wohnen“. Es bezeichnet also alle die zusammen wohnen – also eine gewisse Ortstreue an den Tag legen.)
Sie alle wurden durch eine immer größer werdende Zahl an neuen Mustern, Bewegungen und Trends komplett ausgetauscht … Wie sieht die Situation heute aus?
- Die Scheidungsraten sind auf einem alarmierend hohen Niveau,
- Drogen und Alkoholsucht explodieren förmlich. (Methamphetamin und Opioid-Missbrauch steigt massiv in den 2010er Jahren massiv an. 30% der erwachsenen Deutschen haben mindestens 1 x im Leben illegale Drogen konsumiert.
- Und wenn all das noch nicht genug wäre: immer mehr Kindesvernachlässigungen und Kindesmisshandlungen werden offenbar. Allein 2021 wurden über 17.000 sexuelle Missbrauchsfälle in Deutschland gemeldet. Das sind fast 50 Fälle pro Tag!
All dies geschieht in einem bislang nie gekannten Ausmaß … Es gab dies zwar schon immer, jedoch nicht in dieser übergroßen Anzahl!
- Verbrechen, Terrorismus und Mode aus politischen Gründen sind praktisch täglich in unseren Schlagzeilen zu lesen. Mehr als 20.000 Menschen sind 2021 z.B. durch eine Schusswaffe in den USA gestorben…
- Amokläufe, Schulmassaker und Gewalt an Schulen. Früher eher selten … 2021 geschahen diese knapp 2 mal pro Tag in den USA.
- Dazu kommen noch unsichere wirtschaftliche Zeiten. Das nervenaufreibende auf – und ab an den Märkten ist nicht mehr eine Ausnahmeerscheinung, Nein! Es gehört praktisch zur täglichen Routine …
2.2. Keine Nähe mehr in Sicht
Viele dieser Veränderungen stehen in einem direkten Zusammenhang zu dem Versagen unserer Gesellschaft, dem Einzelnen nach dem Streben nach Autonomie auch immer eine „soziale Wiederannäherung“ zu bieten. Was ist damit gemeint? …
Diese soziale Wiederannäherung ist meines Erachtens der zentrale Teil unseres Lebens – es ist die (!) Kernaufgabe unserer Gesellschaft!
Das Leben geht nämlich nicht nur rein linear vonstatten. Es entwickelt sich vielmehr eher „pulsartig“:
- Mal entfernt sich der Einzelne etwas von der sozialen Mitte – begibt sich auf die Suche nach seiner eigenen Identität.
- Und nach einer gewissen Zeit möchte er wieder in die Gemeinschaft zurück, um neue soziale Kraft und Stabilität zu tanken.
All das ist ein ganz natürlicher Vorgang und erinnert uns vielleicht an die Entwicklung eines Kleinkindes: In der sogenannten Ablösungs- oder Individuationsphase (in der Regel so zwischen dem 5. und dem 12. Lebensmonat) versucht das Kind langsam aber sicher, immer wieder die eigene Mutter zu verlassen – es sucht sich seinen eigenen Weg in ein autonomes Leben. Es kommt jedoch immer wieder zur Mutter zurück, da es ihre Wärme und Vertrautheit noch lebensnotwendig benötigt.
Kommt es hier nun zu einer Störung im wieder Annähern, dann hat dies in der Regel mit einem fehlenden Vertrauen, einer gestörten Mutter-Kind-Beziehung, einer inneren Leere, tiefer Angst und/oder einem unsicheren Selbstbild zu tun …
Wenn wir hier einmal genauer hinsehen, dann sind dies alles Bereiche, aus denen sich nach ICD 10 und 11 eine Borderline-Symptomatik zusammensetzt.
Gehen wir jetzt von der Mutter-Kind-Beziehung wieder in die Meta-Ebene und betrachten wir die Gesellschaft-Individuums-Beziehung: Fast könnte man sagen, dass die heutige Gesellschaft im Großen auf ähnliche Weise bei einer normalen „sozialen Wiederannäherung“ stört wie wir dies im Kleinen bei der Mutter-Kind-Beziehung beschrieben haben. Indem die Gesellschaft den Zugang zu den stabilisierenden sozialen Ankerpunkten versperrt, bleibt der Einzelne dauerhaft auf sich allein gestellt.
2.3. Krisen, wohin das Auge auch reicht
Nie war diese gesellschaftliche Störung deutlicher zu sehen als aktuell in unserem 21. Jahrhundert.
Zu erkennen ist dies in den vielen Wirtschafts Zusammenbrüchen, Rezensionen, dem Arbeitsplatzverlust, den Zwangsversteigerungen und nicht zuletzt in den weltweiten Pandemien mit ihren Isolationen. Sie sind wirklich das Kennzeichen unserer heutigen Zeit.
War die „Tulpenkrise“ 1637 noch für über 150 Jahre die einzige Krise mit überregionaler Bedeutung (erst 1799 kam dann die „Hamburger Handelskrise“) so gab es allein im 20. Jahrhundert bereits drei enorme Krisen:
- 1929 zweite Weltwirtschaftskrise
- 1970 Ölkrise
- 1997 Asienkrise
Die Spirale dreht sich heute jedoch schneller denn je, denn im immer noch jungen 21. Jahrhundert gab es bereits zwei große Krisen:
- 2000 die Dotcom-Blase
- 2007 die Finanz- und Wirtschaftskrise
- Und mit ein wenig Vorausblick kommt noch eine gigantische Inflationswelle aufgrund der Ukraine-Krise auf uns zu.
- Von der kommenden AI-Krise möchte ich derzeit noch gar nichts
In unserer heutigen westlichen Kultur sind immer mehr Eltern dazu gezwungen, die Erziehung Ihrer Kinder Dritten außerhalb der Familie zu überlassen, weil einfach zwei volle Gehälter nötig sind, um sich einen halbwegs vernünftigen Lebensstandard inmitten einer immer stärker werdenden Inflation zu erhalten.
Bezahlter Erziehungsurlaub oder Kindergärten in der Nähe des Arbeitsplatzes werden immer seltener, obwohl sie doch dringender denn je benötigt werden, um eine stabile Mutter-Kind-Beziehung in unseren hektischen Zeiten aufrechtzuerhalten.
Und wenn das noch nicht genug ist, machen die Anforderungen an unsere Arbeit und der wachsende wirtschaftliche oder soziale Druck auch noch häufige Umzüge erforderlich.
All diese aufgezählten Punkte und noch weitere nicht Erwähnte bringen jeden Einzelnen immer weiter weg von seinen stabilisierenden Wurzeln…
Wir verlieren mehr und mehr die Vorteile der Unterstützung durch Verwandte wie Omas und Opas, die früher regelmäßig in der Nachbarschaft gewohnt haben und Teil des Alltagslebens waren.
Das Leben wird immer instabiler und schutzloser. Und was wird dadurch gefördert? Eine innere und äußere Instabilität und Angst. Alles, was Borderline fördert.
2.4. Sitten und Gebräuche – im Wandel der Zeit
Sitten und Gebräuche sind sowohl innere als auch äußere Normen – wir können sie auch als Brauchtum bezeichnen. Brauchtum ist mit dem Wort „brauchen“ „ich brauche etwas“, „ich habe etwas nötig“ verwandt. Unsere Gesellschaft benötigt dieses Brauchtum, diese Sitten und Gebräuche, die Gewohnheiten, um eine vernünftige Routine im Leben zu finden. Routinen selber sind dann die Grundlage jeglicher Sicherheit und Stabilität. Ein wunderbares Tool GEGEN Borderline!
Wenn aber unsere wichtigen Sitten und Gebräuche verschwinden, dann hinterlassen sie eine Lücke voller Instabilität. Dies ist in etwa vergleichbar mit dem Gefühl des Verlassenseins … so, als ob man in einem unbekannten nebligen Gebiet ohne Navigation umherirrt.
Wie wirkt sich dies auf unsere Kinder aus? Ihnen fehlt immer mehr ein wirkliches Geschichts – und Zugehörigkeitsgefühl zu der Gesellschaft, in der sie sich befinden. Ihnen fehlt ein Anker, um sich in der Gegenwart der aktuellen Welt einen eigenen autonomen Platz zu erkämpfen. Sie bleiben Fremde in einer für sie fremden Gesellschaft – alles Grundlagen für die Leere eines Borderliners.
Und wie wird dieses Gefühl der Leere in der Regel dann gefüllt? Wenn nicht mit Stabilität, was bleibt dann überhaupt noch übrig?
Auf der Suche nach wenigstens ein bisschen Stabilität greifen viele leider immer wieder auf krank machende pathologische Ersatz-Verhaltensweisen zurück – ich denke da besonders
- an Drogenmissbrauch durch Amphetamine, Cannabis, Ecstasy, Kokain, Methamphetamin und all die anderen NPS die „neuen psychoaktiven Substanzen“.
- an Essstörungen wie Magersucht, Binge-Eating, Bulimie
- aber auch an all die vielen Formen kriminellen Verhaltens
und vieles mehr.
Der Wegfall unserer bisherigen Sitten und Gebräuche hinterlässt wirklich eine tiefe Lücke und fördert Borderline.
2.5. Das Versagen unserer Gesellschaft.
Die wohl elementarste Aufgabe einer Gesellschaft ist es, dem Einzelnen – nach seiner Suche der eigenen Autonomie — immer wieder eine Strategie der Wiederannäherung zu beruhigenden und stabilisierenden Bindungen zu bieten.
Leider versagt sie in genau dieser wichtigen Aufgabe. Das spiegelt sich in einer andauernden Serie von radikalen gesellschaftlichen Bewegungen während der letzten 50 Jahre wider…
- Wir sind von dem Aufbruchsjahrzehnt / dem „Wir–Jahrzehnt“ der 1960er – Jahre, in dem der Kampf um immer mehr soziale Gerechtigkeit und sexuelle Freiheit im Vordergrund stand, zum narzisstischen „Ich–Jahrzehnt“ der 1970er – Jahre gelangt.
- Dann kamen die materialistischen und noch mehr „Ich-bezogenen 1980er – Jahre. Der Narzissmus feierte sich immer mehr selber.
- In den 1990er – Jahren hatten wir dann mal eine kurze Verschnaufpause mit etwas mehr an Ruhe, Stabilität und Wohlstand, die aber nicht lange anhielt.
- Denn bereits ab dem Jahre 2000 hatten wir dann zwei mehr als turbulente Jahrzehnte, die gekennzeichnet waren durch zwei weltweit verspürte Wirtschaftskrisen:
- die Dotcom – Krise im Jahr 2000
- und die große Banken- und Finanzkrise im Jahr 2007-2008 als Folge eines spekulativ aufgeblähten Immobilienmarktes.
- Naturkatastrophen wie zum Beispiel
- 2004 der Tsunami im indischen Ozean (225.000 Todesopfer)
- 2010 das Erdbeben auf Haiti mit 222.000 Todesopfern
- 2008 der Zyklon Nargis in Myanmar mit 138.000 Todesopfern
- 2008 das Erdbeben in China mit 87.000 Todesopfern.
- Nicht zu vergessen sind dann noch die Hurricane Katrina 2005 und Ida 2021 mit jeweils 1645 Mrd. und 65 Mrd. US§ Schaden.
- Erdbeben und Waldbrände (2020 war in Kalifornien das verheerendste Jahr der Brände), die Bedrohung durch den Klimawandel).
- durch Viren verursacht Pandemien
- 2002 SARS
- 2004 Vogelgrippe
- 2009 Schweinegrippe
- 2012 MERS
- 2014 Ebola
- 2019 COVID
- lang andauernde Kriege wie zum Beispiel im Irak, in Afghanistan, Jemen, Mali, Ukraine und Syrien. Jeden Tag kommen im Durchschnitt 500 Menschen durch gewalttätige Konflikte ums Leben – das sind in etwa 182.000 Tote pro Jahr durch Kriege.
- Aber auch gesellschaftliche Umbrüche:
- Zum Beispiel immer größere Demonstrationen gegen Kriege
- aber für LGBTQ–Rechte (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), Black-Lives-Matter und die „Me2 Bewegung).
All diese Kräfte und Ströme destabilisieren unsere Gesellschaft bis ins tiefste Innerste…
Warum erwähne ich dies? Weil es ein Kennzeichen von Borderline darstellt! Kriterium Nummer 3: starke und andauernde Instabilität des Selbstbildes.
Unsere Gesellschaft zeigt immer deutlicher die Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung.
2.6. Der Verlust von Zugehörigkeit und echter Kameradschaft
Der wohl größte Verlierer dieser gesellschaftlichen Veränderungen ist meiner Beobachtung nach die Kameradschaft, die Gruppentreue, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft – die Hingabe an eine Familie, echte Nachbarschaftshilfe, der Glaube an eine Kirche, an den Beruf und nicht zuletzt die Treue an das Land und damit die eigene Herkunft.
Da unsere Gesellschaft weiterhin viel eher Distanz als Annäherung für den Einzelnen bietet, reagieren immer mehr darauf mit einem Verhalten welches wir aus der Diagnose des Borderline-Syndroms her kennen:
Was wir in unserer Gesellschaft nämlich immer mehr beobachten müssen ist
- ein geringeres Identitätsgefühl.
Kriterium Nummer 3: Die Identitätsstörung. - eine Verschlechterung praktisch aller zwischenmenschlichen Beziehungen.
Kriterium Nummer 2: Intensive, aber auch instabile zwischenmenschliche Beziehungen bei einem ständigen Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung. - Isolation, Einsamkeit und Langeweile.
Kriterium Nummer 7: Das chronische Gefühl einer überbordenden Leere. - Und da wir immer einsamer werden, fehlt anschließend auch die stabilisierende Kraft eines positiven Gruppendrucks. Fehlt er, wird der Einzelne immer impulsiver und unberechenbarer…
Kriterium Nummer 4 (starke Impulsivität) und Kriterium Nummer 8: Schwierigkeiten, Wut nicht anpassen zu können.
2.7. Die Radikalisierung unserer Gesellschaft
Die innere Welt eines Borderliners ist voller Widersprüche in sich.
Das sollte uns jedoch nicht allzu sehr verwundern, da auch unsere Welt in der Gesamtheit in sich immer widersprüchlicher wird… Einerseits glaubt doch jeder Einzelne von uns, dass Frieden besser ist als Krieg und Gewalt.
Warum aber sind dann andererseits unsere Straßen, die Schulen, all die Blockbuster, unser Fernsehen und die vielen aktuellen Videospiele so voll mit Aggressionen und Gewalt?
Beim Erstellen dieses Beitrages waren in der Top10 Liste der angesagtesten Spiele ganz vorne
- Dead Space (FSK 18)
- GTA
- Fortnite (FSK 12)
- Far Cry (FSK 16)
- Battlefield (FSK18)
- Call of Duty: Modern Warfare (FSK 18)
Das fühlt sich doch nicht wirklich nach Frieden an… oder?
Als 1869 die ersten weißen Siedler in den sogenannten Siedlertrecks begannen, Amerika zu besiedeln, war man sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Nachbarschaftshilfe ein fester Bestandteil der Kultur und der amerikanischen Gesellschaft ist. Heute – 150 Jahre später – ist aus diesem Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht mehr viel zu verspüren. Amerika und praktisch die gesamte westliche Kultur hat sich in eine politisch konservative, egoistische und auch materialistische Gesellschaft verwandelt.
Ein egoistisches, selbstbewusstes und tatkräftiges Vorgehen wird deutlich mehr gefördert, erwartet und geachtet, wohingegen Nachdenken und Selbstreflexion fast schon mit Schwäche und Inkompetenz gleichgesetzt wird.
- „Wer zögert, verliert“
- „Nicht reden, sondern handeln“
- „Erfolg hat drei Buchstaben: T.U.N.“
- „Sei ein Macher – sei Proaktiv“
Ist dies aber wirklich der richtige Weg? Warum war unsere Kultur in den vergangenen Jahrhunderten denn so erfolgreich? Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir ZUSAMMENgearbeitet haben. Zusammen ist man halt stark… Aber das wäre ja das Gegenteil von Borderline…
2.8. Polarisierung – Oder: Mit Gewalt zu einer einfachen Lösung
Die gesellschaftlichen Kräfte heute zerren und ziehen an uns mit einer noch nie dagewesenen Kraft und Intensität. Dauernd fordern sie uns dazu auf, eine polare Haltung anzunehmen / alles mit einer Unvereinbarkeit zu betrachten, wie wir dies bislang nicht kannten:
Alles ist entweder „Schwarz oder Weiß“, es ist entweder „richtig oder falsch“, „gut oder schlecht“. Jemand ist „schuldig oder unschuldig“. Grautöne oder einen Plan-B scheint es nicht mehr zu geben.
Selbst beim Thema Hobbys ist dies zu verspüren. Warum können wir nicht mehr einem Hobby nachgehen, ohne uns dabei unter Druck zu setzen?
Als Marathonläufer war ich besonders interessiert, als eine Studie über Doping im Breitensport herauskam.
Bei einer anonymen Befragung von Teilnehmern des Bonn-Marathons gaben 60% (!) an, noch vor dem Start Schmerzmittel eingenommen zu haben – ohne akute Schmerzen zu haben.
Und da spreche ich noch nicht mal „sonstige Betäubungsmittel“ an, unter die z.B. Anabolika fallen. Die Schlagzeile: „Fast jeder 5. Im “Fitness dopt“ lässt erahnen, welchem Druck sich der Einzelne ohne Notwendigkeit aussetzt.
Hört sich das alles für Dich nicht auch nach Perfektionismus an? Und ja, tatsächlich können wir dieses „Schwarz-Weiß-Denken“ aus dem Perfektionismus auch in der Borderline-Symptomatik deutlich erkennen. Hier jedoch in einer vielfachen Stärke im Vergleich zum Perfektionismus.
Perfektionismus ist ein ängstliches Kreisen um das eigene schwache Selbst oder Ich… Immer der Frage nachgehend:
- „Bin ich überhaupt gut genug für die Bewertung anderer?“ Denn nur wenn ich GUT GENUG bin, dann bin ich auch perfekt und gut.
Wäre ich nur „halb gut”, dann bin ich gar nicht gut und auch nichts mehr wert.
Die krankhafte / pathologische Steigerung von Perfektionismus können wir im Borderline-Syndrom sehr gut erkennen.
Eine Stufe dazwischen dürfen wir aber nicht übersehen: die emotional Unsicheren. Wir leben heute in wirklich unsicheren Zeiten. Menschen mit einer ansonsten stabilen emotionalen inneren „Landschaft“ fühlen sich durch die unsicheren Zustände um sich herum selber immer unsicherer. Da kommt schon öfter mal die Frage auf: „Bin ich hier vielleicht der alleinige Verrückte, oder wird die Welt um mich herum immer verrückter?“
Vor noch gar nicht langer Zeit hatten wir in den Paarbeziehungen noch die Konstellation, dass sich ein „Emotional Instabiler“ (F60.30) oft mit einem Narzissten verbunden hat.
Der Narzissmus kam meiner Beobachtung nach als Folge der neuen Erziehung nach den beiden großen Kriegen auf: „Unseren Kindern soll es niemals so schlecht ergehen, wie wir es erleben mussten.“
Diese vielen Prinzen und Prinzessinnen wurden damit in dem Glauben erzogen, dass ihr Egoismus richtig und gut sei. Was aber war die Folge? Was passiert eigentlich, wenn Egoisten Kinder bekommen?
Aufgrund ihrer egozentrischen Sicht- und Lebensweise wurden ihre Kinder emotional weniger beachtet. Ihre Kinder waren vielmehr ein Statusobjekt oder oft nur noch ein Störfaktor.
Diese Kinder wollten aber natürlich Bindung, bekamen diese jedoch viel zu wenig. In der Folge davon entwickelte sich bei ihnen eine dauerhafte emotionale Unsicherheit.
Die krankhafte / pathologische Steigerung von emotionaler Unsicherheit wäre dann die „Emotionale Instabilität“
Und Borderline wird durch die Erziehung von egozentrischen Eltern deutlich stärker gefördert.
Kommen wir zurück zu dem Zwischenthema der Polarisierung… Alles wird heute immer stärker in einem „schwarz-weiß-Denken“ kategorisiert. Warum? Weil wir alle einmal in solch einer „heilen kleinen Welt“ gelebt haben: in unserer frühesten Kindheit. In dieser Zeit war für uns (!) alles noch so einfach. Diese Erfahrungen haben wir alle in unseren Erinnerungen gespeichert. Aber nur in unserem kleinen Kosmos. Die große komplizierte Welt um uns herum ist aber nicht so einfach und schon gar nicht nur schwarz oder nur weiß. Wobei sich die gesellschaftliche Haltung leider in genau diese Richtung entwickelt.
In der Politik werden heute fast nur noch die Personen gewählt, die extreme polare / polarisierende Haltungen einnehmen:
- „Nur ich habe recht, der andere ist ein Lügner!“
- „America first und alle anderen danach“
- Am 29.02.2002 bezeichnete George W. Bush Länder wie Iran, Irak und Nordkorea als die Achse des Bösen.
- Ronald Reagan nannte die Sowjetunion das Reich des Bösen (The Evil Empire)
- Der Austritt Großbritanniens aus der EU – der Brexit – spiegelt dieses Denken genauso wider.
Aber nicht nur die Politik spaltet. Sekten und religiöse Splittergruppen treten immer lauter auf und beschwören ihren Zuhörern: Dieser Weg ist der allein selig machende, selbst wenn er den Freitod bedeutet. Ich denke hier an
- das Jonestown-Massaker 1979,
- 1993 starben 81 Anhänger der Davidianer Sekte in Waco / Texas
- 1994 starben 53 Mitglieder des „Ordens der Sonnentempler“ in der Schweiz und in Kanada.
- 1997 starben 39 Mitglieder der Sekte „Heaven’s Gate“ in Santa Fe bei San Diego / Kalifornien.
Politik und Religion sind aber immer noch nicht die einzigen Treiber in einem „Schwarz-Weiß-Denken“. Auch unser Rechtssystem hat einen massiven Anteil an dieser Entwicklung! Unsere Rechtsprechung beruht nämlich auf der Bedingung / der Prämisse, dass ein Mensch entweder nur schuldig oder gar nicht schuldig / unschuldig ist.
Spürst du, dass hier praktisch kaum Raum für Zwischentöne übrig bleibt?
Und wenn etwas in der Rechtsprechung immer entweder richtig oder falsch ist, dann muss doch eigentlich auch die Lehre von einem fairen und gerechten Leben in sich schlüssig und korrekt sein, oder? Und wenn das Leben fair und gerecht ist (von Anfang an ist das ein Trugschluss) und trotzdem etwas Schlechtes passiert, dann ist es nach dieser Kausalität doch logischerweise die Schuld eines Anderen und er muss dann dafür bezahlen.
Der Andere ist schuld und ich bin das arme Opfer! Und wiederum lässt Borderline grüßen.
2.9. Immer der neueste Trend
Die ständig größer werdende Flut an Informationen und Freizeitalternativen macht es einem immer schwerer, vernünftige Prioritäten zu setzen.
Nicht umsonst lesen wir Schlagzeilen wie diese:
- „Sad Tox“ Digitale Mutproben werden immer mehr zur Belastung Jugendlicher.
- Es fing mal mit einer Eiskübel-Challenge an. Was damals noch für einen guten Zweck diente (Förderung der ALS Forschung – Amyotrophe Lateralsklerose), all das entwickelt sich heute immer stärker in eine übertrieben pathologische Richtung.
Dieses immer öfter zeigen von selbstverletzendem Verhalten in den Mutproben (siehe Kriterium Nummer 4 BPS) ist ein trauriges Kennzeichen unserer heutigen Zeit.
Wäre es nicht toll, wenn wir es schaffen könnten, uns nicht nur körperlich ausgewogen zu ernähren, sondern auch geistig?!
Denn, was wir wirklich benötigen, ist eine ausgewogene, fast schon salomonisch proportionierte Haltung zu Ernährung, Arbeit und Freizeit, Altruismus und Egoismus.
Und warum wünsche ich mir das? Weil der Übergang von einem selbstbewussten Handeln zur Aggressivität, von einem gesunden Individualismus zu einer krankhaften Entfremdung / bzw. Isolation, von einem vernünftigen Selbsterhaltungsgedanken zu Egozentrik oft nur ein sehr sehr kleiner Schritt ist.
Die Gefahr, dass das gesamte System unserer inneren Haltung in eine Instabilität kippt (Borderline ist emotionale Instabilität) ist viel zu groß und nicht zu unterschätzen.
2.10. Kein Platz für Plan-B
Kennst du noch den Satz: „Pi mal Daumen“?
Er steht für eine etwas lockere Art um zu sagen: „Grob geschätzt passt das schon“
Pi ist eine Zahl, die sehr genau genommen werden kann, da sie unendlich viele Zahlen nach dem Komma hat.
Dadurch dass man diese Zahl nun einfach mit dem Daumen kombiniert – also grob über den Daumen etwas überschätzt – führt man eine grobe Einschätzung durch, immer in dem Wissen, dass es nicht 100%ig, jedoch annähernd richtig ist. Dadurch kann man sich viele Dinge im ansonsten so komplizierten Alltag schnell vereinfachen.
Was aber passiert aktuell in unserer Gesellschaft? Wird denn alles einfacher? Genau das Gegenteil können wir beobachten.
Unter dem immer weiter wachsenden Drang zur Digitalisierung und Industrie 4.0 wurden viele Prozesse fast schon exzessiv in eine immer stärkere Präzision geführt. 1967 nahm dies seinen Anfang mit dem ersten Taschenrechner von Texas Instruments. Das 1,5 kg „schlanke, schwere Gerät“ hat in den folgenden Generationen von Schülern das Kopfrechnen und den alten Rechenstab ersetzt.
Der Taschenrechner war aber lediglich der Anfang. 1979 kam mit dem Atari 400 der erste Heimcomputer auf den Markt, gefolgt von vielen Versionen anderer Hersteller wie Apple, IBM und Amiga. Diese Computer wurden immer wichtiger und hielten in fast allen Bereichen unseres Lebens Einzug – in Autos, Mobiltelefonen, Haushaltsgeräten etc. Überall sind PC´s integriert, um Geräte präziser und effizienter zu steuern.
Von der Mikrowelle bis zum Multifunktionskocher (ich möchte das Wort Thermomix vermeiden) gibt es immer mehr Gerätschaften, die uns davor bewahren, irgendwie doch mal selber kochen zu müssen.
Online Rezepte, Online-Essen-Kaufen wie zum Beispiel bei „Hellofresh” entbinden einen vom Denken und sogar vorm Einkaufen. Kreatives Selber-Kochen („was bietet Küche und Keller?“) kommt hierbei gar nicht mehr vor.
Der Hang zum „weniger selber kreativ sein“ geht aber noch weiter…
Denn seitdem es Schuhe mit Klettverschluss gibt, müssen Kinder gar nicht mehr diese Fingerfertigkeit erlernen und eine Schleife binden.
Laut einer Statistik aus dem Jahre 2018 können Kinder zwischen 2 und 5 Jahren zwar eine Computermaus bedienen, 63% den PC aus- und einschalten, 58% ein einfaches PC-Spiel spielen… aber lediglich 11% von ihnen können Schnürsenkel binden.
Was ist die erschreckende Folge hiervon? Die natürliche Kreativität und auch der intellektuelle Fleiß werden für immer mehr Bequemlichkeit und eine fast schon unmenschliche Präzision aufgegeben.
Ganz nebenbei: Kann ich die Kreativität meiner Kinder denn überhaupt fördern? Ja! Merk dir einfach mal folgende einfache Tricks eines mehrfachen Vaters:
- Vermittle keine Angst vor dem Scheitern.
- Sorge bewusst auch mal für Langeweile. Gib deinem Kind ganz einfach mal Zeit, damit es sich etwas selber ausdenken und eigenhändig Dinge erschaffen kann. Kreativität kommt fast immer aus Langeweile
- Sorge für kreative Utensilien wie Wasserfarben, Papier, Pinsel, Papprollen. Kleine Künstler wollen sich auch mal austoben.
- Sei selber ein Vorbild an Kreativität. Sammle mit deinen Kindern auf Spaziergängen Blätter, Äste oder andere Naturmaterialien. Denke mehr DIY.
- Kritik wo nötig, aber Wertschätzung wo möglich. Hat das Kind etwas gebastelt, gesungen oder getanzt, was jetzt nicht wirklich deinen Erwartungen entsprach, dann lobe seine Bereitschaft etwas zu tun. Kritik hat erst dann seinen Platz, wenn das Kind etwas sicherer ist in seinen Fähigkeiten. Anfänger werden darum nie kritisiert, sondern nur ermuntert,
Glaube mir, so entstehen keine Borderliner. So lernen Kinder fest ins Leben zu kommen!
2.11. Die Facetten des Lebens
Unser menschliches Auge kann in etwa (wieder Pi mal Daumen 😊) 200 Farben unterscheiden. Wenn wir dabei noch die vielen Varianten mit unterschiedlichem Weißanteil und Helligkeit hinzunehmen, dann kommen wir auf ca. 2 Millionen Farbnuancen, die unser Auge alle erkennen kann.
Unser Ohr steht dem in nichts nach. Es kann bis zu 7000 unterschiedliche Tonhöhen unterscheiden. Es gibt hier bei weitem nicht nur Ton AN oder Ton AUS…
Warum nehme ich diese Vergleiche mit in meinen Beitrag? Es geht doch um Borderline, oder? Und ja, das typische Borderline-Denken ist nämlich, dass alles in der Spaltung entweder nur schwarz oder nur weiß ist, entweder … oder..
Aber unsere Welt war noch nie präzise entweder oder…! Unsere Welt besteht seit jeher aus vielen leichten bis schweren Ungerechtigkeiten.
Dieser Welt nun eine weiße Ordnung überstülpen – wie eine Schablone, das ist völlig unmöglich.
Aber genau das ist der typische und verzweifelte Kampf eines Borderliners, den er 24/7 täglich führt. In der Borderline – Persönlichkeit gibt es nämlich leider nur ein schwarz oder weiß, ein Richtig oder ein Falsch, ein Gut oder Böse…
Das gesamte Leben mit all seinen wunderbaren Facetten und Feinheiten wird von ihm als entweder falsch oder richtig eingeschätzt.
Für ihn muss jeder Mann (dies dient hier nur als Beispiel) auch als männlich eingestuft und jede Frau als weiblich eingestuft werden. Doch wir alle wissen, dass nicht alle Männer gleich männlich und alle Frauen nicht gleich fraulich sind – ich möchte hier nicht immer Alice Schwarzer und Conchita Wurst erwähnen, obwohl sie doch gute Beispiele für einen Vergleich wären.
Unsere Welt ist jedoch weder gerecht noch 100% exakt!
Unsere wunderbare Welt setzt sich aus so vielen unterschiedlichen Grautönen / aus Feinheiten zusammen, die gar nicht in dieses stark vereinfachende „Entweder-oder-Schema“ passen können.
Darum sollten wir uns über eine Tatsache immer bewusst sein:
Eine starke gesunde Gesellschaft kann und muss auch unbequeme Denk-Alternativen aus ihren Reihen akzeptieren. Denn alle Versuche, so etwas auszumerzen oder zu ignorieren, ermutigen eine Borderline-Gesellschaft nur noch mehr zu polarisieren. Lass uns mal bei diesem Polarisieren bleiben:
2.12. Polarisierung lässt niemanden von uns unberührt
Es wäre naiv zu glauben, dass all diese neuen Denkrichtungen, die auf uns einströmen, keine Auswirkung auf unsere Denke und unsere Psyche haben. Man kann kein Gift trinken, ohne davon beeinflusst zu werden.
Und wenn mir mal etwas genauer hinsehen, dann leben wir gewissermaßen alle mehr oder weniger in einer Art gesellschaftlichen Spaltung / oder anders ausgedrückt: in einer sogenannten Borderline-Gesellschaft.
Einerseits leben viele ein reiches, gesundes Leben in einer hoch technologisierten Umgebung. Andererseits wird aber die Kluft zwischen Ihnen und denjenigen, die unter Armut, Heimatlosigkeit durch Flucht, Drogenmissbrauch und psychischen Krankheiten leiden, immer größer.
Allein in Deutschland flossen 81% des Vermögens 2020 und 2021 an das eine Prozent der Reichsten.
Auch weltweit ist in den vergangenen 100 Jahren eine Kluft entstanden, die surrealer gar nicht sein kann. Wir alle wünschen und träumen von einer gesunden, sicheren Welt und müssen dennoch einem wahnsinnigen Albtraum eines Atomkrieges oder einer immer realer werdenden Klimakatastrophe ins Auge sehen.
Als Folge davon kommt seit 2021 immer stärker das Wort „Last Generation“ auf. Ursprünglich ein Bündnis von Aktivisten aus der Umweltschutzbewegung in Deutschland und Österreich, wird es immer mehr zu einer allgemeinen Haltung und Bezeichnung für die Jugend welche immer krasser / immer wütender (Kriterium Nummer 8) vorgeht, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen.
Das dies alles keine hohlen Worte sind mit der Klimakatastrophe, zeigte 2022 António Guterres (UN-Generalsekretär) in einer Rede: „Wir haben die Wahl: Kollektives Handeln oder kollektiver Suizid.“
All dies lässt uns logischerweise nicht unberührt. Es zeigt aber auch die Symptome einer Borderline-Persönlichkeits-Instabilität in unserer Gesellschaft. Unsere Welt wird immer instabiler und damit immer Borderliner.
2.13. Der Preis für all diese Veränderungen
Der Preis all dieser nun angesprochenen sozialen Veränderungen hat einen großen Einfluss auf jeden Einzelnen von uns. Wir sind eine Gesellschaft voller Störungen in der inneren Stabilität geworden. Die Folge davon?
- Stress: Knapp zwei Drittel (64%) der Menschen in Deutschland fühlen sich gestresst. 28% sogar in einem übergroßen Ausmaß.
Stress kommt aus dem lateinischen Wortschatz „Stringere“ und beschreibt, dass etwas in Spannung versetzt wird. Spannung selber beschreibt den Druck in einer elektrischen Ladung. Und was bewirkt dieser Stress, diese Spannung oder Druck nun bei uns? Andauernder Stress ist Ursache von Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen, Magenschmerzen, Zähneknirschen, Diabetes und Atemnot.
Stress wirkt sich ganz klar auf die Psyche, unser Denken und damit die innere Stabilität aus. Borderline ist „Emotionale Instabilität (F60.30). Damit fördert Stress u.a. besonders Borderline.
Stress ist anerkanntermaßen eine Hauptursache für Burn-out, Depressionen, dass sich Menschen aus der Gesellschaft zurückziehen oder vermehrt zur Selbstmedikation wie z.B. Alkohol, Drogen aber auch Medikamenten greifen.
Wir müssen immer häufiger der Tatsache ins Auge sehen, dass psychische Erkrankungen zum psychologischen Preis gehören, den wir alle als Gesellschaft zu bezahlen haben…
Kapitel 2: Der Zusammenbruch unserer zersplitterten Gesellschaft – Kurze Zusammenfassung
Was Du aus diesem Kapitel mitnimmst: Dein praktischer Nutzen:
Jetzt wird es konkret! Du siehst nicht mehr nur das große Bild, sondern erkennst die einzelnen Risse in unserem gesellschaftlichen Fundament. Du verstehst jetzt:
- Warum Deine Familie sich so fremd anfühlt: Das “Aussterben” der Familie ist kein persönliches Versagen – 40-45% Scheidungsrate, explodierende Suizidzahlen bei Jugendlichen, und die traditionelle Familie wurde durch 200+ verschiedene “Familienmodelle” ersetzt
- Warum Du Dich so allein fühlst: 42% der Deutschen fühlten sich während Corona einsam – und das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Mobilität, Homeoffice und dem Verlust von Nachbarschaft
- Warum alles so extrem geworden ist: Die Polarisierung (Brexit, Trump, AfD) ist keine Phase – es ist das neue Normal. Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind, keine Grautöne mehr
Der wichtigste Aha-Moment: Du erkennst jetzt die neun Borderline-Kriterien in der Gesellschaft wieder:
- Verzweifelte Angst vor dem Alleinsein → Pandemie-Panik, Social Media Sucht
- Instabile Beziehungen → Dating-Apps, “überkreuzende Lebenspartner”
- Identitätsstörung → “Wer bin ich?” ohne Tradition und Wurzeln
- Impulsivität → Sad Tox, digitale Mutproben, Sofort-Konsum
- Suizidalität → “Last Generation”, Songs über den Tod vor 30
- Stimmungsschwankungen → Von Euphorie zu Depression in Sekunden
- Chronische Leere → Scroll, scroll, scroll – und trotzdem nichts gespürt
- Unangemessene Wut → Shitstorms, Cancel Culture, Empörungswellen
- Paranoia → Verschwörungstheorien, “die da oben” gegen “uns”
Du verstehst jetzt: Es ist nicht Deine Schuld, dass Deine Beziehung schwierig ist. Es ist nicht die Schuld Deines Partners. Die gesamte Gesellschaft wird immer “borderliner” – und ihr seid mittendrin.
Warum Du jetzt Kapitel 3 lesen solltest:
Okay, Du weißt jetzt, dass die Gesellschaft zerbricht und wie sie zerbricht. Aber warum fühlt sich alles so verdammt hoffnungslos an?
In Kapitel 3 tauchen wir ein in die große Angst vor der Zukunft:
- Woher kommt diese lähmende Angst, die 59% der jungen Menschen nachts nicht schlafen lässt?
- Was bedeutet es, wenn eine ganze Generation sich “Last Generation” nennt?
- Warum leben wir nur noch im “Hier und Jetzt” – und warum ist das für Borderliner Gift?
Du wirst verstehen, warum Zukunftsangst das Kriterium Nr. 1, 6, 7 und 8 so massiv befeuert. Und Du wirst erkennen, dass diese Angst nicht irrational ist – sie ist die logische Reaktion auf eine Welt ohne Hoffnung.
Das wird hart. Aber notwendig. Denn erst wenn Du die Angst verstehst, kannst Du später lernen, ihr zu begegnen.
Also: Atme durch. Und lies weiter. Die Reise geht tiefer – aber sie führt Dich auch zur Lösung.
Kapitel 3 Borderline – Die große Angst vor der Zukunft
Was verstehen wir unter Zukunftsangst? Sie ist
- eine Furcht vor den Konsequenzen zukünftiger Ereignisse
- aber auch vor einem Kontrollverlust über das, was noch so alles kommen mag.
Diese Furcht beobachten wir häufig in Verbindung mit einer Borderline-Störung, da die „Emotionale Instabilität“ und das negative Selbstbild oft zu überwältigenden / überfordernden Ängsten führt – ganz besonders bei der Vorstellung der Zukunft.
Dies ist das dritte Kapitel über das Thema „Werden wir alle immer Borderliner?“ Nachdem wir uns in den Kapiteln 1 und 2 über die Veränderungen in der Kultur und der Gesellschaft auseinandergesetzt haben, sprechen wir nun über die Grundemotion Angst als Zeichen dafür, dass Borderline immer häufiger zu beobachten ist.
Die Themen der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Veränderung der Geschlechterrollen, die Familien und der Ausblick auf unser angefangenes Jahrtausend folgen in den späteren Kapiteln.
„Mehr als die Hälfte unserer Kinder und der jungen Erwachsenen hat Angst vor der Klimakrise – und zwar in einem so gravierenden Ausmaß, dass es ihren Alltag massiv beeinflusst.“
Zu diesem Ergebnis kommt die bisher größte wissenschaftliche Studie zum Thema “Klima Angst” bei jungen Menschen. Fast jeder 6. von 10 jungen Menschen (59 Prozent) im Alter von 16 bis 25 Jahren macht sich große, ja sogar extreme Sorgen über zukünftige Ereignisse z.B. über den bevorstehenden Klimawandel.
Diese Veränderung in Bezug auf die Angst vor der Zukunft sehen wir bis in die Praxen der Psychotherapeuten. In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten konnten wir eine bemerkenswerte Veränderung bei den psychischen Krankheiten feststellen:
Die Diagnosen veränderten sich nämlich stetig von damals hauptsächlich Symptomneurosen hin zu Charakterstörungen.
Symptomneurosen sind unverhältnismäßig starke Ängste, die aber mit einer definierbaren Situation oder einem Objekt in Verbindung gebracht werden können („Ich weiß, wovor ich Angst habe“).
Die Charakterstörungen beschreiben andererseits eher eine undefinierbare, eine flottierende Angst vor „irgendetwas“.
Ein Psychiater beschrieb dies mal so:
„Ärzte und Therapeuten werden immer häufiger von Patienten aufgesucht, die nicht in die bekannten diagnostischen Kategorien passen. Sie leiden nicht unter den bekannten, klar definierbaren Symptomen. Es sind eher vage und nur schlecht zu beschreibende Beschwerden… “Praktisch jeder heutige Therapeut weiß was ich damit meine.“
Seit den 1980er – Jahren sind diese Diagnosen derart häufig geworden, dass Persönlichkeitsstörungen die klassische Neurose an Zahl ersetzen.
3.1. Was ist das – diese Angst?
Etymologisch betrachtet (griech. Das wahre / echte Wort) hat sich der Begriff Angst aus dem indogermanischen Wort „anghu“ (beengend) über das althochdeutsche Wort „angust“ entwickelt. Verwandt ist es mit dem lateinischen Ausdruck „angustus“. Dieses Wort steht für „Enge, Bedrängnis“. … Mediziner erkennen hier sofort den Zusammenhang mit dem Begriff „Angina“ der für eine einengende Krankheit steht wie z.B. die Angina-Pectoris (Brust-Enge)
Angst engt ein. Angst bringt einen umgangssprachlich ausgedrückt in einen „Schwitzkasten“. Diese Wortwendung verdeutlicht auch die körperliche Reaktion recht gut, denn
- man schwitzt und
- man fühlt sich eingeengt wie in einem Kasten bei Angst.
Angst zeigt sich im Körper unter anderem durch einen erhöhten Puls, eine Erweiterung der Pupillen und nach außen durch sichtbare Gesten wie z.B. Händeringen. Innerpsychisch bewirkt Angst u.a. ein Gefühl des Entsetzens und Ausweglosigkeit.
Und dieses „Eingefroren sein“ wird immer mehr zu einer allgemeinen Grundstimmung in der Bevölkerung.
Obwohl immer wieder von einer „German Angst“ gesprochen wird, ist es doch bemerkenswert, dass einer Studie zufolge ²/3 der deutschen Bevölkerung wirklich von Grund auf ängstlich in die Zukunft blickt.
Das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen wird immer geringer und die Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung immer größer. Dies ist das Ergebnis einer tiefenpsychologisch repräsentativen Studie des Kölner Rheingold-Instituts aus dem Jahre 2021
Angst ist aber nicht nur lähmend / einfrierend… Angst kann auch das Gegenteil bewirken: Angst kann einen so richtig antreiben …
Wenn Menschen in Gefahr sind, werden sie durch die Angst manchmal zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen absolut nicht möglich gewesen wären.
Ich erinnere mich hier an die Studien der Psychologen Robert Yerkes (1876-1956) und John Dodson (1879-1955). Sie fanden heraus, dass ein „optimales Ausmaß an Anspannung und Angst“ unsere Sinne eher schärft, die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis steigert und damit ein problemlösendes Denken und Handeln fördert.
Der Begriff „optimales Maß“ zeigt aber auch, dass ein Zuviel an Angst die Leistung wieder in das Gegenteil verändert, wie z.B. durch einen Blackout oder einen Tunnelblick.
Angst – besonders ein Zuviel an Angst – ist wirklich das, was das Wort im Grunde genommen ausdrückt: es engt ein…
Und dieses Einengen ist wie ein Gift für einen Borderliner! Wo wir wieder bei unserem Thema sind. Borderline ist gekennzeichnet von einer dauerhaft vorhandenen flottierenden Angst.
3.2. Was ist die Ursache für den rasanten Anstieg der Angst?
Gibt es soziale oder kulturelle Faktoren als Mitverursacher für die Angst in unserer Gesellschaft? Eine Ursache hierfür ist mit Sicherheit, dass unser Kontakt oder der Bezug zur eigenen und auch zu einer gesellschaftlichen Vergangenheit immer weiter verloren geht.
„Lebe jetzt – genieße den Augenblick“, das ist eine weit verbreitete, fast schon leidenschaftliche Haltung unserer Zeit geworden.
HSchon mal solche Sätze wie
- „Carpe Diem“ (pflücke bzw. genieße / nutze den Tag) oder
- „Lebe für dich selbst und nicht für andere, schon gar nicht für Deine Ahnen oder Deine Nachkommen“.
gehört?
Was sich im ersten Moment eigentlich gar nicht so falsch anhört – denn was können wir schon den Vorfahren mit unserem Leben antun oder unseren Kindern Schlechtes zufügen – all das hat trotzdem doch eine gewaltige Konsequenz für unser eigenes Leben! Denn genau durch solch eine Haltung verlieren wir immer schneller das Gefühl, Teil einer geschichtlichen Linie zu sein.
Ein stabiles Gefühl – dass ich Teil einer Generationenfolge bin, die ihren Ursprung in der Vergangenheit hat und deren Leben sich in die Zukunft auswirkt – kommt dann gar nicht mehr auf.
Ist das aber wirklich so schlimm? Fördert das denn nun wirklich Borderline?
3.3. Wenn das Fehlen einer Vergangenheit keinen Platz für die Zukunft lässt
Borderline ist nach dem ICD-10 Teil der „Emotionalen Instabilität F60.30“. Emotionale Instabilität – das ist nun der besondere Begriff, dem wir einmal zuwenden sollten.
Verlieren wir nämlich immer öfter den Kontakt zu unserer geschichtlichen Kontinuität, dann wirkt sich dies sowohl auf den Blick in die Vergangenheit, aber auch auf unsere Zukunft aus! Wenn uns unsere Vergangenheit nicht mehr wichtig ist, dann wirkt sich dies zwangsläufig auch darauf auf, wie wir die Zukunft wahrnehmen. Sie wird dadurch nämlich zu einer riesigen Unbekannten.
Und wenn etwas unbekannt ist, dann wird aus Hoffnung schnell Angst… Vergleichen könnten wir dies mit einem schlammigen Morast. Einmal eingesunken hält er einen „bombenfest“. Ein Loslösen ist dann fast unmöglich.
Habe ich den Blick für die Vergangenheit und die Zukunft verloren – lebe ich also nur noch (!) im Jetzt – dann wird die Zeit lediglich in isolierten Schnappschüssen wahrgenommen. Unsere Erfahrungen sind dann nicht mehr als eine logische, sich fortsetzende Ereigniskette. Alles ist dann irgendwie losgelöst von den Leistungen der Vergangenheit und hat auch keinen Bezug mehr zu einer eventuell schönen Zukunft.
Spürst Du die Verbindung zu unseren heutigen Kommunikationsplattformen? Alles ist im Moment, hat keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Fast schon ironisch, dass eine dieser Plattformen sogar „Snapchat“ genannt wird. Hier kann man – wie neuerdings auch auf anderen Apps – bestimmen, wie lange die versendete Datei für den Empfänger sichtbar bleibt. Es lebe der Moment… Alles wird immer fragiler und kurzfristiger und damit zu einem Nährboden für den Borderliner.
3.4. Wie beeinflussen Katastrophen die Borderline-Symptomatik?
Ja, unsere Welt wird immer globaler und hierdurch wird auch die Gefahr einer globalen Katastrophe immer realer.
Ich denke hier an
- die atomare Bedrohung,
- an immer häufiger zu beobachtende große Terroranschläge wie den 11. September 2001 in den USA, 2017 in Barcelona, 2018 in Straßburg, 2019 in Utrecht. Allein im Jahr 2020 zählte man 10.172 Terroranschläge weltweit (Quelle Statistika)
- Dann kommt durch die Umweltzerstörung das Szenario einer Klimakatastrophe immer näher
- Globale Epidemien gab es zwar schon immer – wir finden in Wikipedia den ersten Eintrag 3500 v.u.Z. mit der Pest – jedoch werden diese in der Neuzeit immer häufiger. 2002: SARS / 2004: Vogelgrippe (H5N1) / 2009: Schweinegrippe (H1N1) / 2012 MERS / 2014 Ebola / 2019: Covid 19.
All dies trägt entscheidend dazu bei, dass wir unseren Glauben an die Vergangenheit verlieren und immer mehr Angst vor der Zukunft haben. Und nicht umsonst sehen wir heute immer mehr Menschen, die von einem Weltuntergangsszenario sprechen – ein Beispiel hierfür ist hier u.a. die seit 2021 auftretende „Last Generation“. Immer mehr Studien unter Jugendlichen und Kindern berichten von einer sich verändernden Haltung. Sie sprechen von
- einem veränderten Gefahrenbewusstsein.
- Dass eine Zukunft ohne Hoffnung auch nicht zu überleben sei,
- und dass die eigenen Lebensziele nicht zu erreichen seien.
Eine traurige Folge dieser Einstellung (“ich kann meine Ziele sowieso nicht erreichen”) ist, dass Selbstmord immer wieder als eine Lösungsmöglichkeit herangezogen wird, um mit der Angst vor einer drohenden Gefahr irgendwie fertig zu werden.“
Eine andere, noch häufiger zu beobachtende Veränderung ist, dass durch die allgemeine Angst vor einer herannahenden Weltkatastrophe Kinder immer früher zu früh erwachsen werden – eine ungewollte Progression an sich erfahren.
Und genau dieses sehen wir auch durch die Bank weg bei vielen „Prä–Borderline-Kindern“!
Warum? Weil sie in ihrer frühesten Kindheit oft schon dazu gezwungen werden, in einer instabilen familiären Umgebung die Kontrolle über den Haushalt zu übernehmen, da die Eltern aufgrund ihrer eigenen emotionalen Instabilität, z.B. wegen Alkoholmissbrauch oder anderen psychischen Störungen ihrem Kind keine Kontrolle mehr bieten können.
Viele Eltern haben ja selber Angst! Angst vor und wegen der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und dem ewig schwebenden „Damokles-Schwert“ einer Klimakatastrophe und der immer mehr an Bedeutung gewinnenden KI im Alltag.
Dieser Modus einer Dauerkrise kommt in der Studie „Jugend in Deutschland“ sehr deutlich zum Vorschein. Die sogenannte „Generation Z“ (die zwischen 1995 und 2010 Geborenen) wird wegen der instabilen Zukunftsaussichten selbst immer unsicherer.
Das Sicherheitsgefühl – durch Corona bereits massiv angegriffen – ist jetzt noch stärker beschädigt. Die Studie zeigt auch, dass sich viele über einen Kontrollverlust über ihr Leben beklagen. Hatten sie vor Corona noch einigermaßen stabile Freundschaften, so haben diese unter der Isolation stark gelitten und damit war auch dieser wichtige Rückhalt für sie verloren.
Dies alles hat deutliche Folgen:
Die psychische Belastung ist dermaßen angestiegen, dass sich fast die Hälfte der über 1.000 Befragten unter Dauerstress und mehr als jeder Dritte unter dauerhafter Antriebslosigkeit sieht.
Alles Zahlen, die wir nicht von der Hand weisen können. Jedoch aber auch Symptome, die wir bei Borderline sehen. Ich denke hier an das Kriterium Nummer 7: Das chronische Gefühl der inneren Leere…
3.5. Der Gedanke an das Aufgeben wird „gesellschaftsfähig“. Was zählt ist das „hier und jetzt“
Ist das denn bereits Borderline? In Liedern wie „Given Up“ von Linking Park, „Fade to Black“ von Metallica oder „Tourniquet” von Evanescence sprechen die Songwriter immer wieder von der Hoffnung zu sterben, bevor sie alt werden.
Dieses Gefühl – „ich werde sowieso nicht alt, so what“ – geht immer mehr unter jungen Menschen umher. Vielleicht entsteht dadurch auch die Bereitschaft zu immer mehr Amokläufen und hat damit die Angst vor der Zukunft in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht.
Und genau hier kommt Borderline wieder ins Spiel… Borderline fixiert die Orientierung der Betroffenen wie ein Laser einzig und allein auf das „hier und jetzt“. Borderline hat praktisch kein Interesse mehr an vergangenen Dingen. Man leidet fast schon unter einer kulturellen oder auch persönlichen Amnesie.
Wer unter der Borderline-Symptomatik leidet, hat praktisch keinen Vorrat an angenehmen oder stützenden Erinnerungen, die einem auch in schwierigen Situationen etwas Halt geben könnten. Wer sich aber nicht an gute Situationen erinnern kann, der ist traurigerweise dazu gezwungen immer wieder von neuem zu agieren. Er handelt dann nicht mehr zielbewusst, er agiert nur noch. Er ist praktisch permanent am „Neulernen“ und muss die Situation wie in einem Hamsterrad immer und immer wieder wiederholen.
Ich erinnere mich an den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahre 1993 mit Bill Murray.
Schau dir aber auch mal das Video: „Warum passiert das immer nur mir?“ an. Es zeigt den Unterschied zwischen Handeln und agieren. https://werdewiederstark.de/landing-page/beziehungswissen/wiederholungszwang-und-borderline-warum-passiert-mir-das-immer-wieder/
3.6. Hat dies denn auch einen Einfluss auf die generationenübergreifende Eltern-Kind-Beziehung?
Auf alle Fälle! Wenn Eltern selber unter einer überbordenden flottierenden Zukunftsangst leiden, dann sind sie höchstwahrscheinlich viel zu sehr mit ihren eigenen Bedürfnissen beschäftigt (und das ist beileibe kein Vorwurf, sondern lediglich eine oft beobachtete Tatsache) sodass sie gar nicht mehr die Kraft dazu haben, sich ausreichend um die Bedürfnisse ihrer Kinder kümmern zu können.
Kinder „moderner Eltern“ die sich
- durch emotionale Distanziertheit und Entfremdung auszeichnen,
- andererseits ihre Kinder aber zu jedem Unterricht und jedem Kindergeburtstag fahren, sie verwöhnen und ihnen viel zu viel durchgehen lassen,
solche Eltern erziehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsere zukünftigen Borderline-Persönlichkeiten.
___________________
Kapitel 3: Die große Angst vor der Zukunft – Eine kurze Zusammenfassung
- Was Du aus diesem Kapitel mitnimmst: Dein praktischer Nutzen:
Jetzt verstehst Du bestimmt, warum diese lähmende Angst bei Borderlinern (und zunehmend in unserer gesamten Gesellschaft) so präsent ist. Du erkennst:
- Die Zahlen sind alarmierend: 59% der jungen Menschen haben massive Zukunftsängste – die “Last Generation” ist keine Phrase, sondern bittere Realität
- Der Verlust von Vergangenheit = Verlust von Zukunft: Wenn Traditionen wegbrechen, bleibt nur das “Hier und Jetzt” – und genau das ist Gift für Borderliner, die Stabilität durch Kontinuität brauchen
- “Carpe Diem” wirkt wie ein Fluch: Was zuerst noch wie Freiheit klingt, wird zur Falle. Denn ohne Wurzeln in der Vergangenheit gibt es keinen Halt für die Zukunft
Der wichtigste Aha-Moment: Die flottierende Angst des Borderliners ist keine Übertreibung oder Manipulation. Sie ist die logische Reaktion auf eine Welt, die ihm keine Sicherheit mehr bietet. Du verstehst jetzt: Kriterium Nr. 1 (Verlassenwerden), Nr. 6 (Stimmungsschwankungen), Nr. 7 (Leere) und Nr. 8 (Wut). Diese haben alle ihre Wurzel in einerexistenziellen Zukunftsangst.
Du erkennst auch: Es ist nicht nur der Borderliner – wir alle werden von dieser gesellschaftlichen Entwicklung erfasst. Die Pandemie, die Klimakrise, die wirtschaftliche Unsicherheit – sie und viele weitere Krisen verstärken diese Dynamik exponentiell.
- Warum Du auch das Kapitel 4 lesen solltest:
Weil du jetzt weißt, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht und warum Angst das dominierende Gefühl geworden ist. Aber wie zeigt sich das konkret im Alltag? Wo siehst Du diese Dynamik jeden Tag? In Kapitel 4 wird es etwas persönlicher und noch praktischer:
- Wie sehen chaotische Beziehungen aus? Du wirst verstehen, warum Deine Partnerschaft (oder die Deines Borderline-Partners) so instabil ist
- Das “überkreuzende Lebenspartner”-Phänomen: Warum Borderliner nie ohne Backup-Beziehung sind – und was das für Dich bedeutet
- Der masochistische Aspekt: Ist es wirklich so, dass “Liebe weh tun muss”? Und wenn ja – warum?
Du wirst die Mechanismen verstehen, die Kriterium Nr. 2 (intensive, aber instabile Beziehungen) antreiben. Und Du wirst erkennen, wie die gesellschaftliche Fragmentierung direkt in Dein Schlafzimmer, Deine Küche, Deine Beziehung eindringt.
Das wird unbequem. Du wirst Dich in manchen Beschreibungen wiedererkennen – vielleicht öfter, als Dir lieb ist. Aber genau deshalb ist es so wichtig: Nur wenn Du die Muster erkennst, kannst Du sie durchbrechen. Also: Atme durch. Und lies weiter. Deine Beziehung verdient es.
Kapitel 4 Borderline – Unsere Beziehungen werden immer chaotischer.
Das Wort Chaos kommt aus dem altgriechisch „cháos“ der weite Raum und hat Etymologisch seine Herkunft von dem griechischen Verb „chainein“ was klaffen oder dann klaffender Raum, gespaltener Raum bedeutet.
Chaos ist damit das Gegenteil von Kosmos, was den geordneten Raum darstellt.
Und da sind wir wieder bei unserem Thema Borderline – eine Spaltung in der Persönlichkeit…
2018 sagte der russische Präsident Putin einmal: „Die Welt wird immer chaotischer…“ Er bezog sich dabei vor allem auf die politischen Veränderungen, die sich global abzeichneten.
Aber nicht nur die Politik, auch unsere Gesellschaft und hier die kleinste Einheit „die zwischenmenschliche dyadische Beziehung“ unterliegt einem Wandel, der vor 100 Jahren noch kaum denkbar war.
In den vergangenen 100 Jahren, seit den Anfängen von Sigmund Freud, gab es unglaublich viele Veränderungen in unserer Gesellschaft. Mit die bekanntesten waren u.a. folgende:
- Die Hippie-Bewegung der 1960er Jahre: Sie war vor allem unter jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren weit verbreitet. Dies war eine Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg, die allgemeine Konsumkultur und die gesellschaftlichen Konventionen ihrer damaligen Zeit.
- Die Frauenbewegung der 1960er und 1970er Jahre: Sie kämpfte für die Rechte der Frauen, darunter die Forderung nach gleicher Bezahlung, gleicher Bildung und politischer Teilhabe.
- Die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den USA: Diese wichtige Bewegung erreichte in den 1950er und 1960er Jahren ihren Höhepunkt und kämpfte gegen rassistische Diskriminierung, für die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Afroamerikaner.
- Die grüne Bewegung: Sie kämpft für eine nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik und für den Schutz bedrohter Ökosysteme und Arten.
- Die homosexuelle Emanzipationsbewegung: Dies ist eine Bewegung gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Sie forderte die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen und gleichgeschlechtlicher Ehen. Ihr entspricht heutige wohl am ehesten die LGBTQ-Bewegung.
Den wohl größten Einfluss auf unser heutiges Leben hat meines Erachtens jedoch die veränderte Sichtweise in Bezug auf sexuelle Moral und Praktiken aber auch die Rollenbilder von Mann und Frau. Gab es bis zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts noch überwiegend die „viktorianische Sichtweise“ in Bezug auf Sexualität – diese zeichnete sich durch strenge gesellschaftliche Konventionen und Tabus aus – so endete dies spätestens mit den 1960er Jahren.
„Freie Liebe“ und „Wilde Ehe“, das waren die neuen Schlagworte für die kommenden Jahre.
Erst durch das verstärkte Aufkommen von sexuell übertragbaren Krankheiten wie zum Beispiel AIDS (HIV), Gonorrhö, Herpes, Hepatitis B und C kam es in den Jahren ab 1980 (AIDS wurde ab 1981 zum ersten Mal in den USA als eine neue Krankheit bei vormals gesunden, jungen homosexuellen Männern beschrieben) zu einer sexuellen Neuorientierung.
Die sexuelle Revolution war damit aber noch lange nicht vorbei! Es kam – wie gesagt – eher zu einem Umdenken. Heute gibt es eine deutlich größere Akzeptanz und Anerkennung von verschiedenen sexuellen Orientierungen und Identitäten, einschließlich Homosexualität und Transgender. Die wohl bekannteste Bewegung hierbei ist die bereits erwähnte LGBTQ Bewegung. Sie steht für “Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer”.
Die deutsche Übersetzung wäre in etwa “Lesbisch Schwul Bisexuell Transgender Queer”. Damit können sich Personen identifizieren, die sich nicht in den eingeschlechtlichen und heterosexuellen Normen einkategorisieren lassen möchten.
Eine weitere drastische Veränderung in unserem gesellschaftlichen Beziehungsaufbau ist das WIE und WODURCH Beziehungen heute zustande kommen.
Ich denke hier an die enorme Verbreitung von sowohl Dating- und Partnerwebsites, aber auch an all die verschiedenen Kommunikations-Plattformen der sozialen Medien, die das Knüpfen von persönlichen Kontakten so unglaublich leicht gemacht haben.
Bin ich früher noch auf ein Stadt- oder Dorffest oder in eine Kneipe gegangen um neue Kontakte zu knüpfen, so ist dies immer mehr „vergangenes Jahrtausend“ Jegliche Arten von Beziehungen – und da ist es egal ob es sich um einen harmlosen romantischen Flirt oder ein Sextreffen handelt – all diese können heute anonym, mit ein paar wenigen Mausklicks, einer Textnachricht oder einfach einem Wischen nach rechts oder links vom Handy aus begonnen werden.
Diese überall zur Verfügung stehenden Kontaktmöglichkeiten haben mit Sicherheit viele Vorteile… Aber allein die Möglichkeit zu haben, führt nicht immer und zwangsläufig zu moralisch guten Taten …
Es wird sich zeigen, ob die immer häufiger werdenden Kontakte aus der Online-Welt die zwischenmenschlichen Beziehungen in der Offline-Welt „stabilisieren“ oder alles in eine gefährlichere Instabilität abdriftet.
4.1. Die Stabilität der Partnerschaften steht auf wackeligem Boden
Kann man hier denn schon von einem Chaos – also von einer Unordnung – sprechen? Das Wort Chaos kommt – wie im vorigen Kapitel beschrieben – aus dem altgriechischen Wort „Chásma“ und beschreibt ursprünglich eine Kluft oder einen Spalt. Können wir eine Spaltung in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen beobachten?
Dadurch, dass immer mehr sich widersprechende Kräfte sowohl aus der Offline- aber auch aus der Online-Welt auf Partnerschaften einwirken wie zum Beispiel
- Veränderte Erwartungen (die Suche nach Unabhängigkeit selbst innerhalb der Partnerschaft)
- Stress (Arbeit, Finanzen, Patchwork- und Eineltern-Familie
- Technologie (Dating-Apps)
- Kultur (z.B. Speed-Dating)
wird es für den Einzelnen immer schwieriger, eine dauerhafte Freundschaft, eine romantische Liebesbeziehung oder eine lebenslange Ehe aufzubauen und zu pflegen.
Laut dem statistischen Bundesamt werden Ehen, die vor weniger als 5 Jahren geschlossen wurden, deutlich häufiger geschieden als die davor geschlossenen.
Zum Vergleich: In den 1920er und 1930er Jahren lag die Scheidungsrate in Deutschland bei ca. 1-2% der Ehen.
In den 1970er und 1980er Jahren stieg sie dann massiv an und erreichte einen Höhepunkt bei etwa 50%. Seit den 1990er Jahren hat sie sich dann auf dem Niveau von etwa 40 bis 45% eingependelt. Wobei man aber auch beachten muss, dass immer weniger Paare heiraten und damit die Vergleichbarkeit immer weniger gegeben ist.
Warum aber scheitern so viele Partnerschaften – besonders beim Borderliner? Diese Frage wird immer wieder an mich herangetragen. Was ist meine Beobachtung? Am Anfang ist die Beziehung häufig noch intensiv und voller Liebe: Wir wollen (!) den anderen nur positiv sehen.
Es ist jedoch nicht der Alltag, durch den Beziehungen scheitern. Auch nicht Langeweile oder die tägliche immer gleiche Routine. Es sind nicht die kleinen Streitigkeiten.
Partnerschaften scheitern erst, wenn es zersetzende Machtprozesse gibt, in denen man den anderen regelrecht aktiv bekämpft.
Diese Machtkämpfe / dieses sich aneinander reiben ist jedoch bereits von Anfang an da. Dies ist in jeder Beziehung so. Wir bekommen das anfänglich nicht mit! Denn da stehen wir noch zu sehr unter dem Einfluss von Glückshormonen wie dem Phenylethylamin.
Irgendwann kommt dann aber der Moment, an dem die Machtprozesse der Kontrolle entgleiten. Das passiert meist an einem kritischen Punkt, wenn der berühmte Tropfen das Fass überlaufen lässt. Wenn es dann noch ein weiteres Problem gibt – etwa mit den Kindern, plötzlichen Krankheiten, einer Arbeitslosigkeit, pflegebedürftigen Eltern – bringt dies das vorher schon belastete Beziehungssystem endgültig zum Kippen.
Dann muss die Spannungsenergie irgendwie abgebaut werden und oft wird dann das nächstgelegene Ziel genommen: der Partner. Die Machtkonflikte radikalisieren sich dann in der Beziehung, indem plötzlich Entwertungen und Respektlosigkeit Einzug halten. Das ist der Punkt, an dem die Beziehung wirklich zerstört wird.
Ein Autor fasste all das einmal wie folgt sehr gut zusammen: „Da unser allgemeines soziales Leben immer kriegerischer und barbarischer wird, bleiben die persönlichen Beziehungen hiervon logischerweise nicht unberührt. Heutige Partnerschaften – die eigentlich für Frieden, einen sicheren Hafen vor all diesen Unwägbarkeiten der Gesellschaft stehen müssten – entwickeln sich dadurch immer mehr in zwischenmenschliche Kampfarenen.
Traurigerweise – fast schon mit einem Schuss Ironie betrachtet – sind Menschen mit einer Borderline–Persönlichkeit für diese Art Beziehungskampf deutlich besser ausgerüstet als andere. Warum ist dem so? Weil ihr Leben von frühester Jugend an von einem Überlebenskampf geprägt war. Sie sind im „Beziehungskampf” einfach geübter – fast schon „zu Hause“. In ihrem gespaltenen, widersprüchlichen Bedürfnis nach Kontrolle und Bestrafung (Liebe muss ja schließlich weh tun …) verbindet sich ein Borderliner dann häufig mit einem Komplementärpartner – einem ihn beherrschenden Narzissten der es liebt, zu kontrollieren und idealisiert zu werden.
4.2. Borderline – Ist das etwa ein Hang zum Masochismus?
Masochismus wird als eine Form der Sexualität beschrieben, in welcher jemand seine volle Befriedigung erst durch Demütigung, Schmerz oder Qual erfährt. Können wir dies auch mit Borderline in Verbindung bringen? Lass uns mal schauen.
Oft können wir beobachten, dass Frauen mit einer Borderline-Diagnose schon sehr früh in jungen Jahren ihr Elternhaus verlassen, um sich dann an einen Partner zu binden – einfach nur, um vor dem Chaos des häuslichen Familienlebens zu flüchten.
Dabei klammern sie sich auffallend häufig an einen kontrollsüchtigen Partner mit einer Komplementär-Störung. Mit ihm gehen sie dann eine Beziehung ein, welche die toxische Umgebung des eigenen Elternhauses aufs Neue zum Leben erweckt. „Denn schließlich muss das, was sie von klein auf erfahren haben, doch irgendwie seine Richtigkeit gehabt haben.“ Und wegen dieser falschen Richtigkeit wiederholen sie diese toxischen Beziehungen in ihrem eigenen Leben.
Solch eine Komplementär-Partnerschaft zeichnet sich durch ein sado masochistisches Verhalten zueinander aus.
Sagt der eine „noch ein Wort und ich schlage dich!“ antwortet der andere „Danke, das kann ich gut gebrauchen.” Dieses Beziehungs-Chaos ist öfter zu sehen als es einem vielleicht bewusst ist.
Ein kleiner Disclaimer am Rande:
Auch wenn ich hier vorwiegend von einer masochistischen Borderline-Frau und einem sadistischen Narzissten-Mann spreche, so kommt es doch vor, dass diese Rollen auch umgekehrt auftreten können. Dies geschieht jedoch sehr viel seltener. Nach der „Gaußschen Verteilungskurve“ tendiert die Frau eher zum Masochismus und der Mann zum Sadismus. Wohlgemerkt: tendiert!
Masochismus ist im Zusammenhang mit Borderline jedoch so deutlich präsent, dass wir es nicht einfach von der Hand wischen können.
Immer wieder wird sichtbar, dass in Beziehungen mit einem Borderliner Schmerz und Abhängigkeit ein wichtiges Thema ist. Frei nach dem Motto: „Liebe muss weh tun”, wie es Marianne Rosenberg schon gesungen hat.
Aber warum ist das so? Warum kippt die Borderline-Persönlichkeit in einer Beziehung immer wieder auf diese masochistische Seite? Die Antwort liegt in ihrer Kindheit – da, wo Borderline entsteht.
Wer mit einer Borderline-Diagnose lebt, hat in seiner frühesten Jugend oft ein Übermaß an Schmerz und Verwirrung erfahren, wenn er oder sie versuchte, eine Beziehung zur Mutter aufzubauen.
Ein kleiner Einschub: Ich spreche hier ganz bewusst von einem seelischen Missbrauch und komme später auf die wichtige Zeit im Alter von 12 bis 36 Monaten zurück. Für den Moment möchte ich nur zeigen, dass diese Zeit, wo das Kind lernt, seine eigenen Wege zu erkennen und die Art und Weise wie die Mutter das ambivalente Weggehen und Zurückkommen begleitet, entscheidend dafür ist ob sich eine Borderline-Persönlichkeit ausbildet oder nicht.
Im weiteren Verlauf des Lebens, nachdem das Kind dann auf eigenen Füßen steht, greifen dann andere Personen bzw. Partner wie zum Beispiel der Ehepartner, Freund, Lehrer, Arbeitgeber in diese Beziehungswunde.
Die andauernde Kritik, Missachtung, Misshandlung – vielleicht auch ein weiterer Missbrauch – all das bestärkt den Betroffenen, in dem Gedanken als Mensch völlig wertlos zu sein. Die ständige Kritik der Eltern hört einfach nicht auf und wird wie zu einem Lebensmotto – einem Titel in einem völlig absurden Theaterstück.
Borderline – das sollte hier erwähnt werden – hat jedoch nicht zu 100% und nicht immer zwangsläufig die Neigung zum Masochismus. Hin und wieder kippt es auch in eine Form des Sadismus um.
Ich durfte eine Zeitlang einen Geschäftsmann begleiten, der ein Kind mit einer Frau hatte, die aus dem Prostitutionsmilieu kam. In den Sitzungen war sie zuerst das masochistische Opfer, das sich aber im Laufe der Beziehung innerhalb weniger Wochen und Monate in eine immer sadistischer werdende Person verwandelte. Frei nach dem Motto: „Ich provoziere dich so lange, bis Du mich schlägst. Dann kann die ganze Welt endlich sehen, was für ein schlechter Mann Du bist und wie sehr ich unter Dir leide.“
Wer hier gerade Opfer und wer Täter war, das war häufig nicht so leicht zu unterscheiden …
4.3. Intensive und instabile Beziehungen
Eigentlich könnte man doch annehmen, dass – wenn jemand in einer Beziehung immer und immer wieder erniedrigt, geschlagen oder anderweitig denunziert wird – dass so jemand dem „Partner“ schnell den Rücken kehrt und ein neues Leben weit weg von ihm führen möchte – doch weit gefehlt. Denn wenn auch eine solche Beziehung offensichtlich ins krankhafte / pathologische abgleitet, so kommt der Borderline–Partner in der Regel immer wieder zurück, um die Bestrafung weiter über sich ergehen zu lassen. Kriterium Nr. 1.
Warum aber tut er dies?
Nun, hier spielt ihm und auch uns allen unser Gehirn offensichtlich immer wieder denselben Streich. Ich möchte dieses mal mit dem 2. Gesetz / dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik erklären. Platt ausgedrückt lautet dieser: Ein kalter Gegenstand kann einen wärmeren nicht wärmer machen.
Auf das Lernen unseres Gehirns könnten wir dies nun folgendermaßen übertragen:
Hat unser Gehirn für ein Problem erst einmal eine Lösung erarbeitet, dann weicht es hiervon nur sehr ungern und gegen viele Widerstände / Abwehrmechanismen ab. Das geschieht auch dann, wenn die Lösung jedem – auch dem Betroffenen – völlig widersinnig erscheint!
Nehmen wir das Beispiel, dass ein kleines Mädchen – sagen wir mal, dass es zwei Jahre alt ist – seine Eltern streiten sieht. Sie reagiert hier zum Beispiel indem es vor Furcht „einfriert“.
In diesem „Freeze-Zustand“ „überlebt“ sie in den späteren Jahren dann so manchen Streit in ihrer Umgebung. Ihr Gehirn hat also eine Lösung für diese angstauslösenden Situationen gefunden und möchte nun ein Leben lang bei diesem Lösungsweg bleiben – auch wenn es im späteren Erwachsenenalter ganz anders darüber denkt …
Auf den Borderliner übertragen sähe unser Vergleich nun so aus:
Das Kind sieht seine Eltern von frühester Kindheit an immer wieder böse streiten und erlebt vielleicht noch Schlimmeres. Wichtig hierbei ist: es kennt diese Situation nicht anders!
Und auch wenn ihm das alles viel Angst bereitet hat, so war dies seine „alte Sicherheit“, weil es immerhin eine ihm bekannte Situation war. Die Betonung liegt hier auf dem Begriff „es war ihm bekannt und gab ihm dadurch Sicherheit“.
Befindet er sich nun in einer ähnlich aggressiven Bindung / Partnerschaft, so flieht sein „gesunder Anteil“ aus der Beziehung. Der „kranke bzw. Borderline-Anteil“ kommt aber immer wieder zurück, da ihm diese aggressive Stimmung aus der Kindheit bekannt ist und ihm ein gewisses Maß an Sicherheit gibt – auch wenn diese Sicherheit vollkommen widersinnig und unlogisch ist.
Die Bestrafung, das Schreien und eventuell auch die körperliche Misshandlung sind ihm ja bekannt. Und weil dies alles bekannt ist, bewirkt dies bei ihm ein angenehmes Gefühl. Wir alle wissen, dass angenehme Gefühle sich viel leichter hantieren lassen als so etwas Unangenehmes wie Einsamkeit oder das Leben mit einem anderen, vielleicht noch unbekannten Partner.
Wie geht der Borderliner mit seiner Angst vor einer Einsamkeit um?
Wir beobachten bei den heute immer öfter vorkommenden emotional instabilen Beziehungen ein neues Handlungsmuster – und zwar, dass des sich „überkreuzenden Lebenspartners“. Die alte Beziehung ist zwar noch aktiv, die neue jedoch bereits im Aufbau. Man wechselt von dem einen „warmen Bett in das andere“. Es ist der Wunsch danach, eine neue Beziehung einzugehen, bevor die Aktuelle beendet wird.
Das erinnert einen doch an die Kriterien Nummer 1 und 2 der Borderline-Persönlichkeitsstörung:
- „Ein verzweifeltes Bemühen, das Alleinsein zu verhindern“ und
- „Intensive / instabile zwischenmenschliche Beziehungen“
Es ist ähnlich wie beim Klettern im Berg. Auch da wird der eine Haltegriff erst dann losgelassen, wenn man den Nächsten fest in der Hand hat.
Genauso verlässt der Borderliner den aktuellen Partner erst dann, wenn ein neuer „Retter“ zumindest in Sicht- oder Reichweite ist.
4.4. Werden nur die Beziehungen oder werden die heutigen Zeiten insgesamt immer chaotischer?
Schauen wir mal ein wenig in die Vergangenheit zurück – bis zu den Ausläufern der viktorianischen Epoche von 1837 bis 1901… Durch die beiden Weltkriege unterbrochen, „flackerten“ ihre Moralvorstellungen kurz noch einmal in den Nachkriegsjahren bis etwa 1960 auf.
Ihnen folgten dann die 60er und die 70er Jahre mit der Studentenbewegung und der sexuellen Revolution. Die Pille ermöglichte damals auf einmal Sex ohne die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft. Alles – inklusive der Sexualität – war auf einmal weniger stark strukturiert. Alles schien auf einmal völlig neuen Regeln, Normen und Freiheiten zu unterliegen.
Solche normenlosen Beziehungen, wie sie hierdurch nun Gang und Gäbe wurden, sind für die Borderline–Persönlichkeit jedoch viel viel schwieriger zu Händeln.
Auch wenn es sich nun sonderbar für dich anhört, aber eine größere Freiheit und eine fehlende Struktur sind für den Borderliner wie eine Strafanstalt. Warum? Weil sie durch ihre Emotionale Instabilität (F60.30) stark auf das Wertesystem von außen angewiesen sind. Sie sind klar im Nachteil, wenn es darum geht, sich für ihr eigenes Leben ein Wertesystem mit Transzendentien zu schaffen. Für Ihre Werte, ihre Leitlinien und Visionen orientieren sie sich fast ausschließlich an Ihrer Umgebung. Wenn dann die Umgebung oder die Gesellschaft nun mit Einschränkungen kommt, die normalerweise viele von uns einengen und belasten würden, so sind diese ironischerweise für den Borderliner sogar therapeutisch wirksam. Als zum Beispiel Ende der 1980er Jahre wegen immer häufiger vorkommender sexuell übertragbarer Krankheiten (STI – Sexually Transmitted Infections) wie zum Beispiel AIDS ein Umdenken und ein sexueller Rückzug in der Gesellschaft aufkam war dies ironischerweise für die Borderline–Persönlichkeit wie eine therapeutische Stütze. Diese Ängste vor einer tödlichen Infektion zwangen einen, deutlich strengere Grenzen einzuhalten als vorher.
Das Kriterium Nummer 4 bei der Borderline-Diagnose lautet: „Mindestens 2 potentiell selbstschädigende Handlungen und starke Impulsivität.“ Die sexuelle Impulsivität bis hin zur Promiskuität haben durch die immer häufiger aufkommenden Geschlechtskrankheiten dramatische gesundheitliche Konsequenzen bekommen – sogar lebensbedrohliche. Sich davon nun zu distanzieren entspricht einer äußeren Struktur und kann einem dabei helfen, sich vor seiner Selbstschädigung zu schützen.
Ganz nebenbei gesagt: Sich von ihnen fernzuhalten ist auch wirklich dringlicher denn je. Denn täglich (!) stecken sich laut der WHO (der Weltgesundheitsorganisation) ungefähr 1 Millionen Menschen mit einer STI – Geschlechtskrankheit an (Stand 2023).
Die Zahlen sind einfach zu groß um darüber hinweg zu sehen:
- 2016 steckten sich 127 Millionen Menschen mit Chlamydien an
- Circa 250 Millionen mit Trichomonaden, Gonorrhö (Tripper) oder Syphilis im Jahr 2016
- Weltweit sind ca. 500 Millionen Menschen mit dem Herpes-Genitalis Virus infiziert und
- Über 300 Millionen Frauen haben eine HPV-Infektion (Humane Papillomviren)
Der Borderliner profitiert hierbei wirklich von den sich daraus ergebenden Einschränkungen – weil er in seiner Strukturbildung auf Hilfe von außen angewiesen ist.
Werden unsere Beziehungen also immer chaotischer?
Die einzelne Beziehung / vielleicht auch Deine mag ja noch von Bestand sein. Unsere Gesellschaft verändert sich jedoch in einer Geschwindigkeit, die einen fast schon schwindelig macht. Borderline ist meines Erachtens die logische Folgerung hieraus.
Waren wir im ersten Schritt noch eine perfektionistische Gesellschaft – immer auf Hochglanzbilder in den sozialen Medien bedacht – so führte dieses Streben nach einer Perfektion, um von anderen als gut beurteilt zu werden, zu einer Epidemie der „Emotionalen Unsicherheit.”
Die pathologische Steigerung von einer „Emotionalen Unsicherheit“ ist nach dem ICD 10 F60.30 die „Emotionale Instabilität“. Wie diese voneinander zu differenzieren ist, das zeige ich in einem späteren Kapitel.
______________________
Zusammenfassung Kapitel 4: Unsere Beziehungen werden immer chaotischer
Dieses Kapitel hat uns gezeigt, warum moderne Beziehungen so instabil geworden sind und wie genau das mit Borderline zusammenhängt. Wir konnten verstehen, dass die gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahrzehnte – von der sexuellen Revolution über Dating-Apps bis zur Auflösung traditioneller Strukturen – besonders für Menschen mit Borderline eine enorme Herausforderung darstellen.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir nun erkennen:
- Diese typischen Beziehungsmuster bei Borderline sind keine persönlichen Schwächen, sondern haben einen gesellschaftlichen Kontext.
- Wir verstehen nun, warum Borderliner in toxischen Beziehungen bleiben (das Bekannte gibt Sicherheit), warum sie niemals allein sein wollen (der Wechsel vom einen ins andere warme Bett) und warum äußere Strukturen – so paradox das klingt – therapeutisch wirken können.
Diese Einsichten helfen uns, unsere eigenen Beziehungsmuster oder die unserer Umgebung nicht mehr nur als Problem zu sehen, sondern als logische Reaktion auf eine immer chaotischer werdende Welt.
Ausblick auf Kapitel 5: Wann ist ein Mann noch ein Mann?
Im nächsten Kapitel wird es noch konkreter. Während Kapitel 4 den allgemeinen gesellschaftlichen Rahmen beschrieben hat, tauchen wir jetzt tief in die Geschlechterrollen ein.
Wir erfahren, warum besonders Frauen dreimal häufiger von Borderline betroffen sind als Männer und welche Rolle die widersprüchlichen Erwartungen an moderne Frauen dabei spielen. Das Kapitel zeigt, wie der Spagat zwischen Karriere, Familie und Perfektion direkt in die emotionale Instabilität führen kann. Außerdem werden wir verstehen, wie die neuen sexuellen Orientierungen und die Gender-Debatte zur Identitätsverwirrung beitragen – ein Kernkriterium der Borderline-Diagnosen. Dieses Wissen ist essentiell für das tägliche Leben. Denn nur wer die Ursachen versteht, kann auch wirksam behandeln.
Kapitel 5: Borderline – Wann ist ein Mann noch ein Mann? Die Änderung der Geschlechterrollen.
„Ach … was war die Welt früher doch noch so einfach… Alles war irgendwie überschaubar und simpel.” Kennst Du diesen Satz 😊? Vielleicht hast du ihn sogar schon selber des Öfteren gesagt?
Und ja, vieles war auch einfacher, oder besser gesagt übersichtlicher:
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch deutlich weniger soziale Rollen als heute und die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau war klarer festgelegt. Aber wie sah das „damals“ eigentlich aus?
Nun, die Mutter kümmerte sich um die familiären Innenaktivitäten – sie war der reproduktive Teil des Paares – und sie kümmerte sich hauptverantwortlich um die Kindererziehung.
Alle Themen, die mit dem Außen irgendwie in Verbindung standen – wie zum Beispiel Schule, Hobbys und Gemeindetätigkeiten – entstanden dann auf ganz natürlichem Wege aus dieser Rolle der Mutter heraus.
Und was war beim Vater so üblich? Bei ihm war es ebenfalls klar geregelt: Er kümmerte sich um die Außenaktivitäten – war eher der produktive, neu erschaffende Part der Familie. Seine Rollenmuster von Beruf und Gemeindeaufgaben waren eigentlich perfekt mit denen seiner Frau kombinierbar.
5.1. Die neue Rolle von Frau und Mann – Wie sieht sie aus, diese neue Rolle der Frau – und was hat dies mit Borderline zu tun?
Heutzutage ist es eher nicht mehr so. Wir unterscheiden immer häufiger zwischen einer traditionellen und einer egalitären Sichtweise dieser Rollenmuster. Die traditionelle Rollenverteilung haben wir eben schon angesprochen – die Aufteilung zwischen dem Außen und dem Innen.
Bei dem egalitären Geschlechterrollenverständnis spielen die Aufgaben, die dem Mann oder der Frau in ihrer Partnerschaft zufallen – zuerst einmal eine untergeordnete Rolle. Diese Anforderungen werden eher gleichberechtigt zwischen den Beiden aufgeteilt. So etwas wie eine geschlechtsspezifische Zuordnung – analog der traditionellen Vorgehensweise – findet hier nicht statt.
Beide Partner sind wirtschaftlich eher unabhängig voneinander und es wird auch gefordert, dass – wenn die Frau berufstätig ist – sich hieraus für die Kinder keine Nachteile ergeben. Das ist das, was wir als ein emanzipiertes Rollenbild der Frau beschreiben könnten.
In der Theorie / auf dem Blatt Papier liest sich das alles recht simpel und dürfte nicht zu einer Verstärkung der Borderline-Gesellschaft beitragen …
Wie sieht die Umsetzung jedoch in der Praxis aus? Können wir eine Egalität (dieser Begriff kommt ursprünglich aus dem lateinischen Wortschatz. „Aequalis“ und bedeutet „eben / gleich“) in unserer komplexen, modernen Gesellschaft überhaupt leben? Nun, Fakt ist, dass wir heute von einer größeren Zahl an sozialen Rollen konfrontiert werden, von denen viele gar nicht ganz so einfach miteinander harmonieren.
Eine berufstätige Mutter zum Beispiel hat mindestens zwei klar voneinander abgegrenzte Rollen, die nicht so leicht zu handhaben sind. Um beiden Rollen dann doch irgendwie gerecht zu werden, muss sie sich abgrenzen / praktisch „aufspalten“. Arbeitsplatz und Haushalt sind nämlich in den seltensten Fällen am räumlich selben Platz. Und der Arbeitgeber verlangt ja auch zu Recht für seinen gezahlten Arbeitslohn eine ihm erbrachte eingeforderte Arbeitsleistung.
Die Folge davon ist, dass sehr viele Mütter immer wieder mit Schuldgefühlen konfrontiert werden, wenn Probleme aus dem privaten Bereich (zum Beispiel, wenn ein Kind krank wird) Auswirkungen auf ihren Beruf haben. Und solche Schuldgefühle finden wir sehr häufig bei einer Borderline-Diagnose.
5.2. Wie sieht die neue Rolle des berufstätigen Mannes aus?
Auch für den berufstätigen Mann und Familienvater haben sich die Rollen im Hinblick auf den Beruf und das Zuhause geändert. Sie sind deutlich getrennter als noch vor einem Jahrhundert. Damals waren die Männer mit Ihrer Arbeit mehr am eigenen Hof, dem eigenen örtlichen Lebensmittelladen oder einem Handwerksbetrieb vor Ort verbunden. Wo gelebt wurde, da wurde auch gearbeitet und umgekehrt. Das war einfach und übersichtlich.
Heute sieht dies jedoch komplett anders aus… Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit pendelt jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland und benötigt mindestens (!) 30 Minuten oder mehr für den einfachen Weg zur Arbeit. Das sind also täglich mindestens 1 Stunde Lebenszeit für sich selbst und die Familie weniger.
Und anstatt dass sich dies verringert, steigt diese Zahl ständig an. In den vergangenen zwei Jahrzehnten seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der Fernpendler (>150 km für den einfachen Arbeitsweg) um 30% erhöht. Das alles ist Zeit, die einem für das Familien- oder Privatleben fehlen.
Zusätzlich wird von einem modernen, egalitären Vater noch mehr erwartet, wie zum Beispiel, dass er sich stärker und aktiver an den Aufgaben in der Familie beteiligt. Das dies dann zu weiteren Konflikten führt, liegt auf der Hand: Weniger Zeit und mehr Aufgaben sind schließlich selten eine gute Strategie.
5.3. Überforderung begünstigt Borderline – bei der Frau und auch beim Mann
In den letzten hundert Jahren gab es bei der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau sehr starke Veränderungen – ich denke, dass wir uns bis hierhin einig sind. Diese Veränderungen haben einen nicht zu übersehenden Zusammenhang dazu, dass besonders bei Frauen immer mehr eine Borderline–Persönlichkeitsstörung zu beobachten ist.
Solch einen Gedankengang möchte ich jetzt aber ausdrücklich nicht als Dogma / Behauptung im Raum stehen lassen, sondern im Folgenden auch gerne erklären. In der Vergangenheit war die Rolle einer Frau – grob zusammengefasst – dass sie nach ihrer Heirat die Kinder zur Welt bringt und diese auch erzieht. Sie war die „Chefin des Haushaltes“ und sah hierin ihre Lebens-Karriere. Dies wurde von der Gesellschaft zum einen so erwartet, aber sie bekam hierfür dann auch eine gebührende Anerkennung. Zuhause gab es einen klaren Chef – die Frau.
Wie viel komplizierter ist es doch heute…
Eine junge Frau steht vor einer immer größeren Zahl von Rollenmodellen und Erwartungen an sie.
- Da gibt es die alleinstehende Karrierefrau.
- Die verheiratete Karrierefrau.
- Dann die immer noch traditionell erziehende Mutter.
- Und neuerdings tritt noch die „Super-Mutti“ auf die gesellschaftliche Bühne, die alles irgendwie unter einen Hut zu bringen scheint: Karriere, Mann, Haushalt und Kinder.
Diese Anforderungen können selbst das stabilste Gemüt aus dem Takt bringen, sodass immer mehr Frauen unter dieser größer werdenden Last zusammenbrechen. Dieser Zusammenbruch kann sich dann auf verschiedene Weise zeigen:
- in einem Burn-Out
- einer Depression
- aber auch in einer Persönlichkeitsstörung.
Und wenn wir mal genauer hinsehen, dann können wir genau dies heute immer deutlicher erkennen:
Immer mehr Frauen pendeln vom Perfektionismus hin zur „Emotionalen Unsicherheit (“Warum schaffen es alle anderen und nur ich nicht?“ und anschließend von der „Emotionalen Unsicherheit´“ zur „Emotionalen Instabilität“ die – aufgrund ihrer Pathologie – dann im ICD als Persönlichkeitsstörung (F60.30) aufgeführt wird.
5.4. Die Überforderung des Mannes
Nicht nur die Frauen müssen sich heute mit den neuen Rollenbildern auseinandersetzen … Auch die Männer haben so ihr eigenes Päckchen an Veränderungen zu tragen. Bei Ihnen sind die neuen Verantwortungen jedoch bei Weitem nicht so stark und auch nicht so widersprüchlich ausgeprägt wie bei den Frauen.
Früher wurde ein Vater, der sich Urlaub nahm, um seinen Kindern beim Fußballtraining zuzuschauen, noch als jemand betrachtet, der sich davor drückt, für seine Familie zu sorgen. Ja, er wurde dafür regelrecht kritisiert. Und heute? Heute wird von den Vätern genau das Gegenteil erwartet!
Anstatt Kritik für das Stehen am Fußballfeld sollen sie sogar einen deutlich größeren Anteil an der Kindererziehung, den Freizeitaktivitäten und dem Haushalt haben als früher.
Aber seien wir hierbei mal realistisch. Im Vergleich zu den veränderten Rollenbildern der Frau passen diese neuen Rollenbilder immer noch deutlich besser zu der Rolle eines „Familien-Versorgers“ der alten Zeit. Denn so stark sind die Veränderungen ja auch nicht. Und trotz der relativ geringen Veränderung, findet man heute immer noch recht selten einen Mann, der seine Karriere aufgibt, um als „Hausmann“ daheim zwischen Kindern, Spül und Wäsche Karriere zu machen. Üblicherweise wird dies in unserer Gesellschaft auch immer noch nicht von ihm, sondern eher von der Frau erwartet.
5.5. Wer trägt die Hauptlast bei den sich verändernden Rollenbildern?
Bereits jetzt können wir schon mal die Behauptung in den Raum stellen, dass sich die Männer in den Beziehungen deutlich weniger anpassen mussten als die Frauen.
- Beispiel Wechsel der Arbeit – hat der Mann eine neue Arbeitsstelle – dann ist es nämlich immer noch üblich, dass die Familie umzieht – er ist ja schließlich der Hauptverdiener.
- Beispiel Schwangerschaft, Geburt oder Kindererziehung. Dies ist die Domäne der Frau. Denn auch in der Erziehung spielt ein Mann nach wie vor die 2. Rolle.
Kommt es jedoch zu einer Trennung, dann treten traurigerweise die Väter wieder in den Mittelpunkt. Dann auf einmal wollen viele Väter doch noch ein Mitspracherecht in der Kinderbetreuung und Kindererziehung, was dann jedoch in langen „Trennungsschlachten” von den Müttern vor Gerichten in Frage gestellt wird.
Diese vielen Veränderungen in den Rollenbildern zwischen Mann und Frau haben Sieger und Verlierer hinterlassen. Und obwohl die Frauen durch die Feminismusbewegung viele Ihrer sozialen und beruflichen Ziele erreicht haben, mussten Sie dafür einen höheren Preis als die Männer zahlen. Sogenannte „traditionelle“ Erwartungen erzeugen einen enorm hohen Druck.
Ein Mann muss sich in der Regel nicht zwischen Karriere, Familie und Kindern entscheiden. Solche Entscheidungen sind eine große Belastung! Sie erzeugen großen Druck in Bezug auf die eigenen Lebensziele, ihre Identität und Wünsche.
Darum ist es bestimmt auch gut nachvollziehbar, dass Frauen gegenüber der Borderline–Persönlichkeitsstörung deutlich anfälliger sind.
5.6. Wo gibt es heute noch Sicherheit?
Viele Menschen heiraten, weil ihnen diese traditionelle Aussicht auf eine sichere und stabile Beziehung bis zum Lebensende immer noch sehr gut gefällt.
Das Konzept einer lebenslangen Ehe hat sich jedoch stark verändert – und damit wurde viel Verwirrung in der Gesellschaft eingeführt. Die traditionelle Ehe zwischen einem Mann und einer Frau – so wie wir sie von der westlichen Kultur her kennen – wurde während der letzten Jahrzehnte stark in Frage gestellt. Die Zahl der Eheschließungen sank in Deutschland 2021 auf einen historischen Tiefstand.
Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben 2021 nur noch rund 350.000 Paare geheiratet. Das waren 4,2 % weniger Ehen als noch im ersten Corona-Jahr 2020. Und in diesem Jahr lag die Zahl bereits um 10,3 % unter dem Vorjahr. Weniger Eheschließungen gab es auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik lediglich während des Ersten Weltkriegs von 1915 bis 1918.
Jedoch gehen nicht nur die Eheschließungen zurück. Auch das Verständnis, was eine Ehe ausmacht, steht in einem neuen Bild. Die Ehe war über Jahrhunderte in der Tradition ein heterosexuelles Bündnis zwischen einem Mann und einer Frau.
Das Wort hetero kommt aus dem altgriechischen und bedeutet „anders, verschieden“.
Was ist nun neu? Was hat sich an diesem Bild der Ehe verändert?
Gab es bis 2007 in Deutschland noch 10.000 eingetragene Lebensgemeinschaften, so waren es nur 10 Jahre später (2017) bereits 30.000.
In den Jahren 2012 und 2022 wurden in den USA über 12.000 Menschen durch das Gallup Institut befragt, ob sie sich mit LGBT (Lesbisch, Gay, Bisexuell, Transsexuell) identifizieren oder nicht. 2022 gaben 7,1% der Befragten an, LGBT zu sein. Das sind doppelt so viele wie 10 Jahre zuvor. Von den Befragten machten die 18 bis 25 Jährigen den höchsten Wert mit knapp 21 Prozent aus.
Im Jahr 2017 waren es in der gleichen Umfrage noch 7 %.
In der nächsten Altersgruppe – bei denjenigen zwischen 26 und 41 Jahren bekannten sich 10,5 % zu einer LGBT-Identität.
Seit dem 01.11.2000 gab es in Deutschland dann die rechtliche Anerkennung der eingetragenen Lebensgemeinschaften und seit dem 01.10.2017 dürfen gleichgeschlechtliche Ehen durch das Eheöffnungsgesetz auch standesamtlich geschlossen werden.
Diese gewonnene Freiheit müsste doch eigentlich zu mehr Ruhe und Frieden in den neuen Geschlechterrollen geführt haben, oder? Leider ist jedoch eher das Gegenteil hiervon eingetreten, denn diese Anerkennung und Legalisierung hat die öffentliche Debatte eher angeheizt und nicht entschärft.
Homosexualität und die gleichgeschlechtliche Ehe haben sich bei der beobachteten gesellschaftlichen Polarisierung des Landes zu immer zentraleren Themen entwickelt. In Deutschland zum Beispiel ist die politische Partei der AFD strikt dagegen. Ihre Klage befindet sich seit Oktober 2018 im Bundestag. Und sie ist hier keine diskutierende Randgruppe mehr. Die AFD erhielt 2017 und 2021 jeweils über 10% der Wählerstimmen und ihre Themen durchziehen immer mehr die Meinungsbildung der Gesellschaft. Der aktuelle Stand im Jahr 2025 liegt bei 20,6% der Erststimmen in der Bundestagswahl.
Durch all diese neuen Freiheiten ist leider keine Ruhe in unserer Gesellschaft eingetreten. Und wo keine Ruhe ist, da sind für Borderline alle Tore offen.
5.7. Borderline und die neue sexuelle Orientierung
Borderline wird im Katalog der Krankheiten – dem ICD 10 – in der Gruppe der „Emotionalen Instabilität“ F60.30 eingeordnet. Da diese Störung sehr eng mit einer Instabilität in Verbindung steht, müsste das Gegenteil von Borderline ja Stabilität sein. Und genau das sehen wir auch in der Praxis.
Überall wo es Stabilität, Beständigkeit, Stärke und Ruhe gibt, ist Borderline eher selten und im Hintergrund.
Schauen wir uns – beim Thema “neue Geschlechterrollen” – mal die Veränderungen in der sexuellen Orientierung an.
Hier hat sich nämlich vieles geändert und zu einer weiteren Verwirrung beigetragen. Und Verwirrung – dieses Wort steht für Planlosigkeit, Chaos, Unruhe, Panik etc. – ist ein wichtiger Entstehungsfaktor der Borderline-Persönlichkeit.
Viele Jahrhunderte lang war das Thema Homosexualität abhängig von der jeweiligen Zeit, Kultur und Gesellschaft ein in sich widersprüchliches, gegensätzliches Thema. Es wurde so kontrovers diskutiert wie kaum etwas anderes. Konnte es der Eine noch akzeptieren war es für andere bereits eine Sünde die im extremen Fall sogar eine Todesstrafe nach sich ziehen sollte.
Bis 1969 stand männliche Homosexualität in Deutschland noch unter Strafe! Im Reichsstrafgesetzbuch von 1882 gab es den Paragraphen 175, der mit Gefängnis und auch dem Entzug von bürgerlichen Ehrenrechten drohte.
Bis in die 1990er Jahre (31.05.1994) wurde dieser Paragraph in Deutschland noch angewendet. Eine kleine Anfrage aus dem Jahr 1992 ergab, dass 1990 auf dem Gebiet der „Alten Bundesrepublik“ in 125 Verfahren 96 Personen auf dieser Grundlage verurteilt wurden. Erst durch die Wiedervereinigung kam es dann später im Jahre 1994 zur Streichung aus dem Strafgesetzbuch….
Das war jetzt nur mal die juristische Seite. Wie sieht es aber auf der psychologischen, der therapeutischen Seite aus? Hatten wir hier eher Stabilität oder gab es auch hier eher Verwirrung? Nun, vor 1991 war Homosexualität in der Psychodiagnostik noch ein häufiges Thema, jedoch mit einem recht merkwürdigen Hintergrund:
Man versuchte nämlich medizinisch zu klären, woher diese Neigung kommt und was anscheinend „falsch gelaufen sein musste“, dass sie überhaupt entstehen konnte. Dieses sogenannte „kranke Verhalten“ bemühte man sich dann psychotherapeutisch zu verändern – mit dem Ziel, dass der Patient künftig ein heterosexuelles Verhalten an den Tag legt.
Seit den 70er und in den 80er Jahren wurde Homosexualität dann langsam „Entpathologisiert“ – d.h. es wurde ihm sein Krankheitsbild abgesprochen.
1987 wurde sie erst aus dem DSM-3-R und 1991 dann aus dem ICD-10 gestrichen. Damit war Homosexualität in der „Normalität“ angekommen.
Ist sie das aber wirklich? Also der reinen Zahl nach sind 6 bis 10% der Menschen weltweit – und das unabhängig ihrer Herkunft, sozialer Schicht, Religion, frühkindlichen Erlebnissen ect. – homosexuell veranlagt.
Aktuellen Umfragen zufolge bezeichnen sich 7 % der Millennials (diejenigen, die um die Jahrtausendwende die prägenden Teenager- und Kindheitsjahre hatten / auch als Generation Y bekannt) als homosexuell. Bei der Vorgängergeneration waren es „nur“ 3,5 % waren.
Solche Zahlen sind zu groß, als dass wir sie übersehen können. Und trotzdem ist das Outing für Schwule, Lesbische oder Transgender in der Regel immer noch mit einer großen Angst vor einer Ausgrenzung oder Bestrafung durch die Gesellschaft verbunden.
Und diese Angst vor einer Bestrafung ist auch ein Kennzeichen für unsere Borderline-Thematik… Statt mehr Sicherheit zu geben, ist unsere heutige Zeit immer stärker von Angst und Verwirrung geprägt und trägt so zu mehr Borderline in der Gesellschaft bei.
5.8. Wann ist ein Mann noch ein Mann?
Mit dieser Frage fing mein Kapitel an und mit derselben Frage möchte ich das Thema nun auch abrunden:
Ein sehr wichtiges Kriterium der Borderline-Diagnose ist die Identitätsverwirrung.
Hierzu hat die neue sexuelle Freiheit einen sehr großen Teil beigetragen. Allein durch die LGBTQ-Bewegung ist das, was die Männlichkeit oder die Weiblichkeit ausmacht, sehr vielschichtiger und damit unklarer geworden. Nur weil man genetisch als Mann oder als Frau zur Welt kam, ist man nicht automatisch männlich oder weiblich.
Und was ist eigentlich eine richtige Männlichkeit oder eine richtige Weiblichkeit? Unsere Gesellschaft hat dazu immer verwirrendere Ansichten. Diese machen selbst vor unserer Sprache keinen Halt.
Immer lauter wird zum Beispiel die Forderung, in unserer Sprache zu Gendern verpflichtend einzuführen, indem die Pronomen verändert werden. Die Anrede „ihn“ oder „ihr“ wird abgelehnt und immer mehr durch das geschlechtsneutrale „Ihnen“ ersetzt.
Das, was erst einmal als sexuelle Freiheit gedacht ist, genau das ist für die Borderline-Persönlichkeit besonders schwierig zu händeln. Die andauernden Diskussionen zwischen Konservativen und Liberalen LGBT– Anhängern, rufen immer mehr Angst und Verwirrung bei der Borderline–Persönlichkeit hervor, die sich seit ihrer Kindheit auf der Suche nach einem stabilen Ich und einer sicheren Beziehung befinden.
_______________________
Zusammenfassung Kapitel 5:
Wann ist ein Mann noch ein Mann? Die Änderung der Geschlechterrollen
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam verstanden, warum Frauen dreimal häufiger von Borderline betroffen sind als Männer. Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt die enormen Widersprüche erkennen, mit denen besonders Frauen heute konfrontiert sind: Super-Mutti, Karrierefrau, perfekte Partnerin – all das gleichzeitig und ohne Fehler.
Wir konnten dabei sehen, wie dieser Spagat zwischen unvereinbaren Rollen direkt vom Perfektionismus über die emotionale Unsicherheit zur emotionalen Instabilität führt.
Besonders wertvoll ist die Erkenntnis, dass diese Überforderung keine persönliche Schwäche ist, sondern strukturell bedingt. Die berufstätige Mutter, die sich zwischen Büro und krankem Kind aufspalten muss, erlebt genau diese Spaltung, die später in der Borderline-Diagnose zentral wird.
Auch die Diskussionen um sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität haben wir als Faktor erkannt: Was als Freiheit gedacht war, erzeugt paradoxerweise noch mehr Verwirrung und Instabilität.
Gerade für Menschen mit Borderline, die auf äußere Strukturen angewiesen sind, wird die Frage “Wer bin ich eigentlich?” dadurch noch schwerer zu beantworten.
All diese Zusammenhänge zu verstehen hilft uns im täglichen Umgang mit einem Borderliner enorm, denn wir können die Identitätsverwirrung dieser Menschen nun in ihrem gesellschaftlichen Umfeld sehen.
Ausblick auf Kapitel 6: Familien damals und heute
Während wir in Kapitel 5 verstanden haben, wie Geschlechterrollen zur Borderline-Epidemie beitragen, gehen wir im nächsten Kapitel noch einen Schritt tiefer in die Wurzeln. Hier schauen wir uns an, wie Familien als grundlegendes Fundament unserer Gesellschaft immer weiter auseinanderbrechen.
Wir werden dadurch noch besser verstehen, warum die Suche nach Ersatzfamilien in sozialen Medien so gefährlich ist und wie dieser permanente Vergleich mit perfekten Instagram-Bildern direkt in die Selbstschädigung führt.
Besonders wichtig wird das Thema Scheidung und ihre verheerenden Auswirkungen auf Kinder: Die Zahlen über Suizidversuche und die Mechanismen der Parentifizierung werden dir helfen, die Beziehungsmuster deiner Klienten noch besser zu verstehen.
Und schließlich befassen wir uns mit dem dunkelsten Kapitel: Missbrauch und Vernachlässigung. Du erfährst, wie diese Traumata das Gehirn tatsächlich physisch verändern und warum misshandelte Kinder später als Erwachsene glauben, dass Liebe wehtun muss. Dieses Wissen ist fundamental für deine Praxis, denn ohne das Verständnis dieser familiären Ursprünge können wir Borderline nicht wirksam behandeln.
Kapitel 6. Borderline – Familien damals und heute – Familien brechen immer weiter auseinander…
6.1. Falsche Familien
Wird unsere Gesellschaft denn wirklich immer gespaltener / immer “Borderliner”? Zumindest ist es ein Fakt, dass unsere Gesellschaft immer weiter in ihren Grundfesten auseinanderbricht.
Einen großen Anteil daran haben die vielen Scheidungen und auch Familienauflösungen. Sie beflügeln auf ihre ganz besondere Art einen neuen und auch gefährlichen Trend hin zu einer falschen / einer virtuellen Ersatz-Familie. Was ich damit genau meine, möchte ich in diesem Kapitel etwas näher erklären.
Obwohl aktuell immer mehr Familien auseinanderbrechen, bedeutet dies doch nicht, dass Bindung oder Familie grundsätzlich obsolet ist.
Diese tiefe innere Sehnsucht nach einer persönlichen Wurzel, einer Herkunft oder nach einem Stamm, dem man angehört, ist immer noch tief in uns allen drin.
Diese zeigt sich in den verschiedensten Formen unserer Gesellschaft:
- Ein Fußballfan identifiziert sich z.B. mit seinem Lieblings-Verein.
- Millionen Fans warten Stunden um Stunden, um für ihren Held/Superstar zu stimmen, um damit Teil einer größeren Gruppe für etwas Größeres / ein gemeinsames Ziel zu sein.
- Millionen von Nutzern registrieren sich bei Tik Tok, Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter, um gemeinsam an einem gewaltigen Event teilzunehmen.
Am 07.08.2021 feierten zum Beispiel 3000 Menschen das „Berliner Freedom Dinner“. Durch die Social Media Plattformen wurden hierdurch ca. 209 Millionen Menschen erreicht. Statt einen zweistelligen Millionenbetrag für klassische Werbung auszugeben, nutzte man einfach die neuen Plattformen. So weit, so gut.
Was 1997 noch ganz klein mit Plattformen wie Sixdegrees oder classmates.com begann, startete 2003 mit LinkedIn und ein Jahr später mit Facebook richtig groß durch. 2022 lag die Nutzerzahl von sozialen Netzwerken bereits bei ungefähr 4,62 Milliarden. Das waren 10 % mehr als im Vorjahr und das dreifache der Nutzeranzahl im Vergleich zu 10 Jahren zuvor.
Laut einer ARD/ZDF Studie aus dem Jahr 2021 ist Instagram unter den jüngeren Nutzern bis 29 Jahre das meistgenutzte soziale Netzwerk in Deutschland. 74 % der Befragten in dieser Altersgruppe nutzen diese App regelmäßig.
Ist das denn jetzt wirklich so gefährlich? Ist die Nutzung von sozialen Netzwerken per se nur mit äußerster Vorsicht zu genießen? Und was hat dies alles mit Borderline zu tun?
OK, Vorsicht ist in allen Bereichen unseres Lebens angebracht – auch bei der Nutzung neuer Medien. Auf der einen Seite helfen sie uns, mit anderen in Kontakt zu bleiben, Pläne mit Freunden zu schmieden und neue Freundschaften zu schließen. Aber ihre Nutzung geht oft weit darüber hinaus und ist möglicherweise doch nicht ganz so selbstlos, wie man dies auf den ersten Blick sehen könnte.
Microsoft stellte in einer Untersuchung nämlich fest, dass unser „EGO“ im Endeffekt der stärkste Motivator für die Teilnahme daran ist: “Man macht mit, um sein eigenes soziales, kulturelles Kapital nach außen zu steigern.“
Der Neuropsychologe und kognitive Neurowissenschaftler, Professor Lutz Jäncke aus Zürich bewies durch seine Studien, dass unsere Social Media Landschaft eigentlich Stress pur für unser Gehirn ist. Es ist einfach nicht für diese Hochgeschwindigkeits Kommunikation der heutigen Zeit geschaffen.
Aber nicht nur unser Gehirn leidet wegen der Überflutung durch die digitale Technik. Auch unser gesamtes Sozialverhalten wird hiervon beeinflusst, indem unser Mitgefühl für andere und auch unsere Sicht auf uns selbst immer stärker verzerrt wird.
Diese Verzerrung sehen wir, indem sich viele Menschen auf Instagram und anderen Social Media Kanälen verfälschen und unnatürlich wiedergeben. Es ist so, als wenn man sich wie hinter einer virtuellen Maske in einem virtuellen Raum bewegen würde.
Diese sozialen Netzwerke konfrontieren uns ständig mit perfekten Bildern anderer und fordern uns damit auf, uns mit ihnen zu vergleichen.
Dieser Aufwärtsvergleich ist ein sehr gefährlicher psychologischer Prozess:
Messen wir uns zum Beispiel immer wieder an Personen, die auf den Bildern perfekt aussehen, dann stufen wir unser Aussehen im Vergleich dazu fast schon zwangsläufig viel niedriger ein. Das kann dann dazu führen, dass wir uns vermehrt anstrengen, unser Äußeres durch mehr Sport, andere Ernährung und weitere Dinge zu verändern.
Das an sich ist noch nicht negativ … Es kann aber der Beginn einer Abwertung der eigenen Person, einer verzerrten Wahrnehmung über unser Aussehen kommen, also einer Wahrnehmung, die absolut nicht der Realität entspricht.
Dies alles führt praktisch zwangsläufig dazu, dass wir durch unsere Hochglanz Medien – Kultur, ein Zeitalter des Narzissmus einläuten, wie das schon 1978 von Christopher Lasch, einem amerikanischen Historiker und Sozialkritiker (1932 – 1994) beschrieben wurde. In seinem Buch „Das Zeitalter des Narzissmus“ schrieb er, wie durch Reality-TV Menschen sehr schnell berühmt und noch schneller wieder verheizt werden.
Seine Aussagen sind in unserem noch jungen Jahrtausend mit dem Internet 2.0, in dem die eigene Person auf den Social-Media-Plattformen im Vordergrund steht und sich jeder als eine persönliche Marke (Self-Branding) darbieten möchte, aktueller denn je.
Die Folgen von alledem sind aber bereits heute verheerend … Als Beispiel mag das immer stärker gestörte Essverhalten bei vielen Jugendlichen dienen:
- Bei einem Fünftel der Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren finden sich deutliche Hinweise auf ein gestörtes Essverhalten, wobei Mädchen fast doppelt so häufig betroffen sind wie Jungen.
- Viele Kinder und Jugendliche mit einem auffälligen Essverhalten empfinden sich auch bei einem normalen Körpergewicht als viel zu dick. Außerdem neigen sie deutlich eher zu psychischen Problemen, Ängstlichkeit und Depressivität.
Kannst du dich noch an die Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung erinnern? Kriterium Nummer 4: Mindestens 2 potenziell selbstschädigende Bereiche. Hierzu gehört auch ein krankhaft gestörtes Essverhalten.
Durch die fortlaufend immer stärker werdende Online-Präsenz unserer Welt verlieren wir unsere natürlichen Skills / unsere Überlebensfähigkeit für die Probleme in der realen „Offline Welt“.
Für alles brauchen wir bald eine App. Wir verlassen uns in immer mehr Bereichen praktisch komplett auf unsere technischen Geräte und seit kurzem immer mehr auf Chat GPT und andere KI-Modelle.
Wann hast du zum Beispiel das letzte Mal in ein Wörterbuch geschaut oder eine Landkarte beim Autofahren benutzt?
Ist es nicht so, dass wir uns fast schon blind durch unser elektronisches Navigationssystem leiten lassen? Und weil dem so ist, lesen wir auch immer häufiger von verrückten Navigation Irrtümern wie zum Beispiel den folgenden Beiden:
- Juni 2016. Bei Bad Kissingen fuhr eine 86 jährige Autofahrerin auf eine falsche Anschlussstelle der Autobahn. Das Navigationsgerät forderte sie auf mit „Bitte wenden“. Sie tat dies und wurde damit tragischerweise zu einer Geisterfahrerin – leider mit verhängnisvollen
- Im Februar 2015 fuhren zwei Amerikaner amüsanter Weise in einem Leihwagen treu den Anweisungen ihres Navigationsgerätes gemäß an der Südküste von Wales mitten ins Meer hinein. Eigentlich wollten sie nach Caldey Island. Dort fuhren aber nur Boote hin und keine Brücke.
Verrückt, wie wir uns alle von unseren technischen Geräten abhängig gemacht haben.
Dies waren noch mehr oder weniger harmlose Fälle. Der Absturz der Air France Maschine 447 im Juni 2009 über dem Atlantik zeigt jedoch, wie verhängnisvoll es ausgehen kann, wenn wir unser Leben komplett in die Hände der Technik legen und diese dann versagt.
Des „Wegführen“ von dem eigentlichen Leben verursacht aber nicht zwangsläufig Borderline!
Jedoch ist dies alles ein wichtiger Bestandteil der Veränderung unseres Lebens. Was gibt uns eigentlich noch Halt in unserem Leben? Woran können wir uns überhaupt noch festhalten, um nicht in eine instabile Persönlichkeit zu geraten? Wie können wir in der Erziehung unseren Kindern besser beistehen? Schauen wir uns diesen wichtigen Punkt einmal gemeinsam an:
6.2. Veränderte Erziehung und moderne Praktiken in der Kindererziehung.
Erziehung: Das Verb „erziehen“ geht auf ein althochdeutsches Wort zurück: „Irziohan“ und bedeutet etwas herausziehen, etwas aufziehen. Im lateinischen Wortschatz liegt hier das Wort „educare“ zugrunde. Auch dieses bedeutet so viel wie „aufziehen, großziehen, ernähren oder erziehen. Es geht aber noch tiefer und zwar in die Richtung, den Geist / den Charakter von jemandem in seiner Entwicklung zu fördern.
Erziehung ist für unsere soziale Gesellschaft der wohl wichtigste Grundeckpfeiler. Aber welche Bedeutung wird diesem in der Realität beigemessen? Nun, wir leben heute in einer Zeit, in der traditionelle Eltern-Erziehung praktisch immer weiter ausgegliedert oder outgesourct wird.
Anstatt dass sich Eltern auf ihre ureigenen Instinkte in der Erziehung verlassen, verlassen sie sich immer stärker auf Bücher, Fachleute oder Institutionen für die Erziehung ihrer Kinder, was einer starken dyadischen Bindung natürlich wieder einmal im Wege steht.
Durch die immer größere Überforderung des täglichen Lebens haben Eltern immer weniger Zeit und Kraft, sich mit der Erziehung ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Was dann am Ende noch übrig bleibt, ist oft nur noch so wenig wie ein Feigenblatt. Und die Restzeit wird – mit ein wenig Scham – als sogenannte „Qualitäts-Zeit“ schön geredet. Viele Eltern versuchen dann, die fehlende Zeit wieder dadurch gut zu machen, indem sie überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit auf die praktischen Bedürfnisse und Freizeitinteressen des Kindes lenken, aber die seelischen Bedürfnisse und die echte elterliche Wärme bleiben oft auf der Strecke.
Wenn die Wärme aber fehlt … Was wird dann überhaupt noch gegeben?
Kinder werden durch solch eine entfremdete Erziehung von einem Subjekt zu einem Objekt verändert. Eltern nehmen ihr Kind nur noch als narzisstische Erweiterung, als Status-Objekt ihrer selbst, jedoch nicht mehr als eigenständige selbstständige Menschen.
Zugeschüttet mit distanzierter, nicht-emotionaler Aufmerksamkeit, führt dies bei dem Kind einerseits zu einem übertriebenen Gefühl der eigenen Bedeutung, zum anderen aber auch zu einem Verlust des Selbstwerts / des Ich-Gefühls.
Das Kriterium Nummer 3 der Borderline-Persönlichkeitsstörung lässt hierbei wieder mal grüßen: Die Identitätsstörung.
6.3. Scheidungen – wenn ein wichtiger Teil im Leben fehlt.
In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland auf der einen Seite zwar deutlich angestiegen, in den letzten 17 Jahren aber auch wieder gesunken. 2003 war der Höhepunkt mit fast 215.018 Trennungen. Im Jahr 2020 ist die Zahl der Scheidungen dann auf ungefähr 144.000 gesunken. All das sind sehr hohe Zahlen und kaum vorstellbar, wenn man sie in die Relationen zu dem einzelnen Schicksal bringt. Immer mehr Kinder wachsen ohne die körperliche oder emotionale Nähe ihres Vaters auf.
Gerichte sprechen die Kinder überwiegend der Mutter zu, wodurch die größte Zahl alleinerziehender Haushalte von Frauen geführt wird. Selbst da, wo beide Elternteile sich das Sorgerecht teilen oder sich sonstwie geeinigt haben, steht der Vater nach wie vor in Erziehungsfragen im Hintergrund.
Welche Auswirkungen hat eine Ehescheidung für ein Kind, wenn es sich noch im Kleinkindalter befindet? Diese Kinder reagieren naturgemäß mit besonders großer Angst vor dem Verlassenwerden, mit starker Bedürftigkeit, Regression und akuter Trennungsangst.
Erkennst du hier das Kriterium Nummer 1 der Borderline-Persönlichkeitsstörung? „Ein verzweifeltes Bemühen, ein Alleinsein zu verhindern.“ Viele Kinder werden depressiv (Kriterium Nummer 7) und zeigen in ihren späteren Jahren oft ein antisoziales Verhalten.
Die Zahl an Jugendlichen, die in einer Ein-Eltern-Familie Selbstmord begehen, ist dreimal höher als im Durchschnitt. Diese Zahl ist auch höher als im Vergleich zu den Gleichaltrigen, die unter einer psychischen Störung leiden, jedoch in intakten Familien leben!
Der Tod eines Elternteils scheint keinen Einfluss auf das Suizidversuchsrisiko zu haben. Dies lässt vermuten, dass wohl nicht so sehr die Trennung, sondern wahrscheinlich eher die ständigen Auseinandersetzungen der Eltern, der Mangel an Liebe und Geborgenheit für die Kinder von Bedeutung sind. Umstände, die einer Scheidung in den meisten Fällen vorausgehen. Solche Zahlen sollten einen zum Nachdenken veranlassen!
Es muss aber nicht immer dramatisch mit Suizid gerechnet werden. Wenn Eltern sich trennen, dann nimmt der kindliche Wunsch nach körperlicher Nähe zu den Eltern sehr stark zu. Typisch für ein kleines Kind nach einer Trennung ist der starke Wunsch, bei den Eltern im Bett schlafen zu dürfen.
Im Grunde genommen ist dies auch ok, solange dies nicht über längere Zeit in der Praxis durchgeführt wird. Wird es dann nämlich auch für die Eltern zu einem Bedürfnis, dann bedroht dies die Entwicklung einer körperlichen Integrität, eines stabilen Selbst des Kindes, oder kann auch in extremen Fällen zu einem sexuellen Missbrauch durch einen der Elternteile führen.
Der Kampf vor den Gerichten
Sehr oft gehen Eltern nach einer Trennung vor Gericht und beginnen einen zerstörerischen Kampf um das Sorgerecht, in welchem die kleine Kinderseele zerrieben wird. Besuchsrecht, Unterhaltszahlungen u.ä. wird dann als Waffe eingesetzt, um den ehemaligen Partner für ein begangenes Unrecht zu bestrafen.
Aber egal, wieso, weshalb und warum Eltern sich bekämpfen, sie sollten immer daran denken, dass sich all ihre Kämpfe katastrophal auf das Kind auswirken und dass dies niemals durch irgendetwas im Kampf gewonnenes aufgewogen werden kann. Kinder erfahren in diesen Kämpfen eine übergroße Ohnmacht einerseits, aber auch eine überbordende Macht, wenn sie in den Kampf hineingezogen werden und zum Beispiel eine Aussage vor Gericht machen müssen.
All das fördert eine Borderline-Pathologie!
Aber Vorsicht: Nicht, dass durch meine Abhandlung über Ein-Eltern-Familien bei dir lieber Leser nun ein falsches Verständnis aufkommt….
Ich möchte nicht sagen, dass eine Ein-Eltern-Familie zwangsläufig und zu 100% eine schlechtere Situation für Kinder darstellt als die Familien, wo Vater und Mutter noch vorhanden sind. Wenn die Sorgen des Lebens jedoch nur noch auf den Schultern von einem Elternteil ausgetragen werden, kommt es häufig zu einer Überlastung. Ich denke hier an
- die finanziellen Sorgen, wenn der Unterhalt ausbleibt
- die sozialen Probleme durch Vorurteile, ein sich zurückziehendes soziales Netzwerk,
- ein schlechtes Gewissen wegen der Trennung oder möglicher Erziehungsfehler…
Durch die Trennung vom Vater entsteht oft ein Vakuum, in welchem das Kind dann nur noch eine begrenzte Möglichkeit hat, seine eigene Identität zu entwickeln. Hier fehlt einfach der Puffer durch den anderen Elternteil, damit sich eine gesunde Individualität zwischen Eltern und Kind entwickeln kann.
Durch dieses Vakuum des fehlenden Vaters entwickelt sich oft aber noch etwas Gefährliches, was wir als „Parentifizierung“ bezeichnen. Denn, obwohl viele Mütter versuchen, den Vater zu ersetzen, versuchen die Kinder, in Form einer Symbiose mit der Mutter diesen „Job“ zu übernehmen.
Dass dies nicht für eine gesunde Kindesentwicklung förderlich ist, liegt auf der Hand. Das Kind idealisiert die Mutter, möchte ihr immer stärker gefallen.
Die Mutter ihrerseits kann ebenfalls in dieser gemeinsamen Abhängigkeit aufgehen und das Kind zu ihrem einzigen Lebenszweck machen.
Diese gegenseitige Abhängigkeit kann das geistige Wachstum und seine Selbstständigkeit vollständig ausbremsen.
Und wenn ich keine Selbstständigkeit / kein eigenes Ich entwickeln kann, dann ist hier mal wieder die Wurzel für die Borderline – Persönlichkeitsstörung gelegt! Kriterium Nummer 3 und 7 lässt auch hier wieder grüßen…
6.4. Misshandlungen / Missbrauch fördert Borderline
Unsere Welt wird immer „Borderliner” … immer instabiler… Ein Faktor dafür ist die Missachtung der Würde unserer Jüngsten in der Gesellschaft. Die Zahlen über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Menge an kinderpornographischem Material sind einfach nur erschreckend!
Wenn wir uns die Zahlen des Bundeskriminalamtes einmal zur Hand nehmen, dann ist der sexuelle Missbrauch von Kindern zwischen 2020 und 2021 um 4 % angestiegen, auf über 17.700 bekannte Fälle (die Dunkelziffer ist logischerweise deutlich höher). Bei der Herstellung, dem Besitz und der Verbreitung von kinderpornographischem Material sind die bekannten und aufgeklärten Fälle allein im Jahr 2020 zu 2021 um über 108 % angestiegen.
Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern ist ein immer gravierenderes Problem in unserer Gesellschaft. Einige Untersuchungen schätzen, dass jedes vierte Mädchen als Kind irgendeine Form des sexuellen Missbrauchs entweder durch die Eltern oder von einer anderen Person an sich erfahren musste.
Was für Auswirkung hat all das auf die kleine Kinderseele?
Kinder, die diese Torturen erleiden müssen, leiden überdurchschnittlich stark an Depressionen, Bindungsängsten, ADHS und schweren Wutanfälle, verminderter Impulskontrolle, Aggression und deutlichen Problemen im Umgang mit Gleichaltrigen. Und das alles hört später nicht auf. Die Langzeitfolgen sind erschreckend: Wer in seiner Kindheit gedemütigt, sexuell missbraucht oder geschlagen wurde, leidet als Erwachsener deutlich häufiger an psychischen Erkrankungen, Depressionen oder Angstattacken!
Welche Auswirkungen hat Gewalt auf die körperliche Entwicklung eines Kindes?
Gewalterfahrung beim Kind führt tatsächlich zu einer dauerhaft veränderten Wahrnehmung von äußeren Reizen! Was ich mit einem Ausrufezeichen geschrieben habe, fing erst einmal mit einem Fragezeichen an.
Wissenschaftler der medizinischen Psychologie des Universitätsklinikums Bonn haben sich mit ihren Kollegen der Ruhr – Universität Bochum diesem Thema angenommen. Das Ergebnis ihrer Studie war: je stärker in Art und Dauer die Misshandlungen in der Kindheit waren, desto stärker reagierten zwei Regionen im Gehirn der untersuchten Studienteilnehmer auf schnelle Berührungen.
Der somatosensorische Kortex befindet sich im mittleren Gehirn ungefähr über dem Ohr und registriert, wo eine Berührung stattfindet.
Hier werden dann – nach den Berührungen — Körperbewegungen vorbereitet und eingeleitet, um zum Beispiel ein berührtes Körperteil wegzuziehen.
Der andere Bereich ist die posteriore Inselrinde tief im Gehirn hinter den Schläfen. Sie steht für die emotionale Bewertung von Schmerzen und ist praktisch für jede weitere Körperwahrnehmung wie Berührung, Hunger, Durst und Schmerz zuständig. Die Aktivität dieser beiden Hirnareale ist bei traumatisierten Menschen bei schnellen Berührungen deutlich erhöht. Der für das Lernen, das Gedächtnis und das Speichern von positiven und negativen Assoziationen so wichtige Hippocampus dagegen war bei langsamen Berührungen deutlich schwächer aktiviert, wenn traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht worden sind.
Praktisch übersetzt spiegelt die schwächere Aktivität des Hippocampus eine geringere Belohnung bei einer Berührung wider. Wenn nun eine traumatisierte Person eine langsame, aber emotional intensivere Berührung als weniger belohnend empfindet, dann kann dies auch zu einer inneren seelischen Leere führen, die der Borderline – Persönlichkeitsstörung weiter Tür und Tor öffnet.
Kriterium Nummer 7 – die innere Leere.
Missbrauch und seine Folgen
Wenn wir uns einmal in aller Ruhe betrachten, was für traurige Botschaften bei einem Missbrauch dem Kind gegeben werden, dann können wir drei besonders herausstellen:
- Abwertung und Erniedrigung: Das Kind wird in seinem Dasein, seinem Lebenswert komplett abgewertet. Selbst kleine Fehler von ihm werden überbewertet. Es dauert nicht lange und jedes Kind ist nach so einem emotionalen Missbrauch im Gedanken gefangen, komplett wertlos und schlecht zu sein.
- Vernachlässigung: „Dein Wert interessiert mich nicht“
Auch Vernachlässigung ist ein emotionaler Missbrauch.
Kühl, distanzierte und emotional abwesende Eltern zeigen nur sehr wenig Interesse daran, wie sich das Kind entwickelt, geben ihm keinen Halt oder Zuneigung, wenn es diese benötigt.
- Bedrohliche Herrschaft: „Ich habe die Kontrolle über dich“
Drohungen, Gewalt, Tyrannei und alles, was das sich entwickelnde Verhalten eines Kindes einengt, sind nichts anderes als ein Missbrauch am Kind. Und mit was könnte man einen Machtmissbrauch besser vergleichen als mit einer Geiselnahme oder einer Gehirnwäsche?!
Reden wir über Kindesmisshandlung, dann sprechen wir oft von großen Traumata und von außen deutlich sichtbaren Verletzungen, wodurch sich eine Persönlichkeitsstörung hat bilden können. Betrachten wir aber einmal all die emotional vernachlässigten Kinder, dann spiegeln doch gerade sie das Problem von Borderline im späteren Leben wider.
Vernachlässigung in der Kindheit veranlasst die Betroffenen nämlich immer wieder aufs Neue dazu, jemanden oder etwas zu suchen, was ihnen im Leben wegen ihrer starken inneren Leere fehlt. Immer und immer wieder verfallen sie in dieselbe bodenlose Angst und Unruhe. Suchen genau diese eine Person, die ihnen den lang ersehnten Halt im Leben geben könnte, den ihnen ihre Eltern nicht gegeben haben.
Andererseits ist aber genau diese unruhige und impulsive Suche fast schon ein stabilisierender Anker, weil es Ihnen das Gefühl gibt, überhaupt zu existieren.
Aus diesem Grunde binden sich auch viele Borderliner extrem schnell – oft sogar, wenn sie sich noch in einer anderen Beziehung befinden. Ihr Wunsch nach Zuneigung und Nähe ist so groß, dass praktisch jeder als Partner in Frage kommt, der auch nur ein kleines Maß an Respekt und Bewunderung aufbringt. Das Ergebnis ist das Kriterium Nummer 2 der Borderline-Persönlichkeitsstörung: intensive aber auch zerbrechliche zwischenmenschliche Beziehungen.
Praktisch ein Trümmerfeld an instabilen Beziehungen, die ihrerseits Borderline noch weiter fördern.
All die jetzt besprochenen Themen wie Misshandlung, Vernachlässigung und längere Trennungen in der frühen Kindheit sind mit dafür verantwortlich,
- dass sich in einem Kind nur sehr schwer ein Ur-Vertrauen in das Leben bilden kann.
- Eine Selbstachtung und ein stabiles Ich bleiben dabei vollkommen unterentwickelt.
- Auch die Fähigkeit, später im Leben mit Trennungen fertig zu werden, bleibt weit hinter einer normalen Entwicklung zurück..
So traurig es sich auch anhören mag, aber auf dem Weg zum Erwachsenwerden wiederholen viele misshandelte Kinder augenscheinlich die frustrierenden Beziehungserfahrungen mit den eigenen Eltern.
„Liebe muss einfach weh tun” und deswegen wird Nähe mit Schmerz und Bestrafung in Zusammenhang gebracht. Und wenn Schmerz und Bestrafung aufgrund der eigenen Erfahrung Liebe bedeutet, dann ist Selbstverletzung oft wie ein späterer Ersatz für den in der Kindheit misshandelnden Elternteil. Was für eine traurige Tatsache…
Mein Fazit am Ende dieses ersten Teils des Buches ist, dass sich unsere Gesellschaft sich immer weiter spaltet – unsere Gesellschaft wird immer „Borderliner…“
Lass uns in dem zweiten Teil darüber sprechen, wie man mit einem Borderliner trotz der vielen Herausforderungen im Gespräch bleiben kann.
________________
Zusammenfassung Kapitel 6: Familien damals und heute – Familien brechen immer weiter auseinander
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam die Wurzeln der Borderline-Epidemie in unserer Gesellschaft freigelegt.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt noch besser verstehen, wie der Zerfall von Familien direkt mit der Entstehung von Borderline zusammenhängt.
Wir konnten erkennen, wie gefährlich die falschen Ersatzfamilien in sozialen Medien sind: Der permanente Aufwärtsvergleich mit perfekten Instagram-Bildern führt zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung und direkt in die Selbstschädigung durch Essstörungen.
Besonders wertvoll war die Erkenntnis über die outsourced Erziehung. Wenn Eltern ihre Kinder nur noch als narzisstische Erweiterung, als Status-Objekt betrachten und die emotionale Wärme fehlt, entsteht genau diese Identitätsstörung, die wir als Kriterium 3 kennen.
Die Zahlen über Scheidungen sind einfach nur erschütternd: Kinder aus Ein-Eltern-Familien haben ein dreimal höheres Suizidrisiko, und die Parentifizierung raubt ihnen die Möglichkeit, ein eigenständiges Ich zu entwickeln.
Am schwersten wiegt wohl das Thema Missbrauch und Vernachlässigung. Wir haben gelernt, dass Gewalt das Gehirn physisch verändert, dass der Hippocampus schwächer aktiviert wird und Berührungen weniger belohnend empfunden werden. Dies führt zur inneren Leere von Kriterium 7.
Die drei Botschaften des Missbrauchs – Abwertung, Vernachlässigung und bedrohliche Herrschaft – haben wir als Grundmuster erkannt, das sich später in toxischen Beziehungen wiederholt. Vernachlässigte Kinder suchen ihr Leben lang nach dem, was ihnen von Geburt an fehlte. Und diese unruhige Suche wird paradoxerweise selbst zum stabilisierenden Anker.
Für den täglichen Umgang mit einem Borderliner ist dieses Verständnis fundamental, denn wir können nun die verzweifelte Suche unserer Umgebung nach Nähe und ihre schnellen Bindungen in ihrem ursprünglichen Zusammenhang besser sehen und anerkennen.
Zusammenfassung
Der Spiegel ist zerbrochen – Zeit, die Scherben aufzusammeln
Puh. Durchgeatmet? Ich spüre, was Du gerade durchgemacht hast. Die letzten Kapitel waren kein leichter Spaziergang durch einen Rosengarten. Sie waren eher ein Blick in den Spiegel – und dieser Spiegel zeigt uns eine Welt in Scherben. Lass uns deshalb kurz gemeinsam innehalten und nach hinten schauen. Schau kurz einmal zurück auf das, was Du bereits gelesen hast. Vielleicht fühlst Du Dich gerade überwältigt. Vielleicht erkennst Du Dich selbst in manchen Beschreibungen wieder. Vielleicht siehst Du Deine Beziehung, Deine Familie, Deine Arbeit plötzlich in einem anderen Licht. Und das ist auch gut so.
Was Du gerade gelernt hast
In den zurückliegenden Kapiteln hast Du gesehen, wie unsere Gesellschaft die neun Diagnosekriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht nur spiegelt – sondern aktiv fördert:
- Das verzweifelte Bemühen, Alleinsein zu verhindern
- Homeoffice und Pandemie-Isolation
- Social Media als Ersatz für echte Nähe
- Die explodierende Einsamkeitsquote (42% während Corona!)
- Intensive, aber instabile Beziehungen
- 40-45% Scheidungsrate – und steigend
- Der “überkreuzende Lebenspartner” (nie ohne Backup-Beziehung)
- Dating-Apps: Liebe auf Abruf, Wegwischen bei der kleinsten Unstimmigkeit
- Die Identitätsstörung
- “Wer bin ich?” – eine Frage ohne Antwort
- Geschlechterrollen im freien Fall
- Die fragmentierte Persönlichkeit in verschiedenen Social-Media-Profilen
- Starke Impulsivität und Selbstschädigung
- “Sad Tox” – digitale Mutproben als Normalität
- 2/3 der Jugendlichen verletzen sich selbst
- Die Instant-Gratification-Kultur: Alles sofort, aber nichts hält
- Suizidale Handlungen
- “Last Generation” – ohne Hoffnung auf Zukunft
- Die Selbstmordrate bei jungen Menschen steigt dramatisch
- Songs über den Tod vor dem Älterwerden als Mainstream
- Stimmungsschwankungen und affektive Instabilität
- Von der weißen in die schwarze Phase in Sekunden
- Die emotionale Achterbahn der Krisennachrichten
- Niemand ist mehr berechenbar
- Chronische innere Leere
- Scroll, scroll, scroll – und trotzdem nichts gespürt
- Viktor Frankls Frage brennender denn je: “Wozu lebe ich?”
- Die Sinnkrise als Massenphänomen
- Unangemessene Wut
- Shitstorms als neue Normalität
- Cancel Culture und Empörungswellen
- Vom Diskurs zum Krieg in drei Kommentaren
- Paranoide und dissoziative Symptome
- Verschwörungstheorien überall
- “Die da oben” gegen “uns hier unten”
- Realitätsverlust als politische Strategie
Die unbequeme Wahrheit lautet:
Du hast es jetzt schwarz auf weiß gelesen: Unsere Gesellschaft ist nicht nur von Borderline betroffen – sie IST Borderline.
- Die Spaltung: Überall nur noch Schwarz oder Weiß, Freund oder Feind
- Die Instabilität: Keine Tradition hält mehr, keine Beziehung ist sicher
- Die Leere: Trotz Überfluss fühlen wir uns ausgehöhlt
- Die Angst: Vor der Zukunft, vor dem Klimawandel, vor dem Alleinsein
- Die Wut: Sie kocht unter der Oberfläche und bricht explosionsartig hervor
Aber hier ist die gute Nachricht: Das war nur die Diagnose. Jetzt kommt die Therapie.
Was Du jetzt mit diesem Wissen machen kannst und solltest:
Vielleicht fragst Du Dich gerade: “Und was jetzt? Soll ich mich in einer Höhle verkriechen und auf den Weltuntergang warten?” Nein. Genau das Gegenteil. Denn jetzt, wo Du das Problem verstanden hast, bist Du bereit für die Lösung. Jetzt, wo Du die gesellschaftlichen Wurzeln kennst, kannst Du anfangen, an den individuellen Zweigen zu arbeiten. Jetzt, wo Du weißt, wie tief die Borderline-Dynamik in unserer Kultur verankert ist, kannst Du aufhören, Dich selbst oder Deinen Partner zu verurteilen. Es ist nicht Deine Schuld. Es ist nicht ihre Schuld. Es ist eine kollektive Entwicklung. Aber das bedeutet nicht, dass Du machtlos bist. Im Gegenteil.
Der Leuchtturm in der Brandung
Erinnerst Du Dich an das Bild des Leuchtturms aus Kapitel 10? Ein Leuchtturm steht fest, egal wie wild die See tobt. Er sendet sein Signal aus, konstant und zuverlässig. Er bewegt sich nicht auf das Schiff zu – das Schiff muss zu ihm kommen. Das kannst Du sein. Nicht für die ganze Gesellschaft – das wäre vermessen. Aber für die Menschen in deinem Leben. Für Deinen Partner. Dein Kind. Deinen Klienten. Deinen Kollegen.
“Borderline verstehen”
und seine Sprache sprechen lernen. Wie unsere Gesellschaft selbst zum Symptom wird und wie wir damit umgehen können. Die U.M.W.E.G.©-Methode.
Warum fühlt sich unsere Welt zunehmend gespalten, orientierungslos und emotional instabil an? Warum nehmen Schwarz-Weiß-Denken, Beziehungskrisen und innere Leere so dramatisch zu?
Ich wage in diesem Buch eine provokante These: Unsere Gesellschaft entwickelt zunehmend Strukturen, die der Borderline-Persönlichkeitsstörung erschreckend ähneln. Social Media, fragmentierte Familienstrukturen, Konsumkultur und politische Polarisierung erzeugen genau jene Dynamiken, die wir aus der Borderline-Therapie kennen.
Aber dieses Buch belässt es nicht bei der Analyse. Im zweiten Teil stelle ich die von mir entwickelte U.M.W.E.G.©-Methode vor – ein wissenschaftlich fundiertes Kommunikationssystem, das in emotional hochexplosiven Situationen greift. Ob bei Borderline-Partnern in der Krise, pubertierenden Jugendlichen oder alltäglichen Konfliktsituationen: Diese Methode gibt konkrete Handlungsstrategien an die Hand.
Für jedes der neun Borderline-Kriterien – von Verlustängsten über Identitätsstörungen bis hin zu Suizidalität – bietet das Buch praxiserprobte Werkzeuge: Wut-Tagebücher, die Drei-Schritt-Methode, Deeskalationstechniken und viele weitere Kommunikationsinstrumente, die sofort umsetzbar sind. Ein Buch, das philosophische Tiefe mit therapeutischer Praxis verbindet. Für Angehörige, Therapeuten, Pädagogen – und alle, die in unserer fragmentierten Welt Stabilität schaffen wollen.
Möge der Tanz mit dem Borderliner beginnen! 😉
Wirksame Skills bei Borderline!
Borderline ist eine Therapie, dies sich sehr von anderen Therapieformen unterscheidet. Ich würde diese Therapieform auch als Training fürs Leben bezeichnen.
Und wie im “normalen Leben” brauchen wir auch in der Borderline-Therapie Softskills, um mit den täglichen Anforderungen dieser Persönlichkeitsstörung besser umgehen zu können.
Borderline hat viel mit Emotionsregulation zu tun. Darum ist es sehr passend, dass die hier angeführten und sehr praxisbezogenen Skills eine wirksame Hilfe darstellen, die eigenen Emotionen effektiv unter Kontrolle zu halten und besser für sich nutzbar zu machen.
Dieses Buch ist nicht nur für Therapeuten eine Schatzkiste an Ratschlägen. Auch für betroffene Borderline und auch für Angehörige ist dieses Buch ein “Augenöffner” und Helfer für den Alltag. Ein tolles Werk für jeden Betroffenen.
Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?
- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?
- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:
- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten
- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.
Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus