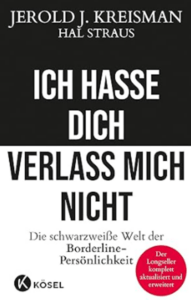Borderline
Persönlichkeitsstörung Diagnose
“Das ist halt ein Psychopath!”
Viele gebrauchen diesen Begriff, ohne zu wissen, was man sich darunter konkret vorzustellen hat. Ist ein Psychopath denn immer so negativ wie es sich anfühlt? Sind es nicht auch die oft (zwielichtigen) Persönlichkeiten, welche durch besondere Leistungen auffallen wie …
- zB. “beinharte” / rücksichtslose Typen,
- denen man trotz aller Bedenken / Wut einen gewissen Respekt nicht verwehren kann.
Es kann sich darum nicht (nur) um ein intellektuelles Defizit handeln (Stichwort: “geistesschwacher Triebtäter”).
Eher ist mit dieser Bezeichnung die moralische Seite gemeint.
Dazu kommen nun die Fachleute mit der Aussage, das es auch das Gegenteil von dominanten und grenzwertigen Naturen gibt
- nämlich die passive, asthenische (kraftlose),
- die selbstunsichere, vermeidende,
- die hilflos / abhängig wirkenden Menschen mit ihrer entsprechenden Psychopathie-Diagnose.
Bei diesen “Opfern ihrer Wesensart” lässt sich der Begriff “Psychopathie” dann nicht mehr so gut als rein negatives Schimpfwort gebrauchen.
Eine Stufe schwieriger wird es, wenn man mal in Ruhe die Lebensgeschichten der Großen dieser Welt aus Politik, Militär, Kunst, Wissenschaft durchforstet.
Das liest sich zeitweise wie die reine Auflistung von “Psychopathologie”,
Sind psychopathische Züge also alle lästig, negativ, und minderwertig?
Entstehen daraus immer unbeherrschte, geltungssüchtige, gemütlose, fanatische, oder wahnhafte Krankheitszüge?’
Oder sind die Psychopathen eventuell das “Salz der Erde” / die Rose im Blumenstrauß / der Antreiber innerhalb der verschiedenen Epochen?
PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG: DAS “UNBEKANNTE” KRANKHEITSBILD
“Persönlichkeitsstörungen, das unbekannte Krankheitsbild” lautet mein erster provozierende Zwischentitel.
Provozierend finde ich ihn deshalb, weil unbekannt können diese Menschen in unserer Gesellschaft ja nicht geblieben sein.
- Dafür sind sie viel zu auffällig, zu lästig bis bedrängend, und u. U. sogar bedrohlich bis gefährlich
- Und selten sind sie auch nicht:
Die Häufigkeit von Personen mit auffälliger Persönlichkeitsstruktur beträgt in der Allgemeinbevölkerung nach Angaben einiger Studien ca. 10 %.
Das bedeutet, im deutschsprachigen Bereich (D/A/CH) leben über10.000.000 Psychopathen bzw. Persönlichkeitsstörungen unter uns.
Müssen wir jetzt alle Angst haben? Nicht wirklich! Denn Persönlichkeitsstörung heißt ja nicht, das alle
- reizbar, haltlos, fanatisch und aggressiv, sind….
- sondern auch krankhaft ängstlich, zurückgezogen, vermeidend, matt, zwanghaft u. a.
Wenn man dieses breite Spektrum der Wesensmerkmale
– von aggressiv-gewalttätig
– bis ängstlich-zurückgezogen
aufzeigt, dann sind die aggressiven Wesensmerkmale stark in der Minderheit,
Die so genannten ängstlich-vermeidenden und instabilen Persönlichkeitsstörungen sind dafür jedoch am häufigsten, doch die tun ja bekanntlich selten etwas.
- Das Stichwort “unbekannt” muss also einen anderen Grund haben. Vielleicht weil es:
- schwer eingrenzbar, nicht exakt definierbar, kaum einheitlich klassifizierbar ist.
Deshalb ist man auch bis heute noch nicht zu einem einheitlichen, Klassifikationssystem gelangt.
Trotz großer Bemühungen
- der Psychiatrischen Amerikanischen Vereinigung (APA), dem weltweit stärksten Psychiatrie-Verband mit seinem Standardwerk, dem (DSM-V)
- und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihrer Internationalen Klassifikation psychischer Störungen, dem – ICD-10….
… ist immer noch kein allgemein anerkanntes Erklärungsmodell zu den Persönlichkeitsstörungen (und früher so genannten Psychopathien) zur Zeit in Sicht.
Darum können die heutigen Überlegungen (auch meine) morgen bereits überholt sein.
Persönlichkeitsstörung: Begriff und Definition
Wenn man von der Persönlichkeitsstörung spricht sollte man sich zuerst auch einmal darüber klar werden, was man unter einer “Persönlichkeit” versteht. 🙂 Darum nun ein kleiner Überblick:
Persönlichkeit – Temperament – Charakter– Persönlichkeit wird in der Allgemeinheit Beispiele: Vielleicht kennst Du den Satz: „Jeder Mensch ist zwar eine Person, aber noch lange keine Persönlichkeit.“ – Die Psychiater und Psychologen verstehen unter einer Persönlichkeit ” nun folgendes:1. die Organisation einer Person in Bezug auf den Charakter, Temperament, Intellekt und Physis (körperliche Gesamt-Beschaffenheit eines Lebewesens). Also die Anpassung an die Umwelt. |
2. PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG und ihre Geschichte ….
Der Begriff der “Persönlichkeitsstörung” dient heute als Oberbegriff für alle behandlungsbedürftigen Abweichungen der Persönlichkeitsentwicklung.
Die Zahl der einzelnen Untergruppen war vor wenigen Jahrzehnten noch unüberschaubar groß,
… Sie wurde jedoch deutlich reduziert:
Am häufigsten werden aktuell noch folgende 11 Diagnosen verwendet:
- hyperthyme,
- paranoide,
- schizoide,
- hysterische,
- depressive,
- sensitive,
- asthenische,
- anankastische,
- erregbare,
- passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
- sowie die Soziopathie bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung.
Wichtig ist zu beachten….
- dass die Grenzen zwischen Persönlichkeitsstörung und einer gesunden Persönlichkeitsstruktur (“grenzwertige Persönlichkeit”) fließend sind.
- dass (manche) Persönlichkeitsstörungen und Neurosen sich weder begrifflich noch diagnostisch zu anderen Krankheitsbildern abgrenzen lassen.
Dass es auch Persönlichkeitsstörungen gibt
– welcher eher den Psychosen (Geisteskrankheiten wie Schizophrenie) nahe stehen
– dann solche, die nahe der Neurose (z. B. die Charakterneurosen) sind.
– Und natürlich die antisozialen und soziopathischen Persönlichkeitsstörungen mit ihrer entsprechenden kriminellen Energie.
– Die Ursache (Fachbegriff: Ätiologie)
Als Ursache nimmt man
- sowohl (erbliche)
- hirnorganische Faktoren (Entzündungen oder Verletzungen des Zentralen Nervensystems)
- und auch psychosoziale Faktoren (zwischenmenschlich, Erziehung, spätere (ungünstige) Einflussnahmen u.a.) an.
Das führte dann zu dem Begriff der “mehrschichtigen Entstehungsweise”.
– Der Verlauf
Die Persönlichkeitsstörung tritt häufig in der Jugend auf und verblasst oft im mittleren und höheren Lebensalter wieder (aber nicht immer).
Dies alles ist aber abhängig von der jeweiligen Art der Persönlichkeitsstörung:
- Manche werden tatsächlich “ruhiger”,
- Andere sind unverändert ausgeprägt oder werden gar noch “akzentuierter”, d. h. lästiger bis unerträglicher, und sogar riskant bis gefährlich.
(3) Die heutige Definition der Persönlichkeitsstörung
Heute gilt erstmal der folgende Definitions-Kompromiss:
Eine Persönlichkeitsstörung liegt vor, – wenn durch die Intensität der psychopathologischen Merkmale 1. erhebliche Beschwerden |
Nach wie vor steht jedoch immer noch die Frage im Raum:
- Was ist überhaupt normal, was grenz wertig und was bitteschön ist krankhaft?
Denn das Phänomen “Persönlichkeit” hat schon im gesunden Zustand eine Vielzahl an Eigenschaften,
die sich durch die Krankheit zusätzlich extrem erweitern.
- Was ist überhaupt normal, was grenz wertig und was bitteschön ist krankhaft?
Um die Verwirrung etwas herauszunehmen, versucht man
die Vielzahl der Persönlichkeitszüge auf ein paar wenige Dimensionen zu reduzieren.
Bei den so genannten 3-Faktoren-Persönlichkeitsmodellen geht es vor allem um Fachbegriffe wie
- Neurotizismus, Extraversion, Psychotizismus bzw.
- Freude/Schmerz, Eigen-/Fremdorientiertheit,
- Angst/ausagierendes Verhalten, Selbstbehauptung, soziales Eingebundensein
- Exzentrizität, dramatischer Affekt und Angst usw.
Bei den 5-Faktoren-Persönlichkeitsmodellen finden sich Begriffe wie
- Extraversion (nach Außen orientiert), emotionale Labilität, Neurotizismus, Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit
- sowie Extraversion, Neurotizismus, Aggressivität, Gewissenhaftigkeit, Offenheit (Gläubigkeit).
Und bei dem 7-Faktoren-Persönlichkeitsmodell ist die Rede von
- Schadensvermeidung,
- Neugierde
- Belohnungsabhängigkeit,
- Durchhaltevermögen
- Selbstlenkungsfähigkeit,
- Kooperativität und
- Selbsttranszendenz
Einige Bemerkungen dazu:
- Eine schizophrene Psychose mit Wahn, Sinnestäuschungen und Ich-Störungen,
- eine Depression mit starker Niedergeschlagenheit, , Problem-Grübeln, ständigem Kreisen um Schuld-Gefühlen,
- eine Zwangsstörung mit ihren teilweise widersinnigen Gedanken- und Handlungszwängen u.a.,
… sie alle haben nur wenig mit dem Wesen und Verhalten eines Menschen zu tun,
- der zwar seine Schwächen hat
- aber seelisch gesund ist.
Anders ist es bei den Persönlichkeitsstörungen!!!:
Hier weichen Charakter und Verhalten qualitativ, nicht stark von der Allgemeinheit ab.
Die Unterschiede liegen eher in der Quantität, also in Menge, Zahl und Ausprägung, was die Andersartigkeit der Persönlichkeitszüge ausmacht.
Das heißt:
- die Grenzen sind fließend und
- über manche dieser Besonderheit kann man diskutieren, (was gestern ein „no go“ war, kann heute “hip” sein,).
- Und man darf nicht vergessen, dass manche überzogene charakterliche Eigenart den Betreffenden sogar nützen / schützen kann, – und ihn zu großen Taten befähigt,
- zB. bei Politik, Militär und Wirtschaft, in Naturwissenschaft, Kunst und nicht zuletzt in dem religiösen Bereich.
(4) PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG Diagnose
“Psychopathen sind unbehandelbar”, so lautete damals die Aussage in der Anfangszeit der Psychotherapie.
Allerdings unterschied man bereits von Anfang zwischen
– einer (Erbanlage), was schwer zu behandeln erschien
– und den so genannten neurosen-psychologischen Ansätzen,
- bei denen man den Kern des Problems in den Auseinandersetzungen sah,
- die sich zwischen der gestörten Persönlichkeit und ihrer Umwelt ergaben
- (z.B. in der Lebens-Entwicklung und durch eine
- Traumatisierung in der Kindheit).
Solche Persönlichkeitsstörungen wurden dann als so genannte
– Symptom-Neurosen oder
– Charakter-Neurosen überwiegend psychoanalytisch behandelt.
Wenn sich diese dann als therapie-resistent zeigten, sprach man etwas abwertend von einer Soziopathie.
Inzwischen sieht man das alles etwas gelassener und positiver.
Vor allem setzt man neben der Psychotherapie, auch Medikamente ein.
Schauen wir und nun die Diagnose im Einzelnen an:
4.1. … zuerst die konkrete Differenzierung , d.h. um welche Unterform der Persönlichkeitsstörung handelt es sich.
Dabei muss man aber mit einer oft geringeren Introspektionsfähigkeit des Patienten rechnen, (das bedeutet, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ist es nicht immer möglich, durch eine “selbst-kritische Innenschau” erkennen zu helfen,
- wo die eigenen Probleme
- und die Reaktionen der Umwelt liegen.
4.2. Wichtig ist deshalb eine Fremd-Anamnese, d. h.
– die gezielte Befragung von Angehörigen
– oder nahen Bezugspersonen,
um die sozialen Konflikte zu erkennen.
4.3. Bei der eigentlichen Untersuchung wird man besonders
- auf vorübergehende Verstimmungen, also nicht nur z.B. eine Deprimiertheit, sondern auch auf selbst- und fremd-belastende Aspekte wie: missmutig, “schlecht gelaunt”, mürrisch, missgünstig, aufbrausend, aggressiv, versteckt oder offen feindselig u.a. eingehen.
- Dazu Angst-, und auch Panik-Reaktionen mit vorübergehender Störung der Realitäts-Kontrolle “.
- Zum Schluss folgt noch eine neurologische, ggf. auch internistische Zusatzuntersuchung
(z. B. frühkindliche Hirnschädigung, spätere Intoxikationsmöglichkeiten, d.h. Vergiftung durch Alkohol-, Nikotin- oder Rauschdrogen-Missbrauch.).
Denn es gibt auch körperlich begründbare Persönlichkeitsveränderungen, die man dann nicht durch reine Psychotherapie oder nur durch Psychopharmaka angehen kann, wenn man nicht zuvor die organische Ursache behoben hat.
5. ZUR PSYCHOTHERAPIE VON PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN
Bei der Psychotherapie, hängt die Wahl der Therapie
von der Form und
von der Schwere der psychischen Erkrankungen ab.
Die aktuell wichtigsten Therapieformen in dieser Hinsicht sind
- die so genannten kognitiv/verhaltenstherapeutischen und (unterstützenden) Techniken
- die tiefenpsychologische und/oder störungs-orientierten Behandlungsverfahren, die konkret auf die Problembereiche der gestörten Persönlichkeit eingehen.
- Daneben pädagogische Therapien um möglichst viel Selbsterfahrung und selbst(!) gesteuerte Veränderungsmöglichkeiten zu nutzen. Die Stärkung des „Ich“ stehen hier im Vordergrund.
Die Dauer einer solchen Therapie ist im Vergleich zu anderen leider sehr lang.
Es geht nämlich um die allmähliche und damit dauerhafte Umgestaltung vieler – oft negativer – Eigenschaften im Bereich des Erlebens, Befindens und sozialen Verhaltens – und das kostet eben deutlich mehr Zeit.
Dabei unterscheidet man mindestens 2 Gruppen persönlichkeitsgestörter Patienten:
- Jene Persönlichkeitsstörungen, die durch ein so genanntes rigides Über-Ich charakterisiert sind,
– also eine starre Kontroll- und Bestrafungs-Instanz besitzen
– die durch Selbstbestrafung, zur Internalisierung (also indem sich der Betreffende alle möglichen Konflikte zu eigen macht) neigen
– die eine ängstlich-unterwürfige Anpassung an die Umgebung zeigen.
- Jene Persönlichkeitsstörungen, die durch ein so genanntes rigides Über-Ich charakterisiert sind,
Hier fallen dann Fachbegriffe wie
– zwanghafte, dependente, vermeidende, schizoide, depressive oder masochistische Persönlichkeiten.
Bei dieser Gruppe wird man psychotherapeutisch vor allem versuchen Hemmungen und überzogene Selbstkritik
- durch eine zu strenge Gewissens-Instanz abzubauen,
- das Selbstvertrauen zu stärken und
- die Fähigkeit zur Austragung von Konflikten zu trainieren.
- Die zweite Gruppe sind Persönlichkeitsstörungen mit eher expansiven, irritierenden / verärgernd), mit hysterischen und antisozialen Zügen.
- Diese Menschen neigen zur Externalisierung (d. h. sie tragen ihre Konflikte nach außen),
- Sie neigen auch zu ungezügelter Aggressivität, dramatischen Darstellungen und zum Ausagieren von Trieben (können sich also nicht ausreichend in kritischen Situationen im Griff halten).
- Sie verlagern gerne die Schuld ihrer Probleme auf die Umgebung, von der sie auch noch häufig fordern, die solle sich ihnen anpassen, statt umgekehrt.
Diese Patienten müssen in der Psychotherapie lernen
- ihre Ansprüche zu reduzieren,
- sich zurückzunehmen,
- eine gewisse Anpassung an die Umgebung zu üben
- und die Probleme nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selber zu suchen.
In allen Fällen muss die Therapeut-Patient-Beziehungen besonders gut “funktionieren” (was zwar in jeder Psychotherapie die Grundlage ist, bei solch “schwierigen” Klienten, wie im Falle einer Persönlichkeitsstörung aber ganz besonders).
Manchmal können auch Paar-Gespräche hilfreich sein, besonders, wenn sich die Probleme auf die Partnerschaft konzentrieren.
Gut geeignet sind für viele Patienten die Gruppentherapien.
Das Stichwort lautet: “Am Beispiel-Lernen.
- d.h. die Beobachtung der anderen mit ihren negativen, Verhaltensweisen kann häufig Wunder wirken,
- indem der Betreffende plötzlich spürt, dass er ja selber nicht viel anders ist und häufig mit seiner Umgebung ähnlich umspringt.
In solchen Gruppen-Runden kann es auch mal etwas robuster zugehen:
- wenn die einzelnen z.B. gelernt haben nicht nur Kritik auszuteilen, sondern auch einmal einzustecken und vielleicht sogar langsam konstruktiv zu nutzen (Fachbegriff: positives Feed-back),
- dann kommt es schließlich auch zur therapeutisch erwünschten Stärkung positiver Verhaltensweisen.
Die Heilungsaussichten sind gerade bei Persönlichkeitsstörungen noch individueller zu beurteilen als es bei anderen psychischen Störungen der Fall ist. „Also von Fall zu Fall“….
– Gute Heilungschancen haben die histrionischen (damals hysterisch genannten), zwanghaften, dependenten und vermeidend–selbstunsicheren Persönlichkeitsstörungen. Unter den heutigen verbesserten Therapien immer mehr auch die Borderline– und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.
– Weniger günstig sind die Möglichkeiten bei den schizoiden, paranoiden, schizotypischen und besonders bei den antisozialen Persönlichkeitsstörungen.
Die Heilungschancen werden nochmals besser, je früher die Patienten in der Therapie bereit sind,
- die Externalisierung (“es sind nur die anderen …”) aufzugeben,
- störende Eigenschaften als ich-dyston (mit meiner eigentlichen Wesensart im Grunde nicht vereinbar) zu erleben und
- einen Leidensdruck zuzulassen, den sie früher durch Fremd-Beschuldigungen gerne zu mildern versuchten.
Dieser Leidensdruck (wenn Du erst mal tief im Dreck liegst) führt in vielen Fällen
- zur Selbstbesinnung und Um-Orientierung im zwischenmenschlichen,
- d.h. partnerschaftlichen, familiären und beruflichen Bereich.
Das heißt aber auch, dass häufig mit entsprechend negativen Emotionen „bezahlt“ werden muss,
- z.B. Resignation, Niedergeschlagenheit, Angst, mit Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstzweifeln.
Doch genau diese Symptome sind später in der Behandlung der Treibstoff / die Motivation in der Therapie und verbessern die Heilungsaussichten.
6. Psychopharmaka und die Persönlichkeitsstörungen
Besonders bei den psychogenen (den scheinbar seelisch ausgelösten) Störungen scheint es zuerst nicht einzuleuchten, mit Medikamenten (“Chemie”) einzugreifen.
So wurde es vor allem früher gesehen – und auch entsprechend praktiziert.
Inzwischen aber weiß man: Damit vergibt man zumindest einen Teil des möglichen Behandlungserfolgs, und der ist gerade bei Persönlichkeitsstörungen extrem mühsam zu erreichen.
Die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es im Grunde
– keine absolut “reine”, seelisch zu interpretierende Störungen gibt.
Die Erklärung hierfür:
⇒ Wie soll man sich auch anders die geistigen und emotionalen Funktionen erklären, als über die Schiene biochemischer Prozesse im Gehirn?
Für die organischen Funktionen leuchtet das ja noch ein:
Wenn ein Muskel bewegt werden soll, ist das nur über einen Nerven-Impuls möglich, der in der Regel vom Gehirn selber kommt.
Der Beweis ist einfach: Wenn die zentral-nervösen Strukturen im Gehirn nicht mehr funktionieren, dann geschieht nichts mehr, der Muskel ist gelähmt.
Vergleichbar kann man dies bei kognitiven und emotionalen Funktionen sehen, also bei Geist und Emotion.
Hier ist es zwar komplizierter:
Aber die Leistung,
- wie z.B. Kreativität / Heiterkeit bis zur Manie einerseits
- und krankhafte Teilnahmslosigkeit und Depression andererseits
- von Wahn und Sinnestäuschungen nicht zu reden,
die müssen sich auch irgendwie biochemisch erklären lassen, ob es einem das nun zusagt oder nicht.
Und dafür sieht man heute vor allem die so genannten Neurotransmitter, also Überträger- oder Botenstoffe als zentral entscheidend an.
Im Grunde genommen ist dieses Wissen alt, nämlich rund 100 Jahre. Es basiert gerade bei den Persönlichkeitsstörungen auf der Überlegung,
- dass es sich bei diesen abweichenden Verhaltensweisen
auch um biologisch fundierte Zustände handeln müsse,
- die ererbt oder
- durch später erworbene Unregelmäßigkeiten / Störungen bedingt sind
Man war damals der Meinung, dass viele Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathen eigentlich unvollständige Ausprägungen der beiden großen Gruppen endogener (von innen kommender) Krankheiten anzusehen sind,
- nämlich der (1) Schizophrenien sowie
- (2) affektiven Psychosen (endogenen Depressionen und manischen Hochstimmungen).
Deshalb schlug man schon früh den Einsatz von Psychopharmaka vor,
- vor allem dann, wenn das Leidensbild schizophrene, depressive oder manisch überzogene Symptome aufwies.
- Dabei hatte man vor allem das Ziel, die Vulnerabilität (Verwundbarkeit) für affektive (gemütsmäßig) und kognitive (geistige) Dysfunktionen zu reduzieren.
Tatsächlich ist die pharmakologische Behandlung von Persönlichkeitsstörungen heute Standart.
Sie ist keine(!) Konkurrenz zur Psychotherapie.
Eher das Gegenteil ist der Fall:
- Sie öffnet in vielen Fällen der Psychotherapie erst die Tür,
- Und hilft sehr gut in der Krisenintervention (z. B. bei Selbst- und Fremdgefährdung, d. h. Suizidgefahr).
Natürlich muss sie – wie überall sonst auch – kritisch beurteilt werden in Bezug auf
- Notwendigkeit (da in der Regel lang dauernd) und
- Nebenwirkungen / Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln.
- Und auch wegen der Suchtgefahr.
Deshalb ist man mit Beruhigungsmitteln vom Typ der Benzodiazepin-Tranquilizer gerade bei Persönlichkeitsstörungen eher zurückhaltend,
Diese sollten maximal zur raschen Angstlösung und Aggressionsmilderung in Krisensituationen eingesetzt werden.
Keine Suchtgefahr besteht dagegen bei Antidepressiva.
Das gleiche gilt für die antipsychotischen Neuroleptika,
- die man als hochpotente Neuroleptika gegen die Symptome einer Psychose (Geisteskrankheit wie Schizophrenie oder organischen Psychosen) nutzen kann,
- Hinzu kommen die mittel- und niederpotente Neuroleptika mit weniger stark ausgeprägter antipsychotischer, jedoch mehr beruhigender Wirkung.
- Besonders günstig sind die inzwischen entwickelten so genannten atypischen Neuroleptika,
– die ein breites Wirkungsspektrum ohne die sonst gefürchteten Nebenwirkungen haben (dies waren häufig Bewegungsstörungen).
DIE WICHTIGSTEN PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNGEN, WIE SIE HEUTE DIAGNOSTIZIERT WERDEN
7.1. Paranoide Persönlichkeitsstörung
Die paranoide (wahnhafte) Persönlichkeitsstörung zeigt sich
- durch die durchgängige und ungerechtfertigte Neigung,
- die Handlung anderer als absichtlich bedrohlich zu deuten,
- durch Misstrauen und aggressive Reaktionen.
– Beschwerdebild:
Menschen mit paranoider Persönlichkeitsstörung
fühlen sich dauernd angegriffen,
- Selbst neutrale oder gar freundliche Reaktionen anderer werden als feindselig / kränkend interpretiert, harmlose / bedrohlich oder auch abwertend gedeutet.
- Das sprichwörtliche Misstrauen, richtet sich auf die Treue des Lebenspartners, die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern, die Zurückhaltung von Nachbarn u.a.
- Der typisch wahnhafte Denkstil der paranoiden Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch eine rastlose, Suche nach verborgenen / negativen Bedeutungen.
Die Folge von alledem ist eine dauerhaft strapazierte Aufmerksamkeit mit chronisch psychischer Anspannung, … Und in der Folge kommen die Erschöpfungszustände (“wer hält das schon aus, ständig diese Anfeindungen und Schikanen”).
– Behandlung:
– In der Therapie versucht man zuerst eine offene, vertrauensvolle Beziehung herzustellen und in einem für den Patienten sicheren Rahmen die Neigung zur Fehlinterpretationen anzusprechen.
- Vor allem geht es darum, den Betroffenen das Gefühl zu nehmen, dass er im Grunde alleine ist (Freund-Feind-Denken: “allein gegen alle”).
- Hilfreich können antipsychotische Neuroleptika werden, besonders wenn das wahnhafte Beschwerdebild alles andere an Zwischenmenschlichem blockiert.
- Sonderformen der paranoiden Persönlichkeitsstörung mit einem Hang zu fanatisch-querulatorischer Reaktionsweise, können mit den so genannten Phasenprophylaktika Lithium oder Carbamazepin behandelt werden, die sich in der Vorbeugung bzw. im Rückfallschutz von manisch-depressiven Erkrankungen bewährt haben.
- Verhaltenstherapeutisch versucht man die Empfindlichkeit für Kritik zu verringern.
- Dafür gibt es ähnliche Behandlungsverfahren wie bei der Therapie von Angststörungen,
- z.B. Entspannungsübungen in Verbindung mit einer Hierarchie von kritischen Äußerungen
(“ich bin ganz ruhig, Kritik kann mir nichts anhaben”).
7.2 Schizoide Persönlichkeitsstörung
Die schizoide Persönlichkeitsstörung (schizoid, also einem schizophrenen Krankheitsbild ähnlich) äußert sich vor allem
– durch soziale Kontaktschwäche sowie eingeschränkte gemütsmäßige Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit.
– Beschwerdebild:
- Menschen mit schizoider Persönlichkeitsstörung neigen zu sozialer Isolation und Einzelgängertum.
Sie haben oder wünschen kaum engere Beziehungen - Sie sind oft gleichgültig gegenüber sozialen Regeln, Lob und Kritik.
- An typischen Vergnügungen haben sie kaum Interesse, und wenn, dann nur wenn sie es alleine machen können.
- Sie wirken kühl, gemütsmäßig distanziert, unnahbar.
- Häufig ist ihre Mimik, Gestik, / Körpersprache) eingeschränkt.
- Im Berufsleben können sie jedoch kompetent erscheinen.
- Menschen mit schizoider Persönlichkeitsstörung neigen zu sozialer Isolation und Einzelgängertum.
Das schizoide Verhaltensmuster ist zwar auch durchgängig, wie es bei allen Persönlichkeitsstörungen vorkommt,
– dafür ist es deutlich schwächer ausgeprägt als bei den so genannten schizotypischen / schizophrenen Formen.
– Problematisch wird die Verbindung aus schizoider und antisozialer Persönlichkeitsstörung. Hier kann die Verbindung aus sozialer Bindungsschwäche und der Mangel an Empathie (Einfühlungsvermögen) verheerende Handlungen provizieren.
– Behandlung:
Therapeutisch gelten bei Behandlung der schizoiden Persönlichkeitsstörung ähnliche Bedingungen wie bei der schizotypischen Störung.
Schizoide Patienten profitieren am ehesten von den Vorteilen einer Gruppentherapie.
Da sie aber relativ selten in soziale Konflikte verwickelt sind und kaum Leidensdruck äußern, kommen diese Persönlichkeitsstörungen nur selten in eine Therapie.
7.3. Schizotypische Persönlichkeitsstörung
Die schizotypische (oder schizotype) Persönlichkeitsstörung zeigt sich durch folgendes
– Beschwerdebild:
– Eigentümlichkeiten des Denkens,
– der äußeren Erscheinung
– des Verhaltens
– Defizite in den zwischenmenschlichen Beziehungen.
Dabei fallen enge Verbindungen mit den schizophrenen Psychosen auf, und zwar sowohl im Erscheinungsbild als auch in der erblichen Belastung.
Dies hat sich durch verschiedene Adoptionsstudien bestätigt.
Enge Beziehungen und damit auch diagnostische Überlappungen gibt es vor allem mit der Borderline-Persönlichkeit.
– Behandlung:
Ähnlich wie bei der paranoiden und schizoiden Persönlichkeitsstörung geht es auch hier erst einmal um den vorsichtigen Aufbau einer tragfähigen Beziehung.
Das ist in diesem Fall besonders schwierig, denn die schizotypischen Persönlichkeitsstörungen zeigen den stärksten Beeinträchtigungsgrad auf, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich.
Dabei ist vor allem die ausgeprägte Angst vor Nähe und Bindung zu berücksichtigen.
So kann die Therapeut-Patient-Beziehung nur langsam intensiviert und der Kontakt nur allmählich enger werden.
Medikamentös sind vor allem antipsychotisch wirksame Neuroleptika gefragt.
In Einzelfällen wird man auch auf bestimmte Antidepressiva (trizyklische, MAO-Hemmer (Monoaminooxidase-Hemmer) und SSRI-Antidepressiva) zurückgreifen,
- vor allem wenn sich die Unfähigkeit, Freude zu empfinden (Fachbegriff: Anhedonie),
- das Fehlen von Vergnügen in Situationen, die normalerweise mit Lustgefühlen verbunden sind
- sowie Antriebsmangel und Rückzugsgefahr nicht anders in den Griff bekommen lassen.
Wichtig ist aber in der Therapie auf mögliche überschießende (Gegen-) Reaktionen zu achten.
Verhaltenstherapeutisch
geht es bei den schizotypischen Persönlichkeitsstörungen vor allem
- um das Training der sozialen Fertigkeiten (wie komme ich mit dem Alltag und seinen “banalen” Anforderungen zurecht)
- die Verbesserung der kognitiven (geistigen) Leistungsfähigkeit.
- das Training zur Bewältigung furchtsamer (Rückzugs-)Reaktionen im zwischenmenschlichen Bereich von Familie, Nachbarschaft, Beruf u.a.
7.4. Antisoziale Persönlichkeitsstörung
Die antisoziale Persönlichkeitsstörung (früher Soziopathie genannt) lässt sich mit am sichersten diagnostizieren.
Das liegt an ihrem häufig sehr eindrucksvollen (negativ auffallenden)
– Beschwerdebild:
- verantwortungsloses und antisoziales (gegen jede gesellschaftliche Regeln verstoßendes) Verhalten, und das egal in welcher Altersstufe.
- Vor allem wegen
- ihrer Impulsivität
- ihrer Unzuverlässigkeit,
- Bindungsschwäche,
- krankhafter Ichbezogenheit
- und wegen des Mangels an Schuldgefühlen therapeutisch kaum beeinflussbar zu sein (s.u.).
- Vor allem wegen
Zusätzliche Probleme, entstehen oft durch den gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Rauschdrogen, Tabak und Medikamenten. Die Heilungsaussichten sind deshalb in aller Regel ungünstig.
– Behandlung:
Therapie wird häufig im Rahmen von Vollzugsanstalten oder in der forensischen Psychiatrie durchgeführt
Medikamentös gibt es für antisoziale Persönlichkeiten keine speziellen Therapievorschläge.
Reizbarkeit und Aggressivität werden – soweit möglich – durch antipsychotische Neuroleptika und die Phasenprophylaktika Lithium und Carbamazepin (leicht) gebessert.
Das eigentlich antiepileptisch zum Krampfschutz eingesetzte Carbamazepin wird i.d.R. dann empfohlen, wenn sich im Hirnstrombild (EEG) bei Patienten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung eine so genannte Temporallappen-Schädigung feststellen lässt
(Schädigungen im Temporal- oder Schläfenlappen des Gehirns sind für eine ganz besonders auffällige und manchmal ungewöhnliche Form der Epilepsie verantwortlich,
- was sich gerade durch solche Antiepileptika behandeln lässt).
Verhaltenstherapeutisch
ist bei den antisozialen Persönlichkeitsstörungen eine Erkenntnis von nachteiliger Bedeutung, die sich auch nicht einfach so “wegtrainieren” lässt, zumindest bei dem überwiegenden Teil der Betroffenen:
Diese “Soziopathen” sind durch Strafreize
- weniger gut konditionierbar (prägbar)
- Sie lernen schlecht aus Erfahrungen, und seien sie noch so schmerzlich.
- Dazu kommt das Risiko-Suchtverhalten, das weit über dem Durchschnitt liegen kann (was offenbar auch mit bestimmten Funktionsstörungen des Gehirns zu tun hat).
Es läuft hier immer wieder auf eine Kombination aus
- Psychotherapie,
- Konditionierungsverfahren,
- Belohnung und Beeinflussung durch Eltern und Beziehungspersonen
- Und entsprechenden Medikamente hinaus – leider oft nur mit begrenztem Erfolg.
7.5. Borderline-Persönlichkeitsstörung
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (engl.: borderline = Grenzlinie, eine fließende Krankheits-Grenze zwischen Psychose (Geisteskrankheit) und rein seelisch bedingter neurotischer Störung) ist diagnostisch zu einer extrem unscharfen, vielschichtigen Sammel-Kategorie geworden – begleitet von vielen Fehldeutungen und Irrtümern.
Dass man in der APA und WHO diese übergeordnete Kategorie der Persönlichkeitsstörungen ins Gespräch bringt, hat sogar zu noch mehr Verwirrung als Klarheit beigetragen.
– Beschwerdebild:
Die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung (APA) beschreibt Borderline
- mit einem durchgängigen Muster von Instabilität hinsichtlich
- Selbstbild (wer bin ich eigentlich?),
- Stimmung
- und zwischenmenschlichen Beziehungen.
- mit einem durchgängigen Muster von Instabilität hinsichtlich
Es handelt sich um
- eine sogenannte Identitätsstörung,
- d.h. ausgeprägte und andauernde Instabilität der Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung (was bin ich, was bin ich wirklich, wie sehe ich mich und wie sehen mich andere?).
- Impulsivität in potentiell selbstschädigenden Bereichen:
- Geldausgabe, Sexualität, Alkohol-, Rauschdrogen-, Medikamenten- und Nikotinmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, “Fressanfälle”
- u.a. einer Neigung, sich ständig in intensive, dafür aber letztlich instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge entsprechender psychosozialer bzw. gemütsmäßiger Krisen.
- Einer der Gründe des ständigen Wechsels liegt in der Neigung die Menschen entweder zu idealisieren oder zu entwerten.
- Und in der Tendenz zu ewigen Streitereien und Konflikten mit anderen, vor allem dann, wenn die impulsiven (“unvernünftigen”) Wertungen und Handlungen unterbunden oder getadelt werden.
- Vor allem aber auch in der Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit der Unfähigkeit, solch explosives Verhalten wirkungsvoll zu kontrollieren (z. B. heftige Zornesausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen).
- Ferner Schwierigkeiten, Handlungen oder Reaktionsweisen beizubehalten, die nicht unmittelbar belohnt werden.
- Dazu eine unbeständige, ja unberechenbare Stimmung immer wiederkehrende reaktive Verstimmungen (z. B. hochgradige Missstimmung, Reizbarkeit oder aggressive Angstreaktionen, die gewöhnlich einige Stunden, selten mehr als einige Tage andauern).
- Schließlich ein fast chronisches Gefühl innerer Leere, wiederholte Selbstverletzungsversuche, Selbstmordandeutungen oder -drohungen, mehrfache suizidale Handlungen, manchmal sogar durch wahnhafte Vorstellungen ausgelöst.
Es besteht eine enge Beziehung
– zu den Gemütsstörungen (affektiven Störungen wie Depressionen und Manie)
– sowie zu den schizophrenen Psychosen.
– Und im Persönlichkeitsbereich fallen immer wieder Überschneidungen auf mit den schizotypischen, histrionischen (früher hysterischen) und antisozialen Persönlichkeitsstörungen.
– Behandlung:
Die Therapieerfolge halten sich zwar noch in Grenzen… jedoch werden diese immer sichtbarer!!! Es gibt bereits einige wenige Borderline-Spezialstationen.
Die besten Erfolge hat man
- durch mehrjährige (!) und nicht zu dicht aufeinander folgende Psychotherapie-Stunden,
- die sich vor allem der ständig wechselnden Problembereiche im Leben des Patienten widmen.
Ein spezifisches Behandlungsprogramm ist beispielsweise die so genannte dialektisch-behaviorale Therapie (DBT), in der man verschiedene verhaltenstherapeutische Modelle und Methoden kombiniert.
Das für Borderline-Patienten typische “Schwarz-weiß-Denken” wird bei dieser Therapie vor allem
- durch dialogische Vermittlung abgebaut,
- d.h. statt des “entweder-oder” ein “sowohl-als-auch”,
- was den Alltag erleichtert und die “sturen” und selbstzerstörerisch kompromisslosen Reaktionen reduziert.
- durch dialogische Vermittlung abgebaut,
Spezifische Behandlungs-Ansätze in der Einzel- und Gruppentherapie
- konzentrieren sich vor allem auf problematische Formen der Beziehungsgestaltung (das Hauptproblem der Borderline-Patienten),
- was sich am besten im Kontakt mit den primären Bezugspersonen (Partner, Eltern, Geschwister, Kinder, aber auch Nachbarn und Arbeitskollegen) bearbeiten lässt.
- konzentrieren sich vor allem auf problematische Formen der Beziehungsgestaltung (das Hauptproblem der Borderline-Patienten),
Bei den Therapeuten ist eine ständige “Wachsamkeit” geboten, – die zwar “verstehende Nähe” erlaubt, gleichzeitig aber klare Grenzen setzen müssen.
Besonders dem bekannt manipulativen Verhalten der Borderline-Patienten muss widerstanden werden:
- (heute der “wunderbarste Arzt” und die “einzige Rettung”, morgen die “größte Enttäuschung” u.ä.).
Medikamentös geht man bei Borderline-Patienten sehr vorsichtig vor.
- Beruhigungsmittel sind schon wegen ihrer Sucht-Gefahr ein Problem und helfen auf Dauer auch nicht weiter, schon gar nicht bei dieser speziellen Wesensart.
- Geht die Borderline-Symptomatik mehr in Richtung schizophrener Psychose oder ängstlich-depressiver Ausprägung kann man versuchen
- mit Neuroleptika oder Antidepressiva etwas gegenzusteuern (wobei sich aber gerade Borderline-Patienten oft als ausgesprochen nebenwirkungs-empfindlich erweisen).
- Bei chronischer Gemüts-Instabilität und vor allem bei ausgeprägter und damit auch gesellschaftlich schädigender Impulsivität bis Aggressivität werden auch Lithiumsalze oder Carbamazepin
7.6. Histrionische Persönlichkeitsstörung
Die histrionische Persönlichkeitsstörung (vom lateinischen: histrio = Schauspieler, Gaukler) war früher als die Hysterie bekannt. Hysterisch heißt heute histrionisch.
Kurz-Definition:
- Ein durchgängiges Muster emotionaler Instabilität mit übermäßigem Verlangen nach Aufmerksamkeit.
Jetzt ein etwas ausführlicheres Beschwerdebild, um das – recht schillernde – Phänomen der “Hysterie” etwas konkreter zu beschreiben:
– Neigung zu dramatischen Auftritten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen;
Sie imponieren anfangs durch ihren Enthusiasmus und schlüpfen gerne in die Rolle einer “Stimmungskanone”.
Wenn sie die Aufmerksamkeit zu verlieren drohen, können sie Zuflucht zu dramatischen Reaktionen nehmen indem sie:
– Geschichten erfinden, eine Szene machen.
Bei Vorgesetzten, hohen Persönlichkeiten oder dem Therapeuten
- schmeicheln sie sich gerne mit Geschenken ein
- oder ziehen die Aufmerksamkeit mit dramatischen Beschreibungen ihrer seelischen oder körperlichen Beschwerden auf sich.
– Ihr Auftreten und Verhalten ist in sexueller Hinsicht oft unangepasst / provozierend bis hin zu verführerisch.
– Dies betrifft nicht nur Personen, an denen die Betroffenen ein sexuelles Interesse haben, sondern auch andere zwischenmenschliche, soziale oder berufliche Beziehungen.
– Zur Aufmerksamkeits-Zentrierung auf die eigene Person wird konsequent die eigene Erscheinung eingesetzt, d. h. man versucht unaufhaltsam durch entsprechendes Auftreten zu beeindrucken.
- Komplimente werden schnell und fast unersättlich aufgegriffen,
- Kritik jedoch genauso schnell ärgerlich, gereizt oder aggressiv zurückgewiesen.
– Der Sprachstil ist übertrieben ausdrucksreich bis “blumig”, und wenig detailliert.
– Charakteristisch ist eine Neigung zur Dramatisierung, zu theatralischem Auftreten und übertriebenem Gefühlsausdruck.
Beispiele: exaltierte (überspannte, überschwängliche) Begrüßungszeremonien, unkontrollierte Weinkrämpfe bei banalen Anlässen, auch Wutausbrüche u.a.
Dies alles ist so schnell “an- und ausschaltbar“, dass umgehend der Gedanke in der Umgebung aufkommt, diese Gefühle sind nur “strategisch” / vorgetäuscht.
– Hohe (Beeinflussbarkeit), d. h. Standpunkte und Gefühle können leicht von anderen oder der Mode beeinflusst werden.
– Sie sehen ihre Beziehungen persönlicher und gemütsintensiver (bis zur “Gefühlsduselei”) und flüchten, wenn sie sich enttäuscht sehen, in romantische Phantasien.
– Behandlung:
(1) Psychotherapeutisch
- in Form von Einzel- und Gruppentherapie,
- in denen ein “normaler” zwischenmenschlicher Kontakt erlernt und der alte (hysterischen) Beziehungsstil abgelegt wird.
- in Form von Einzel- und Gruppentherapie,
Ähnlich wie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung muss der Therapeut auch hier ständig aufpassen,
- nicht durch das Verhalten des Patienten beeinflusst, gelenkt und therapeutisch missbraucht zu werden.
(2) Medikamentös sollte man sich bei histrionischen Persönlichkeitsstörungen zurückhalten.
Bei der Sonderform der so genannten “hysteroiden Dysphorie” (also einer ständigen Miss-Stimmung dieser Patienten)
- wurden auch mal Antidepressiva empfohlen, besonders so genannte MAO-Hemmer
7.7. Narzisstische Persönlichkeitsstörung
Narzissmus ist eine Mischung aus
– Selbstverliebtheit,
– Selbstbezogenheit,
– Selbstbewunderung und damit Egoismus.
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigt darum folgendes
– Beschwerdebild:
- unrealistische Größen-Phantasien,
- unkritisches, selbstbezogenes Verhalten bei gleichzeitiger Überempfindlichkeit gegenüber der Einschätzung durch andere.
- Was besonders auffällt, ist ein Mangel an Empathie, also an Einfühlungsvermögen für andere (“ich-ich-ich”).
Die modernen Definitionen sprechen
- von einem seelisch tief greifenden Muster von Großartigkeit (in Phantasien oder Verhalten)
- sowie einem ständigen Bedürfnis nach Bewunderung – und alles ohne das erwähnte Einfühlungsvermögen für andere.
Folgende Kriterien werden als wesentlich erachtet:
- Grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (übertreibt z. B. die eigenen Leistungen und Talente);
- erwartet ohne entsprechende Leistung als überlegen anerkannt zu werden.
- Stark eingenommen von der Phantasie grenzenlosen Erfolgs, von Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe.
- Glaubt etwas Besonderes und Einzigartiges zu sein (und auch deshalb nur von anderen, ebenfalls besonderen und einzigartigen Personen oder Institutionen verstanden zu werden bzw. nur mit diesen verkehren zu können).
- Verlangt ständig nach übermenschlicher Bewunderung und
- legt ein überzogenes bis lächerliches Anspruchsdenken an den Tag,
- B. übertriebene Erwartungen an eine besonders bevorzugte Behandlung oder das grundsätzliche Eingehen auf die eigenen Erwartungen.
- Gilt schließlich in zwischenmenschlicher Hinsicht als ausbeuterisch, d. h. zieht nur Nutzen aus anderen und ist nicht willens, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen zu erkennen, anzuerkennen oder zu respektieren, geschweige denn sich mit ihnen zu identifizieren.
- Dafür ist er häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn.
- Nach außen hin fällt er vor allem durch seine arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen auf und merkt vor allem nicht, dass man ihn auszugrenzen beginnt.
Ein spezielles Problem ist
- die Neigung zur Selbstbeschädigung (auch durch Alkohol, Tabak, Medikamente, gesundheitsschädigendes Verhalten in sportlicher oder sonstiger Hinsicht) bis hin zur ernsten Suizidalität (Selbsttötungs-Impulse).
- Dies vor allem bei ausgeprägter Kränkbarkeit.
- die Neigung zur Selbstbeschädigung (auch durch Alkohol, Tabak, Medikamente, gesundheitsschädigendes Verhalten in sportlicher oder sonstiger Hinsicht) bis hin zur ernsten Suizidalität (Selbsttötungs-Impulse).
Durch ihre Art viel zu fordern und wenig zu geben, sind narzisstische Persönlichkeiten in ihrer Umgebung wenig beliebt, was dann auch einen Teufelskreis anheizt.
– Behandlung:
Es handelt sich also um eine problematische Charakterstruktur, die – wenn überhaupt – am ehesten durch gezielte psychotherapeutische Maßnahmen beeinflusst werden kann.
Wegen der geringen Frustrationstoleranz (raschen Kränkbarkeit) der Patienten
- empfiehlt sich eher die Einzeltherapie, besonders zu Beginn der Behandlung.
Hier muss man dann auch rasch herausfinden
– wie viel Konfrontation (d. h. die problematischen Wesenszüge herausarbeiten und damit konstruktiv zu ändern versuchen) und
– wie viel stützende Zuwendung nötig/möglich sind – je nach Belastbarkeit.
Medikamentös
sollte man eher zurückhaltend sein.
- Bei ängstlich-deprimierten Dauerverstimmungen werden aber mitunter Antidepressiva (MAO-Hemmer und SSRI-Antidepressiva) empfohlen,
- bei ausgeprägten und insbesondere häufigen Hochs und Tiefs (Gemütslabilität) gelegentlich auch Lithiumsalze.
7.8. Vermeidend-selbstunsichere Persönlichkeitsstörung
Bei der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung (auch ängstliche vermeidende Persönlichkeitsstörung genannt) handelt es sich um Menschen,
– die aus Angst vor Zurückweisung oder Kritik jegliche zwischenmenschliche Kontakte meiden bzw. nur dann eingehen, wenn sie sich sicher sind, dass sie Erfolg haben oder zumindest akzeptiert werden.
– Beschwerdebild:
Zwar dominiert der “größte Wunsch in meinem Leben” im Sinne von “mehr Zuwendung durch andere”,
- doch sind die Betroffenen so unsicher, schüchtern und damit nervös-angespannt, furchtsam, besorgt und von der Vorstellung geplagt sozial minderwertig, unattraktiv, zumindest aber den anderen unterlegen zu sein,
- dass sie sich im zwischenmenschlichen Kontakt tatsächlich als wenig “kompetent” fühlen und sich deshalb überhaupt nicht “aus ihrer Deckung heraustrauen”.
Unbekannte Aufgaben nehmen sie nur widerwillig auf sich, selbst wenn sie anderen als alltäglich bis harmlos erscheinen,
– weil sie die Furcht vor Fehlern als so unüberwindlich empfinden, dass sie solche “Fehltritte” dann auch tatsächlich begehen bzw. – als fatale Schlussfolgerung – lieber erst gar nicht antreten.
Dies alles führt zum Vermeiden sozialer oder beruflicher Aktivitäten,
– zum Austrocknen zwischenmenschlicher Kontakte aus Furcht vor Kritik, Missbilligung oder Zurückweisung. Und schließlich zu Einschränkungen im Lebensstil, der zuletzt nur noch von dem überzogenen Bedürfnis nach Sicherheit geprägt ist.
– Bei der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung gibt es viele Ähnlichkeiten und Parallelen zu einer vergleichbaren Angststörung, — der sozialen Phobie.
– Behandlung:
Patienten mit einer vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung würden diesen Teufelskreis natürlich gerne durchbrechen,
stehen aber durch ihre Wesensart der dafür notwendigen therapeutischen Beziehung im Wege,
- vor allem was ihr geringes Selbstbewusstsein (“das schaffe ich ohnehin nicht”)
sowie die Furcht vor Enttäuschung, Zurückweisung und Kritik erschwert (“was wird man alles von mir verlangen”).
- vor allem was ihr geringes Selbstbewusstsein (“das schaffe ich ohnehin nicht”)
Deshalb empfiehlt sich zunächst eine Einzeltherapie,
- bei der es vor allem um stützende Zuwendung geht, damit der Betroffene allmählich Vertrauen fassen und eine gewisse Belastbarkeit entwickeln kann.
- Als sinnvoll erwiesen haben sich aber auch verhaltenstherapeutische Konzepte in der Gruppentherapie, wobei man sich untereinander aufbauen, stützen und zu helfen versucht.
Dominieren ängstlich-depressive Verstimmungen, kann (!) man im Einzelfall auch Medikamente erwägen, vor allem Antidepressiva.
7.9. Dependente Persönlichkeitsstörung
Dependent kommt vom lateinischen dependere = abhängen und bedeutet Abhängigkeit. Eine dependente Persönlichkeitsstörung, auch als abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung bezeichnet,
- ist durch ein Gefühl der Unfähigkeit charakterisiert, das eigene Leben selbstständig zu führen.
- In der Selbsteinschätzung beurteilen sich die Betroffenen als schwach und hilflos,
- weshalb sie in allen Lebenssituationen auf die Unterstützung durch andere, angewiesen sind.
- Außerdem sind sie ständig von großer Trennungsangst, Gefühlen der Hilflosigkeit und Inkompetenz geplagt, wobei sich die Kraftlosigkeit mal mehr im geistigen und dann wieder mehr im gemütsmäßigen Bereich äußert.
- ist durch ein Gefühl der Unfähigkeit charakterisiert, das eigene Leben selbstständig zu führen.
Deshalb sind Menschen mit einer depentenden Persönlichkeitsstörung auch nur wenig bereit, Selbstverantwortung zu übernehmen, selbst wenn man ihnen dazu den Weg ebnet.
In der Zweierbeziehung besteht vor allem eine ständige Angst vor Verlust bzw. allein gelassen zu werden.
– Behandlung:
Diese für die zwischenmenschliche Durchsetzungsfähigkeit negativen Grundeigenschaften sind aber erst einmal günstig, wenn es um die Aufnahme einer therapeutischen Beziehung geht.
Die Betroffenen sind freudig bereit, sich helfen zu lassen, ja anpassungsfähig und zuverlässig, was die Bedingungen einer Psychotherapie anbelangt.
Die Gefahr besteht allerdings darin, dass der Patient durch die Behandlungssituation in ein neues Abhängigkeitsverhältnis gerät!!!
Das eigentliche Behandlungsziel ist deshalb die Verbesserung von Selbstvertrauen und Autonomie.
Allmählich gilt es die positiven Züge der dependenten Persönlichkeitsstörung zu nutzen,
- nämlich die bekanntermaßen gute soziale Integration und meist hohe Leistungswilligkeit
- (um sich damit die Sympathie der anderen zu sichern).
Hilfreich sind Rollenspiele und Selbstbehauptungs–Training, wobei man langsam von der Einzelbehandlung über die Einbeziehung des Partners bis zur Gruppentherapie gelangen sollte.
Medikamente sind nur selten nötig,
- am ehesten bei depressiven Stimmungsschwankungen, die zeitlich begrenzt durch Antidepressiva aufgefangen werden können.
7.10. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
Die zwanghaften Persönlichkeitsstörungen (auch anankastische Persönlichkeitsstörungen genannt) zeigen viele Parallelen zu den selbstunsicheren und abhängigen, kurz asthenischen Formen.
Sie nehmen jedoch wegen ihres besonderen Leidensbildes eine Sonderstellung ein.
– Beschwerdebild:
Das wichtigste Merkmal ist eine dauerhafte Neigung zu Perfektionismus und damit zu Unflexibilität.
Es besteht ein Hang zu Zwangsstörungen, Depressionen und manchen schizophrenen Beeinträchtigungen.
- Charakteristisch ist ein ständiges Gefühl von Zweifel
- verbunden mit einem Hang zu übertriebener Gewissenhaftigkeit,
- ständigen Kontrollen
- und damit zu unnötiger Über-Vorsicht, Starrheit,
- überzogene Vorliebe für Details, Regeln, Listen, Schemata und organisatorische Aspekte mit unergiebiger Dominanz des Faktors “Ordnung”.
- Nicht selten die Neigung zu Perfektionismus.
Ihre Vorliebe für “Produktivität” geht auf Kosten von Genussfähigkeit / Freude und vor allem zwischenmenschliche Beziehungen.
– Dazu sind sie häufig pedantisch, übertrieben, angepasst, und sogar stur, falls andere ihren eigenen Lebensstil praktizieren wollen.
Und dies bis hin zu sich grenzwertig aufdrängenden unerwünschten Gedanken oder Impulsen, wie sie bei der eigentlichen Zwangsstörung typisch sind.
– Behandlung:
Meist verhaltenstherapeutische Trainingsprogramme zur Verbesserung der sozialen Fähigkeiten.
Bei zusätzlichen Zwangssymptomen empfehlen sich spezielle Desensibilisierungs-Techniken.
Kognitive Therapieverfahren sollen vor allem die so genannten dysfunktionalen Denkschemata durch flexiblere Muster ersetzen.
Es wird versucht, das Gemütsleben der oft sehr rational bestimmten und häufig zu Schuldgefühlen neigenden Patienten zu stärken.
Medikamentös können
– vor allem wenn sich offenkundige Zwangsstörungen in den Vordergrund zu schieben drohen – die so genannten SSRI-Antidepressiva zusätzlich hilfreich sein
7.11. Die depressive Persönlichkeitsstörung
Sie ist ein tiefgreifendes und beständiges Gefühl von
- Unbehagen
- Freudlosigkeit
- dem Gefühl des Unglücks
- Des niedergeschlagen Seins.
Die Betroffenen sind übermäßig ernst, humorlos und unfähig zu genießen.
Sie neigen zum Grübeln, zu ständiger Sorgenbereitschaft und zu einem pessimistischen zermürbenden Gedankenkreisen und Problem-Grübeln.
Das hat in zwischenmenschlicher und beruflicher Hinsicht gravierende Folgen
- und kann den Betroffenen komplett lähmen,
- auch wenn sich diese Patienten eher als Realisten sehen: “Ich wusste es ja”.
- und kann den Betroffenen komplett lähmen,
In Wirklichkeit droht hier die Konsequenz einer sich ständig selbst erfüllenden Prophezeiung.
Ein entscheidendes Grundproblem ist ihre strenge, unflexible (über-)kritische und negativistische Fremd- und Selbst-Beurteilung, die sich vor allem
- an den Schwächen und nur selten (und irgendwie ungern) an den Stärken einer Person, Situation oder Sache orientiert.
Menschen mit einer depressiven Persönlichkeitsstörung, so der bisherige Verdacht,
- tendieren zu “richtigen” Depressionen haben oder entwickeln eine entsprechende Disposition (Neigung).
Dies ist besonders dann ernst zu nehmen,
- wenn sich eine genetische Verbindung herausstellt, d. h. in der Vorgeschichte eine erbliche Belastung mit entsprechenden Störungen vorliegt.
7.12. Die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
ist ein tiefgreifendes Muster
- negativistischer Einstellungen
- und passiven Widerstandes gegenüber Leistungsanforderungen.
Unter negativistisch versteht man
- in der direkten Übersetzung eine “Verneinungs-Sucht”,
- also eine ständig ablehnende, negative Grundhaltung, wie sie als Trotzverhalten in der Pubertät häufig zu finden ist.
- Dort aber nur vorübergehend und für diese Entwicklungsphase entschuldbar – nicht aber als grundsätzliche Lebenseinstellung.
Menschen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung
- fühlen sich von anderen oft missverstanden,
- beklagen sich anhaltend über persönliches Unglück (das sie nicht selten unbewusst selber inszenieren),
- sind mürrisch und streitsüchtig,
- Autoritäten gegenüber zeigen sie unangemessene Kritik, / Verachtung.
- Menschen, denen es gut geht, begegnen sie mit Neid, Missgunst, Groll oder einem nicht nachvollziehbaren Wechselspiel zwischen feindseligem Trotz und (fast unterwürfiger) Reue.
- Die Ambivalenz (Zwiespältigkeit) im Denken und Handeln und
- das geringe Selbstwertgefühl, das aus einer solchen Einstellung entsteht (ständige Fremd-Abwertung schlägt zuletzt in eine verheerende Selbst-Abwertung um)
- führen oft zu Auseinandersetzungen und Streitigkeiten mit der Umwelt.
- zu persönlichen Enttäuschungen, die zwar unkritisch anderen zugeschrieben, im Grunde aber selbst provoziert werden.
Dieses Verhaltensmuster, einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung, findet sich aber auch bei zahlreichen anderen Leidens- und Krankheitsbildern:
- Borderline-Persönlichkeitsstörung,
- histrionischen (hysterischen),
- paranoiden (wahnhaften),
- dependenten (von anderen abhängigen),
- antisozialen und
- vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörungen.
Es bleibt abzuwarten, ob die zuständigen Institutionen (die APA / die WHO) sich eines Tages entscheiden, daraus ein eigenes, selbstständiges Krankheitsbild zu definieren.
Ein Resümee
Wie gesagt, Persönlichkeitsstörungen liegen häufig im Grenzbereich zwischen einem gesunden und einem gestörten Seelenleben.
Die Übergänge sind oft fließend
Um den Persönlichkeitsstörungen gerecht zu werden – sollten wir das grundsätzlich Negative dieser Wesensmerkmale einmal aus dem öffentlichen Meinungsbild über Persönlichkeitsstörungen herausnehmen.
Es gibt nämlich auch starke Vorteile. An Beispielen mangelt es nicht, nämlich dann,
- wenn die eigentlich negative Eigenschaft zur rechten Zeit, am rechten Ort und vom richtigen Vertreter in eine positive Leistung münden kann,
- z.B. politisch, militärisch, wirtschaftlich, kulturell-künstlerisch oder wie auch immer.
- wenn die eigentlich negative Eigenschaft zur rechten Zeit, am rechten Ort und vom richtigen Vertreter in eine positive Leistung münden kann,
“In Krisensituationen sind es häufig die „Alltags-gestörten“ welche aktiv die Dinge anpacken …”
Deshalb muss man einräumen,
- dass selbst die modernen Klassifikationen durch präziser gewordene Erfassungsinstrumente und diagnostische Unterteilungen die Persönlichkeitsstörungen
- zwar konkreter darstellen,
- letztlich sind sie aber nicht so sauber einteilbar wie z.B. Schizophrenien, Depressionen, Angststörungen, die Suchtkrankheiten, Altersleiden u.a.
- dass selbst die modernen Klassifikationen durch präziser gewordene Erfassungsinstrumente und diagnostische Unterteilungen die Persönlichkeitsstörungen
Bei den Persönlichkeitsstörungen spielen häufiger als bei den meisten anderen psychischen Leiden schwierige Lebensentwicklungen mit entsprechenden (krankhaften) Reaktionen eine Rolle,
- wie sie sich zum einen aus seiner Veranlagung
- und andererseits aus seiner Biographie (Lebensgeschichte) ergeben.
Das heißt: Fortschritte in der psychiatrischen Therapie der Persönlichkeitsstörungen werden sich in Zukunft am ehesten aus
- entwicklungspsychologischen,
- und auch neurobiologischen Untersuchungen ableiten lassen.
Und das prägt dann auch die Therapie, die im Rahmen eines Gesamt-Behandlungsplans
- nicht nur psychotherapeutisch einschließlich soziotherapeutischer Hilfen und Korrekturen,
- sondern auch medikamentös eingreifen sollte.
Darin liegt dann auch die Chance für die Betroffenen und ihre Angehörigen und auch Freunde, Nachbarn, Berufskollegen u.a. Erleichterung zu finden.
Denn gerade Persönlichkeitsstörungen sind seelische Erkrankungen,
- an denen nicht nur der Betreffende,
- sondern auch und oft vor allem sein Umfeld zu leiden hat,
Wir gehen noch sehr spannenden Zeiten entgegen!

Kommunikation mit einem Borderliner
Ein Buch, das praxistauglicher kaum sein kann. Persönlichkeitsstörungen sind aufgrund der Instabilität an Komplexität praktisch nicht zu überbieten. Darum machen viele Psychotherapeuten auch einen Bogen um die Therapie hiervon Betroffener. Nicht so der Psychiater Jerold Kreisman der sein Leben der Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörung gewidmet hat. Das Lesen dieses Buches hat mich zu meiner U.M.W.E.G. inspiriert.
Aufgrund der vielen Praxisfälle kann man die Affekte und Symptome besser verstehen. Die vielen Tipps für den Umgang mit den Betroffenen sind eine echte Hilfe und nehmen einem die Wut und Aggressionen, die oft im Kontakt mit dieser Krankheit entstehen und erzeugen vielmehr Verständnis und Mitgefühl.
Diagnose Persönlichkeitsstörung? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?
- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?
- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:
- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten
- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.
Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus