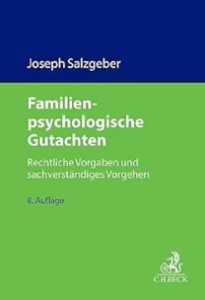Vorbereiten für ein familienpsychologisches Gutachten
– Teil 2 – Rechtliche Grundlagen und Verfahren
Im vorangegangenen ersten Beitrag haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt: „Was ist ein familienpsychologisches Gutachten überhaupt?“ In einem kurzen Satz zusammengefasst: Es ist KEIN Test, den man bestehen oder bei dem man durchfallen könnte. Ein Gutachten ist vielmehr eines von mehreren Hilfsinstrumenten für den Richter am Familiengericht.
Jetzt gehen wir etwas tiefer in die Thematik hinein und schauen uns mal besonders die rechtliche Dimension rund um das Familienpsychologische Gutachten an. Denn eins beobachte ich immer wieder: Wer die rechtliche Logik hinter einem Gutachten versteht, der fühlt sich diesem Thema nicht mehr so hilflos oder ausgeliefert, sondern wird deutlich handlungsfähiger. Frei nach dem Stoiker Epiktet, der sagte: Einige Dinge stehen in unserer Macht, andere nicht. Was in unserer Macht steht, sind Produkte unseres eigenen Willens, wie Urteil, Bestrebung, Begierde, Abneigung.“ Oder anders ausgedrückt: Wirkliche Handlungsfähigkeit entsteht dann, wenn ich etwas verstehe, was nur ich kontrollieren kann: meine Gedanken, Urteile und Entscheidungen. Also, versuchen wir das Thema „Familienpsychologische Gutachten“ einmal etwas besser zu verstehen, um dann in eine größere Handlungsfähigkeit zu kommen.
In dieser zweiten Folge behandeln wir jetzt folgende Fragen:
- Kompetenzen: Wer entscheidet eigentlich was in dem Verfahren?
- Wann und warum ordnet ein Gericht ein Gutachten überhaupt an?
- Mitwirkungspflicht? Welche Rechte und Pflichten hat man als Mutter, Vater oder anderer an diesem Verfahren Beteiligter? Und …
- Wie läuft ein solches Verfahren konkret ab?
Wer das rechtliche Fundament eines Familienpsychologischen Gutachtens versteht, der verbraucht deutlich weniger unnütze Energie in Unsicherheiten und kann sich viel besser auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Das eigene Kind und die Beziehung zu ihm.
⚖️ Teil 1: Warum Familiengerichte ein Gutachten anordnen
Zuerst mal eine wichtige Klarstellung: Auch wenn jährlich sehr viele familienpsychologische Gutachten in Auftrag gegeben werden – seriöse Quellen bewegen sich zwischen 10.000 und 100.000 Gutachten pro Jahr – so ist das alles trotzdem deutlich mehr als ein reiner Routineakt. Auch ist dies kein bürokratisches Kästchen, das man einfach so mal abhakt. Viel eher sprechen wir hier über einen wichtigen gerichtlichen Beweisbeschluss, der oft sogar wie ein Königsmacher in einem Verfahren wirkt.
Das ein familienpsychologisches Gutachten überhaupt in Auftrag gegeben wurde bedeutet, dass das Gericht für sich entschieden hat, dass es ohne eine weitere fachliche, psychologische Expertise keine sichere Entscheidung zum Wohl des Kindes treffen kann. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten.
Die rechtliche Grundlage für solch ein Gutachten finden wir in den §§ 163 ff. des FamFG, dem Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ein etwas sperriger Name. Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind zum Beispiel
- Grundbuchsachen
- Familienrechtliche Angelegenheiten
- Adoptionssachen
- Registersachen
- Nachlass- und Teilungssachen.
Das Gericht beauftragt ein Gutachten immer nur dann, wenn besonderes psychologisches Fachwissen notwendig ist, um dann eine juristische Entscheidung darüber zu treffen, was dem Kindeswohl am besten entspricht.
Typische Fragen, die durch ein Gutachten beantwortet werden sollen, drehen sich in der Regel um drei Themenbereiche:
- Wo soll das Kind leben? … Also: Bei welchem Elternteil ist das Kindeswohl unter den gegebenen Umständen am besten gewahrt? Hier geht es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
- Wie kann der Umgang geregelt werden? Welche Umgangsregelung ist entwicklungsförderlich und dem Kind zumutbar? Das ist das Umgangsrecht.
- Ist eine Gefährdung des Kindeswohls erkennbar?
Besonders der letzte Punkt ist hier relevant – wenn es um § 1666 BGB geht – also um all die Fälle, in denen ein Gericht prüfen muss, ob das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes gefährdet ist.
Sehr häufig wird auch noch die Bindungsqualität zwischen dem Kind und den Eltern abgefragt,
- Welche Bindungen bestehen, und wie stabil sind diese? Diese Frage zielt darauf ab, besser zu verstehen, zu wem sich das Kind emotional sicher gebunden fühlt und wo es inneren Halt findet.
Und auch wenn viele dies denken: Gerichte erwarten keinesfalls perfekte Eltern! Sie wollen einzig und allein besser verstehen, welche Lösung für das Kind unter realen Bedingungen die bestmögliche ist. Und das ist meines Erachtens auch der wichtigste Punkt, den du dir merken solltest:
- Ein Gutachter liefert die psychologische Expertise, also das fachliche Gutachten. Aber die Entscheidung trifft immer einzig und allein das Gericht.
Das Gutachten ist demnach nicht mehr und nicht weniger als eine Entscheidungshilfe, kein Urteil. Aber: Es hat natürlich großes Entscheidungsgewicht. Darum ist es auch so wichtig, dass man versteht, wie dieser Prozess funktioniert.
📜 Teil 2: Die Beteiligten in dem Verfahren
In einem familienpsychologischen Gutachtenverfahren gibt es immer mehrere Akteure und jeder hat hier eine klar definierte Rolle. Lass uns diese in einem kleinen Überblick miteinander besprechen. Wer tut was und ist wofür verantwortlich?
- Das Familiengericht
Das Gericht leitet das gesamte Verfahren. Es erlässt den Beweisbeschluss, also den Auftrag an den Gutachter. Und am Ende entscheidet es über Themen wie das Sorgerecht, den Umgang oder andere kindbezogene Fragen. Das Gericht ist die einzige Instanz, die rechtlich bindende Entscheidungen treffen darf.
- Der Gutachter
Das ist eine sachverständige Person mit psychologischer oder psychiatrischer Qualifikation. Die Voraussetzung hierfür sind folgende Punkte:
- Berufsqualifikation nach § 163 FamFG (Psychologie, Pädagogik, Medizin, Sozialpädagogik)
- Zusatzqualifikation für pädagogische/sozialpädagogische Berufsausbildung
- Gerichtliche Auswahl- und Eignungsprüfung
- Besonders hohe Anforderungen bei Kindeswohlfragen und Gefährdungen
Er erstellt dann nach Auftrag das Gutachten auf Basis von Gesprächen, Beobachtungen, Tests und Aktenanalyse. Der Gutachter ist neutral –vertritt keine Partei, sondern arbeitet ausschließlich im Auftrag des Gerichts.
- Der Verfahrensbeistand (§ 158 FamFG)
Er wird oft auch als „Anwalt des Kindes” bezeichnet. Er vertritt wie ein Anwalt die Interessen des Kindes im Verfahren. Das bedeutet: Der Verfahrensbeistand spricht mit dem Kind, beobachtet die Situation und gibt dem Gericht eine eigene Einschätzung. Wichtig auch hierbei: Der Verfahrensbeistand ist unabhängig von den Eltern.
- Das Jugendamt
Das Jugendamt berät das Gericht und kann auch eine eigene Stellungnahme abgeben. In der Regel kennt es die Familie und seine spezielle Situation oft schon länger und kann Hintergrundinformationen über Hilfepläne, frühere Interventionen oder Gefährdungseinschätzungen liefern. In manchen Fällen ist das Jugendamt auch Beteiligter im Verfahren.
- Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten
Das bist jetzt du. Du hast ein Anhörungsrecht! Das bedeutet, darfst immer gehört werden und Deine Sicht der Dinge darlegen. Du hast aber auch eine Mitwirkungspflicht, also eine Pflicht, bei der Begutachtung mitzuwirken. Dazu gleich im weiteren Verlauf noch mehr. Den eine Zwangspflicht besteht nicht.
- Die Anwälte der Eltern
Deine rechtliche Vertretung unterstützt Dich bei den formalen, den juristischen Schritten: Sie prüfen den Beweisbeschluss, stellen Anträge, formulieren Stellungnahmen und achtet darauf, dass deine Rechte gewahrt werden.
Was ich dir aus meiner Erfahrung immer sagen kann: Es lohnt sich, diese einzelnen Rollen zu verstehen. Denn dann weißt du, wen du wann und wie ansprechen kannst – und vor allem: wen nicht. Zum Beispiel: Wenn Du dem Gutachter direkt Beweise schicken oder Kontakt aufnehmen möchtest, dann geht dies nur über das Gericht oder deinen Anwalt. Alles andere kann als Beeinflussungsversuch gewertet werden. Ein wichtiger Punkt, wenn dies die gegnerische Seite so praktiziert… Grundlage hierfür sind zum Beispiel §404a ZPO; § 359 ZPO.
🏛️ Teil 3: Ablauf eines familiengerichtlichen Verfahrens
Jetzt werden wir konkreter. Lass mich dir Schritt für Schritt zeigen, wie ein familiengerichtliches Verfahren abläuft – von der ersten Antragstellung bis zur Gerichtsentscheidung.
- Schritt 1: Antrag / Einleitung
Alles beginnt damit, dass eine Partei einen Antrag beim Familiengericht stellt. Das kann ein Antrag auf Sorgerecht sein, auf Umgangsregelung oder auf Prüfung einer Kindeswohlgefährdung. Der Antrag muss dem Gericht immer schriftlich vorgelegt werden.
- Schritt 2: Vorbereitungstermin
Das Gericht prüft zunächst, ob eine Einigung zwischen den Eltern möglich ist. § 156 FamFG. Dafür lädt es die Beteiligten zu einem Vorbereitungstermin ein. Hier werden dann auch das Jugendamt und der Verfahrensbeistand mit angehört. Oft wird auch versucht, die Eltern zu einem Kompromiss zu bewegen. Wenn sich die Eltern einigen können, endet das Verfahren hier.
- Schritt 3: Beweisbeschluss
Kommt hier erst einmal keine Einigung zustande und das Gericht benötigt eine psychologische Expertise der Sachlage, erlässt es einen Beweisbeschluss. Darin steht genau, welche Fragen der Gutachter dem Gericht beantworten soll. Dieser Beweisbeschluss ist das zentrale Dokument für Dich und ich empfehle dir sehr dringend, dies mit deinem Anwalt genau zu besprechen.
- Schritt 4: Begutachtung
Der Sachverständige führt nun Gespräche mit Dir, dem anderen Elternteil, mit dem Kind, mit euch zusammen und möglicherweise mit weiteren Bezugspersonen. Dabei macht er dann seine Beobachtungen, führt Tests durch und analysiert die Akten. Diese Phase kann tatsächlich mehrere Wochen oder Monate dauern. In der Regel schreibt das Gericht dem Sachgutachter einen Abgabetermin vor.
- Schritt 5: Gutachtenerstellung
Nach Abschluss der Untersuchungen erstellt der Gutachter sein schriftliches Gutachten und übermittelt es an das Gericht. Über deinen Anwalt erhältst du dann Einsicht in dieses Gutachten.
- Schritt 6: Stellungnahmen
Du und dein Anwalt habt jetzt die Möglichkeit, zum dem Gutachten Stellung zu nehmen. Ihr könnt Ergänzungsfragen stellen oder auf fachliche Fehler hinweisen. Das Gericht muss dann diese Stellungnahmen seinerseits prüfen. - Schritt 7: Gerichtstermin / Anhörung
Im Gerichtstermin wird das Gutachten in seiner Tiefe genau erörtert. Der Gutachter ist anwesend und kann dabei auf deine Fragen antworten. Auch du wirst dabei angehört. Das Gericht entscheidet dann unter Berücksichtigung des Gutachtens und aller weiteren Aussagen.
- Zeitrahmen: Sei darauf vorbereitet, dass so ein familienpsychologisches Verfahren in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten dauert. In Einzelfällen kann es sogar noch länger dauern. Das ist keine Schikane, sondern schlicht die Zeit, die für eine sorgfältige Begutachtung nötig ist. Denn schließlich geht es um die Zukunft eines kleinen Menschen. Und da darf nichts dem Zufall überlassen werden.
Mein praktischer Tipp an dich: Ganz nach dem Strategem Nummer 4 der chinesischen Kriegsführung: Nutz diese Zeit aktiv.
- Bereite dich bestmöglich vor,
- Reflektiere deine Situation,
- Arbeite an deiner emotionalen Stabilität.
Die Zeit vergeht sowieso. Du aber kannst nun mit darüber entscheiden, ob du diese passiv über dich ergehen lässt oder aktiv für dich nutzt. Schau dir auch auf meiner Webseite meinen kostenlosen Vorbereitungsplan mit über 200 Fragen an. Die findest diesen unter https://werdewiederstark.de/familienpsychologisches-gutachten-vollstaendige-vorbereitung/
📘 Teil 4: Rechte und Pflichten der Beteiligten
Jetzt möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das viele beteiligte Eltern sehr verunsichert: Welche Rechte habe ich eigentlich in diesem Verfahren? Und welche Pflichten?
4.1. Lass mich mit den Rechten beginnen:
- Du hast das Recht auf Einsicht in den Beweisbeschluss (§ 30 FamFG). Das bedeutet: Du darfst und sollst vor allem genau wissen, welche Fragen der Gutachter beantworten soll.
- Du hast das Recht auf eine faire Behandlung und Anhörung. Das Gericht muss deine Sicht auf die Angelegenheit anhören. Du bist in diesem Verfahren nicht nur ein Objekt! Du bist vielmehr ein Beteiligter mit eigener Stimme.
- Du hast das Recht, all deine Fragen an den Gutachter zu stellen (§ 397 ZPO Fragerecht der Beteiligten). Und wenn dir etwas immer noch unklar ist oder du Ergänzungen einbringen möchtest, kannst du immer über deinen Anwalt diese Themen formulieren.
- Du hast das Recht, Befangenheit zu beantragen, wenn objektiv Zweifel bestehen (§ 406 ZPO). Das wäre z.B., wenn deutliche Anzeichen aufgetreten sind, dass der Gutachter in seiner Arbeit nicht neutral vorgeht. Aber Achtung: Das muss immer sachlich begründet sein. „Mir ist der Gutachter unsympathisch” reicht logischerweise nicht aus.
- Du hast das Recht auf Akteneinsicht über deinen Anwalt (§ 13 FamFG). Alle Unterlagen, die das Gericht verwendet, kannst du über deinen Anwalt einsehen.
4.2. Nun gehen wir über zu den Pflichten:
- Du hast die Pflicht zur Mitwirkung bei der Begutachtung (§ 27 FamFG). Das bedeutet für dich, dass du zu den Terminen erscheinen, Gespräche führen und Tests mitmachen musst. Zwar kannst du zu einem Gutachten nicht gezwungen werden, aber wenn du es ablehnst, kann ein Gericht daraus negative Schlüsse ziehen.
- Du hast die Pflicht zu wahrheitsgemäßen Angaben. Lügen oder bewusste Auslassungen werden in der Regel erkannt und schaden Ihrer Glaubwürdigkeit erheblich. §27 FamFG Satz 2.
- Du hast die Pflicht zur Wahrung des Kindeswohls. Zum Beispiel indem du das Kind in seiner Loyalität zu dem jeweils anderen Elternteil nicht zu beeinflusst. BGB § 1684. Du darfst dein Kind auch nicht auf die Gespräche mit dem Gutachter vorbereiten, indem du ihm sagst, was es sagen soll. Das wäre dann keine Vorbereitung mehr, sondern Manipulation. Und die wird gerade bei jüngeren Kindern schnell als eine solche erkannt.
Mein Tipp für die Praxis: Mach dir umgehend eine Kopie des Beweisbeschlusses. Lass dir von deinem Anwalt jeden einzelnen Punkt in möglichst einfacher Sprache erklären. Erst wenn du genau weißt, welche Fragen beantwortet werden sollen, kannst du dich auch sinnvoll vorbereiten. Du kannst dann aber auch Fragen abwehren, die nichts mit der gerichtlichen Beauftragung zu tun haben. Das ist meines Erachtens ein Punkt, der von vielen Eltern in seiner Wichtigkeit völlig unterschätzt wird.
💬 HINWEISBOX: Tipps für Eltern
- Prüfe genau, ob du den Beweisbeschluss wirklich verstanden hast.
- Dieser gerichtliche Beschluss ist das zentrale Dokument des gesamten Verfahrens! Er legt fest, was ein Gutachter prüfen soll und was nicht. Damit auch, worauf du dich nun konzentrieren solltest.
- Lass dir von deinem Anwalt den Gerichtsbeschluss in eine verständliche Alltagssprache übersetzen. Juristische Formulierungen sind oft kompliziert, aber die Fragen dahinter sind meist klar.
- Erst wenn du genau weißt, welche Fragen beantwortet werden sollen und welche nicht, kannst du dich gezielt und sinnvoll vorbereiten.
⚠️ ACHTUNG: Häufige rechtliche Irrtümer
Lass mich nun mal drei häufige Missverständnisse aufklären, die mir in der Praxis immer wieder begegnen:
- Irrtum 1: „Ich kann das Gutachten ablehnen, wenn mir der Gutachter nicht sympathisch ist.”
Du kannst einen Gutachter nur dann ablehnen, wenn es objektive Gründe für Befangenheit gibt. §406 Abs. 2 ZPO). Zum Beispiel, wenn er mit einer Partei verwandt ist oder früher als Therapeut für eine Seite gearbeitet hat. „Mir ist die Person unsympathisch” ist kein ausreichender Grund. Es gibt noch einige weitere Gründe, die ich aber nicht alle hier aufzählen kann. Ich denke aber ganz konkret an folgende mit großem Potential ein Gutachten in Frage zu stellen:- Wenn der Sachverständige bei der Umsetzung der gerichtlichen Fragestellung von einem Sachverhalt ausgeht, der nach Aktenlage streitig ist. OLG Hamm FF 2022, 325
- Wenn der Sachverständige seine Befugnisse überschreitet und z.B. Tatsachen mit Wissen nur einer Partei ermittelt, ohne der anderen Partei Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Ulrich DS 2002, 59
- Wenn er eigenmächtig den gerichtlichen Auftrag und die die Beweisfrage erweitert. OLG Frankfurt a.: IfS 2022,3 LG Karlsruhe DS 2008, 151; OLG Bamberg MedR 1993, 351.
- Irrtum 2: „Ich muss dem Gutachter alles erzählen.”
Nein, das musst du nicht. Ja, du hast eine Mitwirkungspflicht, aber keine Offenbarungspflicht für Privates, was überhaupt keine Relevanz für die Fragestellung hat. Du darfst jederzeit Grenzen setzen. Aber: Wenn du relevante Informationen zurückhältst, dann fällt das irgendwann einmal auf und schadet deiner Glaubwürdigkeit.
- Irrtum 3: „Ich kann dem Gutachter direkt schreiben oder Beweise schicken.”
Nein, das ist nicht zulässig und ein oft unterschätzter Punkt! Sämtliche Kommunikation mit dem Gutachter läuft immer über das Gericht oder deinen Anwalt. Alles andere kann als Versuch gewertet werden, den Gutachter zu beeinflussen – und das wirkt sich negativ auf deine Bewertung aus. OLG Karlsruhe DS 2019, 229.
Aber Achtung: Das gleiche gilt auch für die andere Partei! Würde also der andere Elternteil diese „Abkürzung“ vornehmen, dann kann und muss dagegen vorgegangen werden.
🔍 Teil 5: Qualitätskontrolle durch das Gericht
Du fragst dich vielleicht: Wer kontrolliert eigentlich, ob der Gutachter seine Arbeit gut und richtig macht? Die Antwort darauf ist recht einfach: Das Gericht. Denn das Gericht ist ja auch sein Auftraggeber.
Und was prüft das Gericht?
- Ob das Gutachten den „Mindestanforderungen an Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht“ entspricht. Diese Mindestanforderungen wurden 2019 (aktuell in der 2. Auflage vorliegend) vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz veröffentlicht und sind für alle Beteiligten verbindlich.
- Nachvollziehbarkeit der Hypothesen
Ja, ein Gutachter muss auch mit Hypothesen arbeiten. Er muss dann aber klar und deutlich darlegen, welche Annahmen er geprüft hat und warum. Es reicht nicht, einfach zu behaupten, dass etwas so ist. Er muss zeigen, wie (!) er zu dieser Einschätzung gekommen ist.
3. Transparente Methodik. §30 Abs. 1 FamFG
„Transparenz“ leitet sich vom lateinischen Wort transparens („durchscheinend“) ab, das sich aus trans- („durch“, „hindurch“) und parēre („erscheinen“, „sichtbar sein“) zusammensetzt.
Das Gericht schaut, ob der Gutachter beschrieben hat, welche Methoden er genau verwendet hat. Dies beinhaltet die Benennung von Testnamen, Testautoren und anhand welcher Version/Normierung das Verfahren durchgeführt wurde.
Ohne diese Transparenz ist ein Gutachten nicht verwertbar. Diese Anforderung ergibt sich ebenfalls aus den „Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht“.
4. Begründete Schlussfolgerungen
Die Schlussfolgerungen müssen sich logisch aus den Befunden erklären lassen. Wenn ein Gutachter schreibt: „Die Mutter ist emotional instabil”, dann muss er dies auch mit konkreten Beobachtungen oder Testergebnissen belegen.
5. Klare Trennung von Befund und Bewertung
Der Gutachter muss zuerst einmal wertneutral beschreiben, was er beobachtet hat, und darf erst danach interpretieren. Wenn diese Trennung fehlt, ist das ein methodischer Mangel.
Wenn das Gericht entweder selber oder durch Hinweise von dir / deinem Anwalt feststellt, dass diese Punkte so nicht erfüllt werden, kann es dann eine entweder eine Ergänzung des Gutachtens oder sogar eine Neubegutachtung durch einen anderen Sachverständigen anfordern. (§ 412 ZPO).
Mein Praxis-Tipp:
Wenn Du später das Gutachten liest und immer wieder das Gefühl hochkommt, dass dies methodisch unsauber gearbeitet ist, dann sprich auf alle Fälle mit deinem Anwalt. Gemeinsam könnt ihr dann prüfen, ob die Mindestanforderungen in diesem Gutachten erfüllt sind. Das ist kein Angriff auf den Gutachter, sondern dein ureigenes Recht auf ein faires Verfahren.
💡 Wie können wir das Gelernte nun in der Praxis umsetzen?
Ich möchte dir eine kleine, aber konkrete Übung mitgeben, die dir helfen kann, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Erstelle dir eine einfache Übersicht mit folgenden drei Punkten:
- Wer sind die Beteiligten in meinem Verfahren?
Notieren dir: Richter, Gutachter, Verfahrensbeistand, Jugendamt, Ihre Anwältin oder Ihr Anwalt.
Denn nur wenn du weißt, wer hier wer ist, kannst du immer den Überblick behalten.
Nicht umsonst sieht man in den Krimis immer wieder eine Notiztafel, auf der die Ermittler in einer einfachen Übersicht nur die Namen der Protagonisten notieren und sich immer wieder die Frage stellen: wer spielt hier welche Rolle? - Welche konkrete Fragestellung und Aufgabenstellung steht im Beweisbeschluss?
Schreibe dir die Fragen des Gerichts sehr gerne in deinen eigenen Worten auf. Was genau soll der Gutachter prüfen? Du glaubst gar nicht, wie zielführend dies für dein inneres Vorbereiten und in deinen Gesprächen mit dem Gutachter, deinem Anwalt oder einem anderen Beteiligten ist. Klarheit besiegt immer die Angst!
- Welche Rechte und Pflichten betreffen mich direkt?
Notieren dir: Was darf ich? Was muss ich? Was sollte ich besser nicht tun?
Dieses kleine Dokument wird oft unterschätzt. Aber es hilft enorm, jederzeit den Überblick zu behalten. Und das ist besonders dann wichtig, wenn das Verfahren einmal emotional wird und du eine innere Orientierung brauchst.
Nimm dir noch heute Abend eine halbe Stunde Zeit dafür. Mehr ist dafür nicht nötig. Aber es lohnt sich!
🪞 Teil 6: Fazit & Ausblick
Am Ende dieser zweiten Folge sollten wir das Gesagte noch kurz einmal zusammenfassen:
Auch wenn es nicht viele Gesetzestexte über ein Sachverständigen Gutachten in Familiengerichtlichen Verfahren gibt, so folgen diese trotzdem immer festen Spielregeln. Diese sind nicht willkürlich, sondern sollen – so die Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht – Fairness, Transparenz und vor allem einen größtmöglichen Kinderschutz sicherstellen. Ich würde jedem an diesem Thema Interessierten nahelegen, sich diese Empfehlungen für Mindestanforderungen mindestens einmal sehr genau durchzulesen.
Sie wurden erarbeitet
- von Vertretern verschiedener Verbände: juristische, psychologische und medizinische Fachverbände waren hierunter.
- Dann von der Bundesrechtsanwalts- und der Bundespsychotherapeutenkammer.
- Dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und unterstützt und
- Dem XII. Zivilsenat des BGH und nicht zuletzt
- Von den Landesjustizministerien
Wer diese Regeln kennt, fühlt sich bei weitem nicht mehr so hilflos und ausgeliefert, sondern vielmehr handlungsfähig. Wir wissen jetzt nämlich :
- Warum ein Gericht so ein Gutachten anordnet
- Wer im Verfahren welche Rolle hat
- Wie der Ablauf eines Gutachtens im Groben und Ganzen strukturiert ist
- Welche Rechte und Pflichten man als Beteiligter
- Und nicht zuletzt, wie das Gericht die Qualität des Gutachtens prüft und du dies mit deinem Anwalt im Nachhinein auch tun kannst.
Das alles ist wie ich finde ein recht solides rechtliches Fundament. Darauf kann man schon mal aufbauen. In der kommenden Folge Nummer 3 schauen wir uns die Fragen an:
- „Wie übersetzt der Gutachter die gerichtlichen Fragen in psychologische Hypothesen?
- Und woran kann man erkennen, ob er das nun auch wirklich korrekt macht?“
Oder anders ausgedrückt: Wie wird aus einer juristischen Frage eine psychologische Untersuchung? Denn genau das ist der Herzschlag / der Kernpunkt eines guten Gutachtens.
Ich verspreche dir, dass du auch darüber viel lernen wirst, wie man diesen Prozess besser verstehen und bewerten kann.
Bis dahin wünsche ich Dir viel Klarheit, Ruhe und Vertrauen in den Prozess.
📚 FACHLICHE QUELLEN (Stand 2020–2025)
– BMJV (2019): Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Kindschaftsrecht
– Borth, H. (2024): Familiäre Bindungen und Kindeswohl
– Salzgeber, J. (2021): Familienpsychologische Gutachten in der Praxis
– Dettenborn, H. & Walter, H. (2022): Psychologische Gutachten im Familienrecht
– Zumbach, J. (2023): Psychologische Diagnostik in familienrechtlichen Verfahren
– FamFG / BGB / ZPO aktuelle Fassung 2025
Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!
Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.
Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?
Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.
Steht ein familienpsychologisches Gutachten im Raum? Meine Unterstützung als beratender Beistand
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
- Was ist, wenn eine Persönlichkeitsstörung, eine Drogenvergangenheit oder andere Probleme die Situation begleiten?
- Ist eine Kommunikation mit dem Ex-Partner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Ängste irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Meine Unterstützung als Beistand nach §13 SGB X und §12 FamFG :
Es ist durch das Gesetz klar geregelt, dass sich jede Person im Familien-Verfahren sowohl vor den Ämtern als auch vor Gerichten (Ausnahme: alle finanziellen Angelegenheiten) durch einen Beistand begleiten lassen kann.
Diese Möglichkeit wird leider noch viel zu wenig genutzt, da sie auch in den Jugendämtern kaum bekannt und nicht gerade populär ist. Eigentlich nachvollziehbar, da sich die gesamte familiale Intervention einschließlich der Familiengerichte gerne im familiären Verfahren unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit bequem einrichtet.
Buchen Sie sich gerne auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus