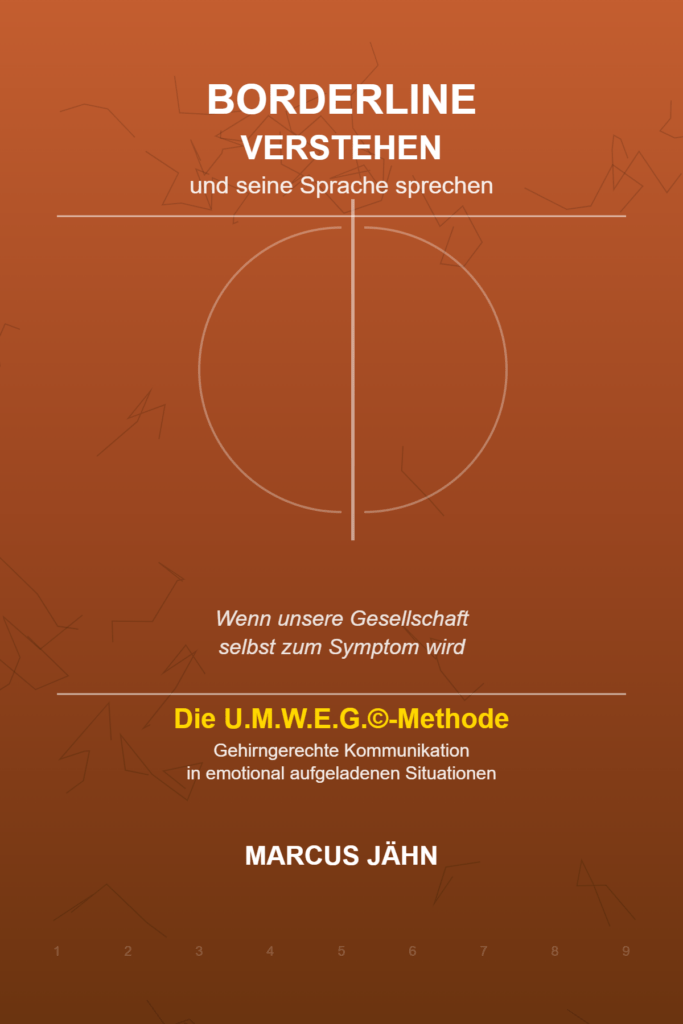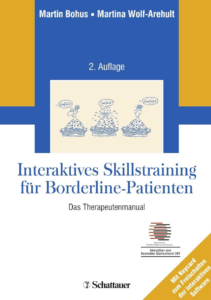Kapitel 7 U.M.W.E.G. – Die Kommunikation mit einem Borderliner
Einleitung:
Worte erzeugen Gedanken. Und Gedanken? Sie erzeugen neue Worte. Diese beiden kaum fassbaren Begriffe „Gedanken und Worte“ sind dermaßen machtvoll, dass sie den einen bis in den Selbstmord treiben, einen anderen jedoch bis auf den Mount Everest motivieren können. Kommunikation ist und bleibt das wichtigste Mittel / ja auch das wirksamste Medikament im Bereich der Persönlichkeitsstörung und Psychotherapie!
Gibt es denn auch ein Werkzeug, das uns helfen kann, wenn es um die Königsdisziplin der Psychotherapie – die Behandlung von Borderline – geht? Was wäre, wenn es dieses Werkzeug tatsächlich gibt und es gleichzeitig auch noch so einfach zu handhaben ist, dass selbst ein Nicht-Studierter Betroffener, egal ob Borderliner oder Angehöriger – es im Alltag verwenden kann?
Mit genau diesem Werkzeug – der U.M.W.E.G. Methode – möchte ich dich in diesem und den folgenden Beiträgen vertraut machen. Ich habe diese Methodik in den vielen Jahren meiner Arbeit mit diagnostizierten Borderlinern entwickelt und immer wieder neu adaptiert und angepasst. Mein Wunsch ist es, dir mit dieser Methode ein Werkzeug in die Hand zu geben, was dich nicht nur im Umgang mit einem Borderliner sicher macht. Es hilft in allen emotional aufgeladenen Situationen, ist universell einsetzbar und wirklich einfach zu erlernen. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann besuche mich auf meiner Webseite “www.psychologie-hilft.de”.
7.1. Die Wichtigkeit der Sprache
„In der Sprache liegt die Seele eines Volkes“ (Zitat Paul Schibler, Schweizer Aphoristiker) Unsere Sprache ist schon wirklich etwas Besonderes… Sie ist für so unfassbar vieles in unserem Leben verantwortlich: Sie beginnt mit einem Gedanken, einer Vorstellung. Ausgesprochen verändert sie dann die Umgebung, unsere ganze soziale Wirklichkeit. Sie lässt neue Dinge, Gedanken und Vorstellungswelten entstehen – und das sowohl bei uns als auch bei unserem Gegenüber.
Als Beispiel – wie umfangreich Sprache die Wirklichkeit beeinflusst – möchte ich die Situation einer Hochzeit im Standesamt nehmen: Im Kern wird dort von einem Standesbeamten immer wieder dasselbe besprochen was am Ende dann in einer Frage an das Paar seinen eigentlichen Höhepunkt findet: „Wollt ihr beide miteinander die Ehe eingehen?“
Antworten sie dann mit „Ja“, dann verändert sich bei beiden von diesem Moment an praktisch ihre gesamte Welt: Sie sind verheiratet und damit ein Ehepaar mit komplett veränderten sozialen und rechtlichen Konsequenzen. Sprechen ist hier gleichzeitig ein Handeln. Es ist ein „Sprechhandeln“, ein die Wirklichkeit veränderndes Handeln.
Es gibt für Kommunikation viele Studiengänge – aktuell über 170! Einer davon ist z.B. die Sprechakt- oder auch Sprechhandlungstheorie von John Langshaw Austin, der diese 1955 an der Harvard Universität begründete. Ein wichtiger Grundsatz in ihr ist, dass wir immer dann handeln, wenn wir etwas vorher aussprechen. Das bedeutet, dass mit dem, was wir reden, auch immer ein Handeln in Verbindung steht!
Dies geschieht bei allen unseren Äußerungen. Egal ob es ein Befehl, eine Drohung, eine Bitte oder eine Warnung ist. Aber auch dann, wenn wir eigentlich nur informieren und berichten. Denn Sprache macht genau das im Kern auch aus: „das Informieren und Berichten“. Sie ist für unser Leben zentral wichtig, da sie einen direkten Einfluss auf unser Denken nimmt.
Sagt jemand zum Beispiel „Achtung, da kommt ein Auto, dann fokussiert sich sein Denken und das seiner Umgebung, logischerweise sofort auf die angesprochene Gefahrenquelle aus. Sie wird zum Zentrum der kognitiven Aufmerksamkeit.
Zusammenfassend lässt sich Folgendes bereits jetzt schon mal sagen:
- Sprache löst immer sowohl eine gedankliche Aktivität als auch einen Verstandes-Prozess aus.
- Man versucht in den Worten einen Sinn / einen Handlungssinn zu erkennen: Will das Gesagte mich jetzt informieren, warnen, oder ist es eine Bedrohung oder etwas ganz Anderes?
- Und nicht zuletzt erschließt sich einem dann der Inhalt:
- Die Formulierungen rufen Vorstellungen / Bilder von Dingen und Ereignissen auf, die dann kognitiv (verstandesmäßig) in den Köpfen des Gegenübers präsent, weitergedacht und mit dem eigenen Vorwissen verknüpft werden.
Das gilt für alle gesprochenen Wörter, egal ob beiläufig oder in einem Universitätsvortrag vorgetragene!
- Die Formulierungen rufen Vorstellungen / Bilder von Dingen und Ereignissen auf, die dann kognitiv (verstandesmäßig) in den Köpfen des Gegenübers präsent, weitergedacht und mit dem eigenen Vorwissen verknüpft werden.
Das alles sollte uns zeigen, wie wichtig Kommunikation im Miteinander ist! Kommunikation ist vorweggenommenes Handeln – praktisch ein verbales Agieren … Und deswegen ist dieses Thema auch in der Kommunikation mit Borderline extrem wichtig.
Gerade auch dann, wenn wir uns mit den Kriterien von Borderline auseinandersetzen müssen, wie
- (1) Verzweifeltes Bemühen ein Alleinsein zu verhindern
- (2) Intensive, aber auch fragil/instabile zwischenmenschliche Beziehungen. Ständiger Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung (4) Mind. 2 potentiell selbstschädigende Bereiche / starke Impulsivität.
- (5) Regelmäßige Suizidandrohungen, Suizidversuche, selbstschädigendes Verhalten
- (6) Instabile Affekte – durch die Stimmung stark zwischen Niedergeschlagenheit, Angst oder Reizbarkeit pendelnd.
Ja, Kommunikation kann Menschen verbinden. Sie kann diese aber auch trennen. Sie kann über Krieg und Frieden und auch über Leben und Tod entscheiden. Das alles sollten wir in Verbindung mit einer emotionalen instabilen Persönlichkeitsstörung – Borderline (F60.31) wird im ICD 10 der „Instabilen Persönlichkeitsstörung F60.30“ untergeordnet – immer beachten und im Hinterkopf behalten.
Eine der vielen Methoden, um die Welt der Sprache / der Kommunikation irgendwie in ein System zu integrieren, ist die Transaktionsanalyse. Sie ist eine tiefenpsychologisch orientierte Technik, die sich sowohl mit der Persönlichkeit, aber vor allem mit der Kommunikation befasst.
Von Eric Burne (1910 – 1970) entwickelt, ist sie eine Hilfe, um
- ein Muster in dem Verhalten und der Sprache von Menschen zu erkennen,
- dieses zu verändern oder auch
- um Sprache oder Gedanken “vorherzusagen”.
Ohne solche Muster (wie die der Transaktionsanalyse) könnte man das größere Ganze oft nicht erkennen. Man bleibt praktisch blind und kann mit den vielen Informationen der Kommunikation, praktisch nichts mehr anfangen.
Wenn Du mehr hierüber kennenlernen möchtest, dann schau dir bitte meine zwei Videoreihen hierzu an
- „Spiele der Kommunikation“ mit 31 Videos und auch
- Transaktionsanalyse im Überblick mit derzeit 10 Videos.
Du findest diese auf meiner Webseite www.psychologie-hilft.de. Sie, die Transaktionsanalyse, ist aber nicht unser Thema.
Ich möchte durch diesen Hinweis lediglich zeigen, dass wir Muster, Denksysteme und Anleitungen benötigen, um uns auch in schwierigen Kommunikations – Situationen souverän zu verhalten. Darum möchte ich jetzt auf eine Kommunikations-Strategie eingehen, die zwar keine Therapie darstellt, aber in Krisensituationen einen kurzen und trotzdem sehr effektiven Masterplan bereithält.
Was ist der Vorteil davon vorbereitet zu sein, wenn Kommunikation doch so unglaublich vielfältig und nicht vorhersehbar ist? Nun, auch wenn dein Gegenüber in seiner Kommunikation nicht planbar ist, so kannst du zumindest deine (!) Kommunikation in bestimmten Grenzen selbst planen. Und oft kann man dann durch geschickt eingesetzte Worte das Denken des Gesprächspartners anschließend doch noch in eine bestimmte Richtung lenken.
Dieses Vorgehen könnte man nun Manipulieren nennen. Mein Ziel hierbei ist aber ganz ausdrücklich, das Gespräch von einer Eskalation weg und zu einer friedlichen Ebene hin zu lenken. Wenn dies Manipulation ist, dann gebrauche ich diese Methodik sehr gerne und mit voller Überzeugung in diesem Zusammenhang.
7.2. Kommunikation – auch dann, wenn eigentlich nichts mehr geht – die U.M.W.E.G.-Methode©.
Wenn wir über Kommunikation mit Menschen in Ausnahmesituationen sprechen, wie zum Beispiel mit jemandem mit einer Borderline – Persönlichkeitsstörung, dann können wir oft nicht mehr von einer „normalen Kommunikation“ reden. Der Borderliner verändert seine Persönlichkeit, seine Haltung und sein Denken in kritischen Situationen praktisch permanent und schlagartig wie ein Chamäleon.
Wer mit dieser Personengruppe regelmäßig sprechen muss, der gibt oft schnell frustriert auf, da er von solch einem Blitzlichtgewitter / diesem Stroboskop-Feuerwerk an neuem, an unkoordinierten nicht zusammenhängendem Verhalten oft überfordert ist.
Das, was da kommt, scheint einfach in kein bekanntes System zu passen – und darum ist es wichtig, diesem unkoordinierten verbalen Angriff ein gleichförmiges, koordiniertes und von dem Gegenüber praktisch unabhängiges Antwortsystem anzubieten. (bitte merken, da dies unser wichtigster kommunikativer Ansatz sein wird).
Diese ständig wechselhafte Stimmung (Kriterium 5), die explosionsartigen Wutausbrüche (Kriterium 8), die selbstzerstörerischen Handlungen (Kriterium 4) und die unbeständige Kommunikation (Kriterium 3) bringen die gesamte Umgebung immer wieder an ihre Belastungsgrenze. Und weil dem so ist, möchte ich in diesem Kapitel ein System bzw. eine strukturierte Kommunikationsmethode aufzeigen,
- die auf der einen Seite so einfach ist, dass sie von Familie, Freunden und Therapeuten im täglichen Umgang benutzt werden kann,
- auf der anderen Seite aber so durchdacht ist, dass sie trotzdem einen sichtbaren Erfolg auch im Umgang mit Borderline erzielt.
Es ist ausdrücklich keine (!) Kommunikation, die lediglich für Borderliner anwendbar ist. Borderline ist nicht umsonst im ICD 10 innerhalb der Kategorie als „Emotionale Instabilität“ aufgeführt.
Diese Kommunikationsstrategie ist für alle Menschen gedacht, die sich immer wieder, aber auch situativ kurzfristig in einer stressigen Ausnahmesituation befinden. Ich denke hier an Krisensituationen mit aggressiven Kollegen oder Vorgesetzten am Arbeitsplatz. Oder Teenager in der Pubertät, aber auch an so gefährliche Situationen wie Suizidalität oder andere Bedrohungen.
Es geht mir um ein System, Gespräche mit hoher negativer Emotionalität in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen. Ich möchte hierdurch Verwandte, Freunde und Kollegen besser in die Lage versetzen, sich mit der Borderline–Dynamik, ruhig und vernünftig auseinanderzusetzen.
Dieses U.M.W.E.G©.– System (so seine Bezeichnung) hilft,
- der Überflutung von Emotionen durch eine ganz klar strukturierte und damit ruhige Reaktion zu begegnen,
- die Ängste des Gegenübers anzusprechen und
- eine mögliche Explosion der Kommunikation zu verhindern.
Die U.M.W.E.G.© – Methode ist, wie bereits erwähnt, auf gar keinem Fall eine Therapie! Es ist eine systematische Notfallreaktion, um in der jeweiligen Situation die Kommunikation aufrechtzuerhalten und eine größere Eskalation zu vermeiden. Das ist durchaus vergleichbar mit dem, was Piloten lernen. Da gibt es zum Beispiel den Begriff „Master Warning“. Gehen die rote Leuchte und das Warnsignal an, dann bedeutet dies, dass eine sofortige vorher genau definierte Handlungsweise nötig ist. Und genau diese “Master-Warning-Handlungsstruktur” möchte ich durch die U.M.W.E.G©.-Methode einmal aufzeigen.
Sie ist ein wirklich tolles Tool: Durch sie können wir für uns – aber auch unseren Gesprächspartnern – negative Denkmuster und unproduktive Verhaltensweisen aufzeigen und dabei zusätzlich auch seelische Belastungen abfedern. Das alles fördert Ruhe und Selbstbewusstsein. Durch die U.M.W.E.G.©-Methode werden falsche Denkmodelle (Repräsentationen) des Borderliners / des Gegenübers erkennbar. Durch sie können wir der Überempfindlichkeit, der Ablehnung und der Angst vor dem Verlassenwerden besser begegnen (Kriterium Nummer 1).
Und der meines Erachtens wohl wichtigste Punkt ist der, dass die Verantwortung des Borderliners für sein eigenes Verhalten konsequent, jedoch immer an richtiger Stelle, aufgezeigt wird. Was es mit der richtigen Stelle auf sich hat, das kommt im Folgenden noch.
Mir ist an dieser Stelle eine Sache sehr wichtig zu wiederholen: Obwohl diese U.M.W.E.G.© Methodik, im Speziellen für die Borderline – Persönlichkeit in der Krise entwickelt wurde, so kann diese Art der Kommunikation auch allen anderen helfen! Alle, die eine präzise, konsequente Kommunikation in schwierigen Verhandlungen benötigen, können hiervon profitieren – auch wenn bei ihnen keine Persönlichkeitsstörung im Zentrum des Problems steht.
7.3. Die U.M.W.E.G.© – Kommunikation.
U.M.W.E.G.© – Das ist ein mehrstufiges System, um sich mit einem emotional hoch aufgeladenen, aggressiven Gegenüber (Kriterium Nr. 8) souverän und taktisch überlegt auseinanderzusetzen.
Wir können diese Methode in zwei Teile unterteilen:
- M.W. Damit ist der Teil gemeint, der situativ, fast schon reflexartig in (!) der kritischen Situation zu beachten ist.
- G. „schwebt“ sinnbildlich in einer Meta-Ebene über diesem und allen anderen Gesprächen.
Betrachten wir zuerst den Teil 1 – das U.M.W.
Er kommt direkt in der Krisensituation zum Einsatz und besteht aus drei Elementen. Wichtig ist, dass in unserer Kommunikation mit dem Borderliner alle drei Elemente zu möglichst gleichen Teilen angewendet werden.
Dieser U.M.W.–Teil dient einzig und allein dem Ziel, eine konstruktive Kommunikation für den Augenblick (!) aufrechtzuerhalten.
Der E.G.-Teil steht für Empathie und Geduld.
Empathie ist sowohl eine Fähigkeit aber auch eine innere Bereitschaft, sich in die Haltung, Einstellungen, Gedanken und Motive anderer Personen einzufühlen. Oder anders beschrieben: Empathie hilft mir, mich selbst von außen und den anderen von innen zu betrachten. Es ist die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel durchzuführen.
Geduld ist zwar selbsterklärend, jedoch sollte ihr Wert nie unterschätzt werden! Die vier Kardinaltugenden – Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß – beinhalten in der Tapferkeit die Geduld.
Geduld und Tapferkeit sind ein Ausharren in dem Tun des Richtigen und können m.E. auch mit Tapferkeit gleichgesetzt werden. Und ja … Tapferkeit braucht man auch, wenn man mit einem Borderliner im dauerhaften Kontakt ist.
7.3.1. Unterstützung, Mitgefühl, Wahrheit
U.M.W.E.G.© ist also eine zweistufige Kommunikation in einer Krisensituation:
– Ein akuter Teil U.M.W. und
– ein übergeordneter – der E.G. Anteil.
Und was U.M.W. bedeutet, darauf gehen wir nun ein:
👉U. = Unterstützung
Das U in U.M.W.E.G.© steht für Unterstützung. „Sei Dir sicher, ich unterstütze Dich.” Es ist eine klare „Ich-Botschaft”, die unsere Anteilnahme und Sorge am Gegenüberausdrückt.
- „Du, ich mache mir wirklich Sorgen um dich!“
- „Das, was Du hier durchmachst, das löst in mir Sorge aus!“
- „Ich möchte dir helfen und Dir auch weiterhin zur Seite stehen“
Solche Worte drücken unsere Unterstützung aus, die wir dem Gegenüber anbieten möchten. Mit Unterstützung spreche ich hierbei den Hippocampus an. Er ist Teil des limbischen Systems und für unser Gedächtnis verantwortlich.
Ich erinnere (!) mein Gegenüber daran, dass ich weiterhin unterstützend da bin. Warum das so wichtig ist, kommt jetzt:
👉 M = Mitgefühl
Im gleichen Atemzug von Unterstützung möchte ich nämlich dann auch das M. – Mitgefühl ansprechen. Mitgefühl zum Ausdruck bringen ist zentral wichtig, um die Amygdala anzusprechen. Dieser kleine Mandelkern ist an der Entstehung von emotionalen Reaktionen beteiligt. Sie spielt wohl die entscheidende Rolle bei der emotionalen Bewertung von unseren Sinneseindrücken. In ihr entstehen Flucht- und Angstreaktionen sowie Wut und wutbasierte Handlungen.
Die Amygdala ist genauso wie der Hippocampus Teil des limbischen Systems. Sie ist für unsere ersten Reaktionen auf bedrohliche Situationen verantwortlich. Interessant ist, dass auch sie am Speichern von Gedächtnisinhalten beteiligt ist – jedoch entstehen bei ihr in erster Linie emotional gefärbte Erinnerungen – ein m.E. sehr wichtiger Aspekt!
- Der Hippocampus steht für das klare, emotionslose Erinnern.
- Die Amygdala dagegen erinnert sich an Erlebnisse immer in Kombination mit Emotionen – egal ob Gute, Negative oder Albtraumhafte…
Die Amygdala in der U.M.W.E.G.©-Methode anzusprechen, ist sehr, sehr wichtig, da Menschen in einer emotional starken Situation kurzfristig praktisch in einer emotionalen Demenz leben. Auch das ist wiedermal ein sehr wichtiger Gedanke! Wer Angst hat, kann sich an keine Vergangenheit erinnern! Er lebt in diesem einen Moment ohne Vergangenheit und hat auch keine Zukunft. Und weil dem so ist, ist es wichtig, das Gefühl / die Amygdala mit anzusprechen.
Das können dann solche Sätze sein wie:
- „Das alles muss gerade sehr bedrückend für dich sein.“
- „Es ist kaum vorstellbar, was du wohl gerade fühlst und auch durchmachst.“
- „Du musst bestimmt einen starken Schmerz fühlen bei all dem, was Du hier erlebt hast.“
Dieses direkte Ansprechen der Amygdala durch „M-Mitgefühl“ hilft, die „U-Botschaft“ (die Unterstützung) und damit auch die Arbeit des Hippocampus anzuregen.
Die Amygdala selber steht in direkter Verbindung
- zum Thalamus (dem Tor zum Bewusstsein),
- dem Hypothalamus (er produziert die Hormone welche dann unsere Organe beeinflussen wie z.B. unsere Sexualität)
- und dem Hippocampus, der bewusst Gelerntes in das Langzeitgedächtnis überführt.
Sie alle stehen für das Erinnern und unser Gedächtnis. Habe ich die Amygdala erst einmal in aller Ruhe angesprochen, sie durch die „M-Mitgefühl-Botschaft“ ein wenig beruhigt, dann setzt die klare und emotionslose Erinnerung an überstandene Probleme durch den Hippocampus deutlich schneller wieder ein. Das alles dient einem ganz bestimmten Zweck:
Es hilft, dass ich danach (!) endlich zu dem dritten und bestimmt auch wichtigsten Teil in der Akut-Kommunikation mit einem Borderliner übergehen kann:
Der dritte Bereich ist der W-Teil. „W-Wahrheit! …
Die Wahrheit erkennt an, was in Wirklichkeit Fakt und Sache ist – „was ist die harte Realität?“
7.3.2. Jeder ist für sich selbst verantwortlich
Die Wahrheit betont auch – und das ist jetzt endlich der zentrale Teil, auf den wir durch die Stufen eins und zwei wirksam hingearbeitet haben – dass jeder von uns (auch der Borderliner) im Endeffekt für sein eigenes Leben selbst verantwortlich ist. Alle anderen in der Umgebung können und dürfen ihre Hilfe zwar anbieten, jedoch ist er immer selbst für sein Leben verantwortlich und kann diese Verantwortung auch nicht an jemand anderes abgeben.
Das „masochistische Opferlamm“ – ein Begriff, der oft im Rahmen der typischen Borderline-Beschimpfungen aufkommt – kann nicht den Anderen für seine Situation zum Täter und sich selbst als Opfer hinstellen.
Vielleicht kennst du noch das Märchen „Tischlein-Deck-Dich“.
Die Ziege am Anfang der Geschichte, die sich über die drei Söhne wie ein Opfer beschwerte. Sie hat genau diese „Opfer-Täter-Umkehrung“ in Perfektion gezeigt: Was sagte sie nochmals nachdem sie von den Söhnen tagsüber versorgt wurde? „Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein: Mäh! Mäh!“ Diese Ziege war eine Täterin, indem sie sich fälschlicherweise dem Vater der Söhne als Opfer ausgab.
Und genau diesen Versuch – also die „Täter-Opfer-Umkehrung“ – unterbinden wir sehr effektiv durch die U.M.W.E.G.© Methode! Im Schritt eins erkennen wir mit Hilfe der direkten und persönlichen Aussagen durch U-Unterstützung und durch das M-Mitgefühl an, dass unser Gegenüber das Recht hat, sich im Moment so zu fühlen, wie er sich fühlt.
Das ist auch richtig so und bedeutet nicht, dass der Andere nun das Opfer sein darf. Denn … Wir dürfen hier nun auf gar keinen Fall stoppen! Denn jetzt kommen wir zu dem wichtigen und alles entscheidenden W-Teil, der Wahrheitsaussage. Die „W-Wahrheitsaussage“ vermittelt nämlich die ganz klare Aussage, dass ein Problem besteht und der Betreffende eine Eigenverantwortung hat. Er ist verantwortlich für sich selbst und nicht automatisch Opfer oder Täter!
7.3.4. Die U.M.W.E.G.©-Methode in der Praxis
Wie könnten diese drei Punkte (Unterstützung, Mitgefühl, Wahrheit) nun in einer akuten Krisensituation mit dem Borderliner ganz konkret angewendet werden?
In all den Jahren meines Kontaktes mit Borderlinern, habe ich mir folgende Formel ausgearbeitet und immer weiter adaptiert:
- „Sei dir sicher… Ich spüre deine Angst“ → (M-Mitgefühl).
- „Sei dir sicher, ich werde dich auch weiterhin unterstützen! (U-Unterstützung).
- „Die Wahrheit aber ist, dass … (W-Wahrheit)
- wir dieses konkrete Problem haben
- und ich hier auf Deine Unterstützung angewiesen bin.
- Was wäre nun Dein (!) Vorschlag und
- wie kann ich dir (!) dabei helfen, diesen umzusetzen?
- Denn ich möchte, dass WIR ein Team bleiben!!!
Diese einfache Kommunikationsformel mit der Borderline-Persönlichkeit umfasst alle drei Botschaften, angefangen mit der Ansprache der Amygdala und des Hippocampus und endet mit dem Ziel, den Präfrontalen Cortex für das Lösungsorientierte Gespräch zu öffnen.
Das bedeutet zwar nicht, dass ich hiermit nun eine 100 %ige Garantie dafür habe, dass – bei Verwendung – der Borderliner sie auch versteht und in sich integrieren kann. Es kann logischerweise weiterhin zu unvorhersehbaren Antworten und Reaktionen kommen, besonders wenn eine der Botschaften entweder nicht klar ausgedrückt oder vom Gegenüber einfach nicht „gehört“ wird. Jedoch lernt man Segeln nicht in einem Sturm. Zuerst kommt der „Trockenunterricht“ an Land, dann die Praxiserfahrungen bei ruhiger See. Erst dann kann ich raus in die „freie Wildbahn“ um mein theoretisches Wissen mit der Praxis abgleichen.
Oder – um ein weiteres Beispiel zu benennen – kannst du dich noch an deine ersten Fahrstunden nach (!) deiner bestandenen Fahrprüfung erinnern? Warst du da schon so geübt wie heute? Natürlich nicht. Was wir hierbei also benötigen ist Praxis, Praxis und nochmals Praxis…
7.3.5. Die Exit-Strategie – L.M.K.
Scheue Dich nicht, Fehler zu begehen! Habe auch keine Angst davor, dass dein Gegenüber eventuell doch nicht zu einer „normalen Kommunikation“ zurückkehrt. Denn auch dafür gibt es ganz am Schluss noch eine „Exit-Strategie“.
Sie ist ganz nach der Dichotomie der Kontrolle nach den stoischen Leitlinien aufgebaut: Wenn alles versucht wurde und du weiterhin beschimpft wirst, dann solltest Du nach der Formel „L.M.K.“ handeln.
👉 L.M.K. steht für: „Lebe mit Konsequenzen…“
Durch den W-Wahrheitsteil zeigen wir ja ganz konkret die Eigenverantwortung auf. Geht mein Gegenüber nicht darauf ein, dann müssen wir zu der Komponente „du trägst die Verantwortung für Dein Leben“ übergehen.
Oder, wie sagte nochmals Patrick Swayze zu seiner Tanzpartnerin Jennifer Grey in Dirty Dancing?
- „Das ist dein (!) Tanzbereich und das ist mein (!) Tanzbereich.
Frei übersetzt würde das in unserem Falle heißen: Dein Leben und deine Verantwortung sind nicht mein Leben und nicht meine Verantwortung.
Und seien wir mal ehrlich: Ist es nicht zutiefst beruhigend, von Anfang an in ein Gespräch zu gehen und den Gedanken im Hinterkopf zu haben, dass hier vieles entstehen kann, aber nichts muss?! Dies nimmt zumindest bei dir die Spannung aus dem Kopf. Und dieses entspannte Denken über das, was kommt, das vor einem liegende Gespräch, überträgt sich zwangsläufig auch auf dein Gegenüber.
7.4. Hanna und Lisa – Fallbeispiel Nr.1
Fallbeispiel 1 (viele werden in dieser Reihe noch folgen)
Die Protagonisten in diesem Falle sind eine Mutter und ihre Tochter (Anfang 20). Nennen wir die Mutter Hanna und die Tochter Lisa. Die Handlung war reell, die Namen sind verfremdet.
Hanna, die Mutter kam mit Anfang 20 Jahren aus einem anderen Land nach Deutschland und hatte eine sehr bewegte Kindheit / Jugend hinter sich.
Ihre Tochter Lisa kam später in Deutschland zur Welt. Der Vater war anderer Nationalität und Kultur. Die Eltern haben sich früh getrennt. Hanna hatte danach über mehrere Jahre eine Beziehung mit einem instabilen und teilweise aggressiven Partner.
Um ihr Kind zu schützen, steckte sie es über mehrere Jahre in ein Internat, sodass sich die Kontakte nur noch auf das Wochenende und die Ferien reduzierte. Stoisch ertrug Hanna all die Jahre die Demütigungen ihres Partners. In der Zwischenzeit bildete sich bei Lisa, die nun schon einige Jahre getrennt von ihrer Mutter lebte, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung aus.
Als Hanna und Lisa einmal miteinander essen gegangen sind, entstand ein Gespräch über verschiedene Themen. Eines davon war die Vegane Ernährung. Mit viel Emotion, auch einigen Tränen, erzählte Lisa wie Tiere unter den heutigen Mastbedingungen doch leiden. Die Gemüter stiegen plötzlich hoch, als die Mutter ihren eigenen Fleischkonsum erst einmal „verteidigte“.
Die nächste Stufe wurde dadurch gezündet, als die Mutter ein weiteres Glas Wein trank. Lisa, die kurz zuvor bei einer ambulanten DBT-Therapie war, wechselte nun das Thema und beharrte darauf, dass sich ihre Mutter mit dem Trinken von ihrer eigenen schweren Vergangenheit abwenden würde und deshalb selber eine Konfrontationstherapie benötige.
Wie könnte die U.M.W.E.G.©- Methode in diesem Falle helfen, eine Eskalation zu vermeiden?
- Nehmen wir zuerst einmal den Angriffspunkt „Vegan kontra Fleischkonsum“
Hanna könnte u.a. folgendes sagen:
- Ich spüre deine Liebe zu den Tieren, dass sie dir viel bedeuten und du immer das Wohl der Tiere im Blick hast. (M-Mitgefühl)
- Sei Dir sicher, dass ich Deine Entscheidung, dich soundso zu ernähren immer mit Respekt betrachte. (U-Unterstützung)
- Die Wahrheit aber ist, dass wir in der Entscheidung über unsere Ernährung alle frei sind, auch ich. Was wäre darum dein Vorschlag, wie wir beide mit diesem Thema umgehen? Wie kann ich dich darin unterstützen, damit wir weiterhin ein Mutter-Tochter-Team bleiben und nicht wegen solcher Themen unsere Liebe zueinander aus den Augen verlieren?
Kommen wir zu dem Punkt, dass Lisa ihre Mutter auffordert, über ihren Alkoholkonsum wegen eigener unbehandelter schwerer Erfahrungen therapeutisch nachzudenken?
Hanna könnte sagen:
- Ich spüre Deinen Wunsch, mir in meinem Leben auch eine Hilfe zu bieten. (M-Mitgefühl)
- Sei Dir sicher, dass ich dich dafür immer lieben und respektieren werde. (U-Unterstützung).
- Die Wahrheit aber ist, dass wir in diesem Punkt zwei verschiedene Ansichten haben und auch meine Sichtweise eine Daseinsberechtigung hat. Was könnten wir stattdessen deiner Meinung nach nun tun, um unsere beiden Gesichtspunkte nebeneinander bestehen lassen zu können?
Lass uns beide wegen diesen Themen nicht streiten, sondern weiterhin ein Team bleiben. (W-Wahrheit)
Du hast hier mit Sicherheit die zugrunde liegende Formel erkannt:
- Ich spüre bei dir… (Amygdala)
- Sei Dir sicher … (Hippocampus)
- Die Wahrheit aber ist … (Präfrontaler Cortex)
7.5. Wie geht es nun weiter in dieser Themenreihe?
Um dies alles noch weiter in die Praxis umzusetzen, werden wir uns in den kommenden Kapiteln mit folgenden Themen auseinandersetzen:
- Die Kommunikation trotz der 9 Kriterien der Borderline-Persönlichkeit aufrechterhalten. Wie kann ich den Super-GAU im Gespräch verhindern?
- Wie wir typisches Grenzverhalten der Borderline-Persönlichkeit durch eine ruhige, U.M.W.E.G.©-Kommunikation abmildern können.
Da betrachten wir Bereiche wie z.B.- Es ist ok sich schlecht zu fühlen
- Die sich ständig wechselnden Täter-Opfer-Rollen des Borderliners
- Durch Grenzen setzen dem Borderliner eine Stabilität im Leben geben.
- Die Suche nach dem Sinn im Leben
- Paranoide Gedanken des Borderliners
- Die Kommunikation im Drei-Schritt-Verfahren.
- Kommunikation durch einen neuen Standpunkt (“Danke, Danke, Danke”)
- Die Walk-to-talk-Methode. Oder anders ausgedrückt: Wie ich in 20 Minuten meinen Parasympathikus aktiviere.
- Warum Fasten in der Kommunikation für Ruhe sorgen kann? (Die „Wilde Hilde“). Die russische Geschichte des Fastens und der medizinische Nobelpreis des Jahres 2016.
- Wie aus einem Gedanken, eine Neigung, eine Haltung und dann eine Tugend machen? Eric Kandel und der medizinische Nobelpreis des Jahres 2000.
Es lohnt sich auf alle Fälle, bei diesem Thema weiterhin am Ball zu bleiben und auch die nachfolgenden Kapitel mit Aufmerksamkeit zu lesen. 😊.
___________________
Zusammenfassung Kapitel 7: U.M.W.E.G. – Die Kommunikation mit einem Borderliner
In diesem Kapitel haben wir nun gemeinsam das mächtigste Werkzeug für den Umgang mit Borderline kennengelernt: die U.M.W.E.G.-Methode.
Der praktische Nutzen dieser Methodik ist wirklich enorm, denn wir haben jetzt eine konkrete, anwendbare Formel an der Hand, die wir in Krisensituationen einsetzen können.
Wir verstehen immer besser, dass die Sprache nicht nur informiert, sondern gleichzeitig auch handelt und die Wirklichkeit verändert.
Die U.M.W.E.G.©Methode gibt uns eine strukturierte Vorgehensweise, die unabhängig vom chaotischen Verhalten des Gegenübers funktioniert.
Besonders wertvoll ist meines Erachtens die Erkenntnis über die neurobiologische Grundlage:
- Durch U-Unterstützung sprechen wir den Hippocampus an,
- durch M-Mitgefühl beruhigen wir die Amygdala, und erst dann können wir
- mit W-Wahrheit den präfrontalen Cortex für lösungsorientierte Gespräche öffnen.
Die Formel “Sei dir sicher, ich spüre deine Angst”. Sei dir sicher, ich werde dich weiterhin unterstützen. Die Wahrheit aber ist…” haben wir als praktisches Handwerkszeug erhalten.
Das Fallbeispiel mit Hanna und Lisa hat uns gezeigt, wie diese Methode konkret angewendet wird.
Die Exit-Strategie L.M.K. – “Lebe mit Konsequenzen” – gibt uns die Sicherheit, dass wir nicht in jeder Situation erfolgreich sein müssen. Für unseren Alltag mit von Borderline-Betroffenen ist dieses System Gold wert, denn es nimmt uns die Angst vor eskalierenden Gesprächen und gibt uns eine verlässliche Struktur.
Ausblick auf Kapitel 8: Kriterium 1 – Nähe/Distanz
Nachdem wir jetzt im Kapitel 7 das grundlegende Kommunikationswerkzeug erlernt haben, wenden wir uns nun dem ersten und vielleicht wichtigsten Borderline-Kriterium zu: dem verzweifelten Bemühen, ein Verlassenwerden zu verhindern.
Wir werden hierdurch verstehen, wie diese Angst vor dem Alleinsein alle anderen Symptome beeinflusst und warum sie die Wurzel so vieler Beziehungsprobleme ist. Wir werden lernen, dass die Wutausbrüche des Borderliners eigentlich Ausdruck dieser tiefen Verlustangst sind.
Besonders praktisch werden uns die drei konkreten Werkzeuge dabei helfen:
- Übergangsobjekte,
- das Vorbereiten von Trennungen und
- das Setzen vernünftiger Grenzen.
Wir werden dabei erfahren, warum ein getragenes T-Shirt als Übergangsobjekt fast schon therapeutisch wirksam sein kann und wie wir durch rechtzeitiges Ansprechen bevorstehender Trennungen Explosionen vermeiden.
Die Verbindung zur Autophobie wird uns helfen, das Verhalten dieser Menschen besser einzuordnen. Dieses Kapitel ist essentiell, denn ohne das Verständnis der Verlustangst können wir die U.M.W.E.G.©-Methode nicht optimal einsetzen und die tieferen Ursachen des Borderline-Verhaltens bleiben uns verschlossen.
Kapitel 8 – Kriterium 1 – Nähe / Distanz
Das Kriterium Nummer 1 der Borderline-Diagnose lautet: „Ein verzweifeltes Bemühen, ein Alleinsein / ein Verlassenwerden zu verhindern.
8.1. 9 Diagnosekriterien / 4 Ausprägungen
Im ICD 10 – den wir seit 1994 benutzen und im DSM – 5 werden neun Kategorien als Kriterien für die Borderline- Persönlichkeit beschrieben, von denen fünf deutlich genug vorhanden sein müssen, damit überhaupt erst einmal eine Diagnose gestellt werden kann. Dieses „deutlich genug“ war oft Grundlage heftiger Diskussionen. Was heißt das nun eigentlich „deutlich genug“?
Man hat sich hierbei auf Formulierungen geeinigt wie …:
- Unangemessen starke Reaktionen
- Übertriebene Affekte
- Wiederholtes / anhaltendes / chronisches Gefühl der Leere
- Neigung zu … Wutausbrüchen.
Auch im aktuellen ICD-11 wird diese Vorgehensweise – die Einteilung nach Kategorien – gebraucht. D.h., seit mehr als 40 Jahren sind die Diagnosekriterien der Borderline – Persönlichkeitsstörung praktisch unverändert geblieben. Dies zeigt, dass sie in der Praxis von Nutzen waren und auch weiterhin von Nutzen sind.
Auf den ersten Blick scheinen diese 9 Kategorien recht willkürlich miteinander in Verbindung zu stehen, oder auch gar nicht. Bei einem genaueren Hinsehen erkennt man jedoch, dass sie sehr viel mehr gemein haben und sogar in einer aktiven Wechselbeziehung zueinander stehen. Und ja, ein Symptom verstärkt ein anderes. Ähnlich wie ein Mikrofon die Stimme verstärken kann.
Die 9 Symptome der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem ICD-10 sind Folgende:
- Das verzweifelte Bemühen, ausgelöst durch eine reale oder eingebildete Angst, ein Verlassenwerden durch den Partner zu verhindern.
- Unbeständige und unangemessen intensive zwischenmenschliche Beziehungen. Unangemessen wegen andauernder Idealisierung oder Abwertung…
- Das Fehlen einer klaren Identität.
- Impulsivität bei selbstschädigendem Verhalten, z.B. durch Drogen– oder Alkoholmissbrauch, ständig wechselnde Sexualpartner (Promiskuität), Diebstahl, rasantes Autofahren, ungebremstes Essen (Binge-Eating).
- Immer wiederkehrende Selbstmorddrohungen bis hin zu Selbstmord-versuchen und NSSV (Nicht suizidale Selbstverletzungen).
- Sehr starke Stimmungsschwankungen und extreme Reaktionen auf Stress.
- Das chronische Gefühl von einer inneren Leere oder Langeweile.
- Unangemessen häufige und starke Wutausbrüche.
- Durch Belastung und Stress ausgelöste Gefühle bis hin zu einer vorübergehenden Paranoia.
Wenn wir uns diese neun Kriterien etwas näher anschauen, dann können wir 4 Hauptbereiche voneinander unterscheiden.
- Kriterium Nummer 1,6, 7,8: 👉 Stimmungslabilität.
- Kriterium Nummer 4,5: 👉 unkontrolliertes, gefährliches und impulsives Verhalten
- Kriterium 2,3: 👉 zwischenmenschlich krankhaftes (psychopathologisches) Verhalten
- Kriterium 9: 👉 Verzerrung / starke Abweichung im Denken und in der Wahrnehmung. Paranoide Vorstellungen und auch Dissoziation (z.B. Depersonalisation)
Um letztendlich die Diagnose Borderline stellen zu können, werden – wie gesagt – fünf der neun Kriterien benötigt, die im Leben des Betroffenen ein deutliches Leid oder eine deutliche Beeinträchtigung verursachen. Dadurch ergeben sich weit über 200 verschiedene Kombinationen von Symptomen und damit auch genauso viele unterschiedliche Formen einer Persönlichkeitsstörung.
Ein betroffener Borderliner, bei dem z.B. die Impulsivität und gefährliches, unkontrolliertes Verhalten überwiegt, wird sich ganz bestimmt anders verhalten als einer, dessen Hauptsymptom eher die Stimmungslabilität ist – also die Angst vor dem Verlassenwerden, das Gefühl der Leere und ein instabiles Selbstbild.
Diese Unterschiedlichkeit macht die Ansprache eines Borderliners und damit auch die Therapie unglaublich komplex, da man sich immer wieder neu auf eine gigantische Bandbreite an Verhaltensmustern einstellen muss.
Dieser Herausforderung stehen wir aber nicht ohne Hilfsmittel / Werkzeuge gegenüber:
Die besondere Technik der U.M.W.E.G©–Kommunikation hilft uns in fast allen dieser kritischen Bereiche, um eine Kommunikation mit der Borderline – Persönlichkeit zumindest für den Moment vor einer „akuten Kernschmelze“ zu bewahren. Wenn wir diese Methodik nun einmal auf die einzelnen Symptome ansetzen, brauchen wir sie jedes Mal nur ein wenig zu variieren, um eine Kommunikation weiter aufrechtzuerhalten. Darum möchte ich mich nun einmal konkret mit den einzelnen Borderline-Symptomen auseinandersetzen, um aufzuzeigen, welche Handlungs- und/oder welche Kommunikationsformen, bei welchen der einzelnen Kriterien am besten zum Erfolg führen könnten.
Wichtig ist hier das Wort könnte (also der Konjunktiv). Wenn ich im Konjunktiv spreche, dann denke ich hier – im Gegensatz zum Indikativ und Imperativ – an eine Möglichkeitsform. Sie KANN helfen, muss es aber nicht in allen Fällen. Darum wäre es gut, die angeführten Verhaltensbeispiele wirklich nur als Beispiele zu betrachten / als eine Handlungsmöglichkeit.
8.2. Kriterium Nummer 1
Schauen wir uns das Kriterium Nummer 1 für die Borderline-Persönlichkeitsstörung einmal näher an:
Die offizielle Beschreibung lautet:
- Es ist ein verzweifeltes Bemühen, ein reales oder auch nur vorgestelltes Alleinsein zu verhindern.
Es fällt auf, dass der Betroffene ein Problem mit seiner ERWARTUNGs-Haltung hat. Er „erwartet“ eine noch in der Zukunft liegende Handlung. Eine Erwartung, das ist ein gespanntes / angespanntes Warten, eine Hoffnung oder ein Glaube an etwas. Du spürst, dass bei einem Zuviel an Erwartung auch ein Zuviel an Spannung und Belastung entstehen kann. Und Anspannung und Belastung, das kennen wir aus dem Verhalten eines Borderliners nur zur Genüge.
- Den Umgang mit den Ängsten vor einem Verlassenwerden kennen wir auch aus dem Bereich der neurotischen Belastungsstörungen. Dort nennen wir es eine Autophobie (F40.2) oder: die krankhafte Angst davor, allein zu sein. Wer von einer Autophobie betroffen ist, der versucht genauso wie ein Borderliner sich mit allen ihm verfügbaren Mitteln vor einem Alleinsein zu schützen. Er möchte permanent unter Menschen sein und hat darum in der Regel auch einen sehr großen Bekanntenkreis, den er als „seine Freunde“ bezeichnet. Beziehungen werden besonders intensiv gepflegt und immer wieder neue Verabredung geplant. Der Freizeitkalender eines solchen Menschen quillt förmlich über mit Treffen und Verabredungen. Ist er in einer Beziehung, dann klammert er sich typischerweise an ihr fest, auch wenn er in ihr überhaupt nicht glücklich ist.
Das Verlangen – nicht allein zu sein – ist in solchen Fällen einfach stärker als der Wunsch zu gehen. Seine sozialen Kontakte dienen in erster Linie dem Ziel, seiner Angst vor einer Ablehnung und Einsamkeit zu entfliehen.
Begründet ist dieses Verhalten in den meisten Fällen auf seinen Erfahrungen aus der frühesten Kindheit. Die vielen Verlusterfahrungen oder auch die Zeiten der Einsamkeit in dieser wichtigen Entwicklungszeit erhöhen deutlich das Risiko, eine Autophobie zu entwickeln. Sie tritt auch nicht spontan auf – ganz im Gegenteil. Sie entwickelt sich oft schleichend, über Jahre hinweg.
Eine Ursache dafür kann sein, dass der Betroffene immer wieder die Wiederholung von schwierigen Erlebnissen – nennen wir sie ruhig Traumen – aus seiner Kindheit fürchtet, er sich in diese Angst dann krankhaft hineinsteigert und sich all das schließlich zu einer Autophobie entwickelt. Die Symptome sind oft recht deutlich zu sehen: Da ist die Verlustangst, das Schwitzen, ein erhöhter Puls, eine schnelle Atmung, Schwindelgefühle, Magen-Darm-Probleme, Übelkeit.
8.3. Wut aus Angst
Wenn wir uns mit den neun verschiedenen Kriterien der Borderline – Persönlichkeitsstörung befassen, dann fällt einem der übermäßige Zorn / die unangebrachten Wutausbrüche gerade bei den männlichen Borderlinern auf. Es mag deinen Einen oder Anderen in Erstaunen versetzen, aber diese Wut spiegelt tatsächlich eine innere Angst wider … die übergroße Angst vor dem Verlassenwerden. Wut und Angst … das sind zwei Kernmerkmale, die wir immer wieder beim Borderliner beobachten können. Diese Angst vor dem Alleinsein wirkt sich logischerweise auch auf die anderen Borderline – Kriterien aus, wie zum Beispiel
- dass seine Beziehungen oft instabil und zerbrechlich sind (Kriterium 2).
- Oder auf eine Identitätsstörung und ein nicht stabiles Selbstbild (Kriterium 3).
All das belastet logischerweise eine Partnerschaft, Freundschaft oder die Familienbande.
Wie aber kann solch eine Angst vor der Einsamkeit überwunden werden? Und wie kann man hier als Angehöriger eine Hilfe darstellen?
Eine spezifische Therapieempfehlung (also eine Empfehlung für den Einzelnen) gibt es leider nicht. Zwischenmenschliche Beziehungen sind einfach zu komplex und zu individuell. Es gibt jedoch einige sehr brauchbare „Werkzeuge”, mit deren Hilfe man dieses Problem wirksam angehen kann. Im Groben empfehle ich zwei unterschiedliche Herangehensweisen:
Frei nach Nietzsche: Wer weiß WARUM, dem ist das WIE nicht soooo wichtig:
- Um das WARUM (warum bin ich so?) zu ergründen, also welche Bindungserfahrungen haben in mir diese tiefe Angst vor dem Verlassenwerden erzeugt, benutzen wir in der Regel den tiefenpsychologischen Ansatz von Sigmund Freud.
- Die Einschränkungen im Alltag, die hierbei entstehen, können recht gut durch eine Verhaltenstherapie angegangen werden. Hier wird das WIE besonders betrachtet.
In einer Psychotherapie werden zuerst einmal die aktuellen Glaubenssätze und Verhaltensstrategien herausgearbeitet. Durch ein klares Besprechen des belastenden Verhaltens, kann dieses nämlich in aller Ruhe erst mal analysiert und dann durch Übungen langfristig verändert werden. „Speed out“ ist das Zauberwort: Um etwas schnell zu können, muss ich es erst in der Langsamkeit beherrschen.
Allein dadurch, dass neue Lösungswege für kritische Situationen im Alltag langsam entwickelt werden – die in der Vergangenheit zu Problemen geführt haben – können Betroffene oft zum ersten Mal in ihrem Leben endlich einen gesunden Umgang mit ihrer Angst vor dem Alleinsein entwickeln und das Leben und den Alltag nach ihren eigenen selbstständigen Vorstellungen gestalten, ohne sich permanent von ihrer Angst beherrschen zu lassen. Das gesprochene Wort, das Sprechen über eine Lösung – über eine Exit-Strategie – ist das wohl bemerkenswerteste Medikament in der Medizin überhaupt.
Viktor Frankl, der Begründer der Logotherapie, beschrieb die herausragende Wirkung des Sprechens in einem seiner Werke („Über den Sinn des Lebens“) bei ehemaligen KZ-Häftlingen nach ihrer Befreiung. Trotz der Befreiung durch die Alliierten, waren sie erstaunlicherweise nicht gleich freudig erregt; sie konnten sich nicht über die neue Freiheit freuen. Erst nachdem sie – zum Beispiel nach einem Essen – so langsam in ein Gespräch mit anderen kamen, löste sich ihre Zunge und sie fingen an zu reden. Dann – erst nach den Worten – kamen auch die Emotionen! Worte lösen Emotionen oft erst aus…
8.4. Welche Werkzeuge habe ich?
Drei Dinge möchte ich hier exemplarisch ansprechen:
- Übergangsobjekte
- Eine klare Ansprache des „Problems“
- Verlässliche – von beiden Seiten einhaltbare – Absprachen.
- Übergangsobjekte
Wir kennen diesen Begriff aus der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie von Donald Winnicott (1896 – 1971). Ähnlich einem Kleinkind mit seinem Teddy, einer Schmusedecke etc. können auch von Erwachsenen Übergangsobjekte eingesetzt werden.
Beispiel Kleidungsstück: Als eine von Borderline Betroffene wegen einer Hauterkrankung einmal in ein Krankenhaus eingewiesen wurde, hatte ihr Mann ihr sein zuvor auf der Haut getragenes T-Shirt dagelassen, welches sie sich dann immer wenn der Angstschub kam, über den Kopf zog um so den Partners wieder zu spüren. Solche Übergangsobjekte stellen bei kleinen Kindern die Mutter-Kind-Beziehung dar, beim Erwachsenen den „virtuellen Partner“. Es dient als Hilfsmittel, um eine Verbindung auch bei einer Trennung aufrechtzuerhalten.
Zwischenfrage: Sollte man denn wirklich zu einem solchen Hilfsmittel aus der Kleinkind-Entwicklung zurückgreifen? Wir sprechen hier doch von der Entwicklungsstufe eines Kindes im Alter von ca. 6 bis 12 Monaten? Hilft das auch bei einem Erwachsenen? Nun, meiner Beobachtung nach ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu Recht im ICD 10 in der Gruppe der (F60.30) emotionalen Instabilität eingestuft. Borderline ist – wie all die anderen Persönlichkeitsstörungen – anscheinend eine in der frühesten Kindheit nicht stabilisierte, unreife Persönlichkeitsstufe. Im Alter sprechen wir dann von einer Persönlichkeitsstörung.
Otto Kernberg beschreibt diese typische „Identitätsdiffusion” als eine Persönlichkeit mit der Konsistenz eines Wackelpuddings. Wenn ein Betroffener in seiner Kindheit also nicht genügend Stabilität bekommen hat, dann ist eine „Instabile Persönlichkeitsstörung“ oft die zwingende Folge hiervon.
Nochmals meine Frage: Sollte man nun wirklich zu einem Hilfsmittel aus der Kleinkind-Entwicklung zurückgreifen – zu einem Übergangsobjekt? Meine klare Antwort lautet: JA! Generell kommt kein Kind mit einer Persönlichkeitsstörung zur Welt. Seine bei der Geburt noch instabile Persönlichkeit wird normalerweise durch eine stabile Mutter-Kind-Beziehung stabilisiert. Erfährt es diese Stabilisierung jedoch nicht, dann kann diese – wenn auch nicht mit dem gleichen Erfolg wie im Kleinkindalter – therapeutisch nachgeholt werden.
- Vorbereiten:
Ein weiteres negatives Merkmal einer Borderline – Persönlichkeitsstörung ist es, unangenehme Dinge in der Zukunft typischerweise einfach auszublenden.
Steht zum Beispiel eine Trennung von dem Partner bevor – etwa wegen eines Kurzurlaubs mit Freunden oder wegen einer geschäftlichen Reise – dann wird dies komplett aus dem Bewusstsein verdrängt, bis zu dem Moment kurz vor dem Ereignis. Oftmals platzen dann aber die Emotionen förmlich heraus. Die Angst und die Panik vor einem generellen Verlassenwerden kommen dann explosionsartig nach oben.
Was also wäre hierbei am ehesten zu tun? Diese Situation erinnert mich irgendwie immer wieder an den verzweifelten Hilfeschrei von Menschen, die über Selbstmord laut nachdenken. Hier gilt für alle Außenstehenden: Auf gar keinen Fall weghören, sondern dieses Thema an- und durchsprechen, dem Betroffenen seine volle Aufmerksamkeit schenken und nötigenfalls auch professionelle Hilfe anfordern.
Diese Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren zum Glück immer mehr in den Köpfen der Gesellschaft etabliert. Bis zu einer Suizidalität geht es bei der Angst des Borderliners vor einer Kurzreise des Partners in der Regel zum Glück nicht. Jedoch ähneln sich meines Erachtens die Herangehensweisen an dieses Gefühl sehr deutlich: Wir sollten diese Situation dann auch mit klaren Worten offen und direkt ansprechen – auch auf die Gefahr hin, den Partner damit für den Augenblick eventuell stark zu belasten.
Diese Angst vor einer Belastung des Borderliners kommt meiner Meinung nach aber aus einer ganz anderen Richtung… Oft geht es nämlich gar nicht um ein Mitgefühl für den Borderliner, sondern viel eher darum, dass sich der Angehörige / der Partner / der Freund dann von den erwarteten Emotionen eher überfordert oder angewidert fühlt. Darum weicht er ihm aus, indem er Probleme gar nicht erst anspricht. Das bevorstehende Ereignis sollte aber klar und deutlich – am besten mehrfach – angesprochen werden. Toll wäre es, wenn man hierbei dann noch eine positive Ergänzung mit einfließen lässt…
Was spricht denn zum Beispiel dagegen, am Vorabend der Reise etwas gemeinsam zu unternehmen … ins Kino, ein gemeinsamer Restaurantbesuch oder anderes? Die Möglichkeiten hierfür sind nahezu unbegrenzt und das Ergebnis überträgt sich dann in Form einer sichtbaren Beruhigung auf den Partner. Für den Zeitraum der Trennung könnte man dann auch nach anderen Möglichkeiten suchen, durch die sich der Partner geborgen fühlen kann.
Das können vorher vereinbarte Treffen mit Freunden, zum Beispiel zum Sport, sein. Sind beide in einem Verein? Dann kann der Partner dort auch vertretungsweise mal alleine hingehen.
Sofern solche Reisen / Kurze Trennungen öfter stattfinden, könnte man auch über ein Haustier nachdenken. Der Wert eines solchen „tierischen Freundes“ kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
- Vernünftige Grenzen neu festlegen – Stabilität anbieten
Die oft sehr starken Forderungen in Form von instabilen Affekten eines Borderliners ähneln meiner Beobachtung nach tatsächlich denen eines Kleinkindes seiner Mutter gegenüber. Dieser Vergleich kommt nicht von ungefähr! Und weil dem so ist, ist es auch nachvollziehbar, dass ein Partner solch einem starken Verlangen gar nicht in der erhofften Intensität und Menge nachkommen kann, geschweige denn nachkommen möchte.
Was wäre mein Ratschlag in diesem Falle?
50% von 100% sind besser als 0% von 100% 😊
Wenn die Bedürfnisse des Partners nicht zu 100% erfüllt werden können, dann heißt dies nicht, dass man sich nicht auf eine Zwischenlösung einigen könnte.
Ich denke hier an den Fall einer ca. 30-jährigen Frau mit BPS, deren Mutter selber eine Persönlichkeitsstörung aufwies.
Ihre Mutter forderte von ihr – sie wohnte schon seit Jahren nicht mehr zu Hause und befand sich auch in einer eigenen Partnerschaft – dass sie sich täglich bei ihr meldete um sowohl über ihr Leben Bericht zu erstatten, aber auch den Sorgen und Nöten der Mutter zuzuhören. In solch einem Falle ist es mehr als ratsam, einen neuen Rahmen abzustecken, den beide Seiten auf Dauer auch erfüllen können. Das heißt aber nicht, den Kontakt zur Mutter auf 0% zu reduzieren! Vielmehr diesen auf ein für beide Seiten gesundes Maß zu bringen.
Wie kann uns hier die U.M.W.E.G.©-Methode weiterhelfen, zumindest eine gewisse Beziehung verlässlich aufrechtzuerhalten?
Nun, das Gespräch zwischen Tochter und Mutter könnte z.B. auch so verlaufen:
„Ich spüre Mama, dass du durch meine Entscheidung enttäuscht und vielleicht auch etwas frustriert bist.
Sei Dir aber sicher, dass ich immer Deine Tochter bleiben werde.
Die Wahrheit jedoch ist, dass ich dich nicht jeden Tag kontaktieren kann, Mama. Mein Vorschlag wäre, dich mindestens einmal pro Woche in einem Zeitfenster – wenn es mir möglich ist – anzurufen. Vielleicht könnten wir uns dann ja auch einmal im Monat zu einem Essen regelmäßig treffen, um die Zeit angenehmer zu gestalten.“
Das Ziel der U.M.W.E.G.© Methode ist es nicht, einen Therapie-Ersatz darzustellen, sondern einzig und allein ein kritisches Gespräch am Laufen zu halten und es nicht in eine Explosion abdriften zu lassen. In den überwiegenden Fällen ist beiden Seiten damit auch längerfristig geholfen. Viele Themen werden nicht zum Problem, viele Probleme werden nicht zur Katastrophe.
___________________
Zusammenfassung Kapitel 8: Kriterium 1 – Nähe/Distanz
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam das Herzstück der Borderline-Störung durchleuchtet: die verzweifelte Angst vor dem Verlassenwerden.
Der praktische Nutzen liegt nun darin, dass wir jetzt besser verstehen, wie die neun Diagnosekriterien in vier große Hauptbereiche gegliedert sind und dass dabei über 200 verschiedene Kombinationen möglich sind.
Besonders wertvoll war die Erkenntnis, dass die Wutausbrüche des Borderliners eigentlich ein Ausdruck seiner tiefen Verlustangst sind – Wut entspringt einer tiefsitzenden Angst.
Wir haben gelernt, die Verbindung zur Autophobie zu erkennen und verstehen nun, warum Borderliner sich an Beziehungen festklammern, auch wenn sie darin unglücklich sind.
Die drei konkreten Werkzeuge sind Gold wert für unsere Praxis:
- Erstens Übergangsobjekte wie das getragene T-Shirt, das sogar therapeutisch wirksam sein kann, weil wir hier an der unreifen Persönlichkeitsstufe ansetzen.
- Zweitens das rechtzeitige Vorbereiten von kurzfristigen Trennungen durch mehrfaches Ansprechen und positive Rituale am Vorabend.
- Drittens das Setzen vernünftiger Grenzen nach dem Prinzip “50% von 100% sind besser als 0%”.
Das Beispiel mit der Tochter und ihrer fordernden Mutter hat uns gezeigt, wie die U.M.W.E.G.©Methode konkret hilft, von täglichen Anrufen auf wöchentliche Kontakte umzustellen.
Viktor Frankls Erkenntnis, dass Worte Emotionen erst auslösen, unterstreicht die Macht unserer therapeutischen Gespräche.
Ausblick auf Kapitel 9: U.M.W.E.G. – Kriterium 2
Nachdem wir die Verlustangst verstanden haben, wenden wir uns jetzt dem zweiten Kriterium der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem DSM 5 zu: den intensiven und instabilen Beziehungen mit ihrem ständigen Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung.
Du wirst beim Lesen besser verstehen, warum die Welt des Borderliners nur schwarz oder weiß ist, ohne Grautöne.
Besonders praktisch wird die Drei-Schritt-Methode sein: Schulter berühren, zurückziehen mit Augenzwinkern, Kaffee anbieten und den Raum verlassen. Diese Technik nutzt die kognitive Überforderung, um Eskalationen zu vermeiden.
Wir werden lernen, wie wir auf Idealisierungen reagieren sollten, ohne uns zu rechtfertigen, und wie wir Abwertungen begegnen, ohne uns zu verteidigen.
Das vierte der 36 Kriegsstrategeme – ausgeruht auf den erschöpften Feind warten – zeigt uns, wie wichtig Vorbereitung ist.
Die Drei-Spalten-Methode für Reden wird dir helfen, dich auf typische Angriffe vorzubereiten.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn die Schwarz-Weiß-Spaltung ist der Kern vieler Beziehungsprobleme, und ohne Werkzeuge für dieses Phänomen bleiben wir hilflos im emotionalen Strudel gefangen.
Kapitel 9 – U.M.W.E.G. – Kriterium 2
Das Kriterium Nummer 2 der Borderline-Diagnose lautet: Intensive, dabei oft auch fragile / instabile zwischenmenschliche Beziehungen. Begleitet von einem ständigen Wechsel zwischen einer Idealisierung und Abwertung des Partners.
„Unsere Welt ist eine Welt voller Farben und Schattierungen…“ So ein Satz klingt erst einmal ganz normal für uns. Schließlich können wir mit unserem Auge rund 3 Millionen Farbnuancen erkennen. Für einen Borderliner ist die Vielfalt des Lebens jedoch eine große Hürde im Leben. Für ihn ist die Welt – um bei dem Farbvergleich zu bleiben – lediglich in schwarz oder weiß unterteilt. Er kennt keine Schattierungen oder Abstufungen in den Grautönen … Nur entweder oder …
Besonders in Beziehungen gibt es für ihn nur zwei Zustände: Der Gegenüber, der Partner, der Freund oder der Familienangehörige ist in seinen Augen entweder eine engelsgleiche Lichtgestalt oder – aufgrund irgendeiner Geringfügigkeit – ein dämonischer Teufel. Der Urzustand der Spaltung, ein unreifer Lernzustand der Persönlichkeitsentwicklung.
Diese Unberechenbarkeit im Umgang mit Außenstehenden, diese völlig instabile Betrachtung der Umgebung und anderer Menschen, spiegelt zu 100% das unsichere / instabile Selbstempfinden des Borderliners wider (Kriterium Nummer 3 – die Identitätsstörung).
Wie können wir mit dieser Instabilität jetzt professioneller umgehen? Nun, wenn von außen keine Stabilität zu erwarten ist, dann liegt es erst einmal an uns, diese zu bieten.
So viel Ruhe wie möglich, jedoch mit Konsequenz wo nötig.
9.1. Weder Engel noch Teufel, wieder Held noch Looser
„Hier bin ich, ich kann nicht anders“ Martin Luther (1521)
„Und sie bewegt sich doch“ Galileo Galilei (1564-1642)
Wenn ich von meinem Partner, einem Angehörigen, einem Freund mit einer Borderline-Störung als ein Engel bezeichnet werde, wie sollte ich da reagieren? Mein erster Rat wäre: Weise diese positive Idealisierung im ersten Moment nicht ab, obwohl du ganz genau weißt, dass sie nicht der Realität entspricht. Solch eine positive Übertreibung kann man einfach mal ohne große Diskussion im Raum stehen lassen – erst mal als gesagt akzeptieren. Was aber zu Verwirrung führen würde, wäre eine Rechtfertigung wie zum Beispiel: „Mein lieber Schatz, ich bin alles, aber kein Engel. Ich bin nicht so toll und vollkommen wie du mich hier darstellst.“
Warum wäre dies im Umgang mit einem Borderliner problematisch? Nun, die Botschaft hinter der Rechtfertigung wäre für Dein Gegenüber: „Du bist zu blöde, um mich richtig einzuschätzen.“ Und so absurd sich dies für dich zuerst auch anhört, sie führt dann zu den typischen Borderline-Reaktionen, die wir als Wut–Explosion kennen (Kriterium Nr. 8)
Fallbeispiel Nr. 2: Manfred & Frauke
Nennen wir ihn – um die Situation wieder einmal zu anonymisieren – Manfred und sie Frauke. Frauke, eine Mutter mit fünf Kindern, lernte Manfred über ihre Arbeit kennen. Manfred hatte zuvor seine Frau durch eine schlimme Krankheit verloren und war nun mit zwei Kindern Witwe. Sie bewunderte ihn, wie sanft und verständnisvoll er doch ist und wie er sie auch in allen Dingen versteht.
Sehr schnell zogen sie zusammen, da Manfred über ein großes Haus verfügte und damit auch Platz für sieben Kinder und zwei Erwachsene einrichten konnte.
Manfred baute das gesamte Haus nun um und wurde dafür von Frauke bewundert. Er setzte sich nun dafür ein, das recht instabile und chaotische Leben von Frauke zu ordnen… Dazu gehörten nicht nur räumliche, sondern auch finanzielle Probleme… Er sorgte z.B. dafür, dass ihre private Insolvenz in geordneten Bahnen ablief und kümmerte sich dann auch um weitere Angelegenheiten ihres täglichen Lebens.
Mit der Zeit kam es jedoch so, wie es kommen musste: Frauke fühlte sich immer mehr von Manfred bevormundet und zog sich innerlich zurück. In einem Haus wohnten nun auf einmal zwei getrennte Familien… Noch nicht einmal die Mediation vor Ort konnte hierbei eine Verbesserung erbringen. Logischerweise war Manfred sehr verwirrt und zog sich auch zurück. Das Paar trennte sich dann nach einiger Zeit. Mein Fazit: Leider klappt es darum nicht immer
9.2. „Ich stehe dazu – übernehme Verantwortung – distanziere mich jedoch vor Demütigungen!“
Dieses instabile und wechselvolle Verhalten eines Borderliners kann von außen oft – wenn überhaupt — nur sehr schwer nachvollzogen werden.
Peter Fonagy – Begründer der MBT „Mentalisierungsbasierte Psychotherapie” – rät dazu, durch aktives Mentalisieren die abrupten Veränderungen in der Haltung des Borderline – Angehörigen zu verstehen. Was sollte dabei wie geschehen? Das Zauberwort hierbei ist „offenes Visier“:
- Bestätige deinem Gegenüber, dass du seinen Ärger über dich registrierst und den Grund seines Ärgers nachvollziehen kannst. D.h. jedoch nicht, dass du ihn akzeptierst! Es ist lediglich die Bestätigung darüber, dass du den Grund seines Ärgers anerkennst. Wichtig dabei ist, dass eine Verteufelung deiner Person nicht automatisch akzeptiert wird.
Wir könnten hier z.B. mit der U.M.W.E.G.©– Methode antworten:
- (1) Sei Dir sicher, ich spüre und verstehe, dass du frustriert und wütend auf mich bist, weil ich die Spülmaschine (dies nur als Beispiel) nicht richtig eingeräumt habe.… Hier wird zuerst die Amygdala – die Emotionalität – angesprochen.
- (2) Denke aber bitte auch daran, dass ich dies in der Vergangenheit immer wieder in vernünftigem Maße getan habe.… Dies gilt dem Hippocampus – dem „trockenen Gedächtnis“.
- (3) Nun war ich aber unter großem Zeitdruck und konnte es nur oberflächlich machen … Dies ist die Ansprache des Präfrontalen Cortex.
Wieso immer diese Reihenfolge?
- Amygdala / Hippocampus und dann erst:
- Präfrontaler Cortex
Nun, wenn die Amygdala erst einmal so richtig „feuert”, dann befindet sich mein Gegenüber in einer emotionalen Demenz. Und diese Demenz ist nicht zu unterschätzen! Ich muss ihn immer wieder – auch wenn ich 5 Minuten vorher dasselbe gesagt habe – daran erinnern, dass ich die Gefühle meines Gegenübers verstehe, diese respektiere und auf seiner Seite stehe…
Dann erst, und wirklich erst dann (!) kann ich auf den dritten Punkt, den Wahrheitsgehalt der U.M.W.E.G.©-Methode übergehen.
Was heißt das nun für die Praxis? 👉 Die “Drei-Schritt-Methodik”
Nachdem ich diese drei Sätze / Gedankengänge angesprochen habe, sollte ich mich tunlichst nicht weiter verteidigen (wichtig). Warum? Weil wenn ich mich danach noch weiter erkläre, riskiere ich lediglich, die explosionsartige Wut meines Gegenübers zu steigern. Manchmal ist es wirklich am besten, sich einfach nur zu entschuldigen – auch wenn man sich nicht schuldig fühlt. Man kann sich auch nur dafür entschuldigen, dass der andere enttäuscht ist… und anschließend nicht näher darauf eingehen. Sehr hilfreich ist zum Beispiel die so genannte „Drei-Schritt-Methode”.
Diese Methodik habe ich aus meinen Studien zur Hypnose gezogen. Das Prinzip der Hypnose ist es ja, durch einen kurzen Moment einer psychischen Überforderung des Gegenübers, seine Abwehrreaktionen herunter zu regulieren…
Wie läuft die „Drei–Schritt–Methode“ nun ab?
Schritt (1):
Ich gehe auf mein Gegenüber zu und berühre ihn kurz an der Schulter. Dies lässt ihn sich kurzfristig stark anspannen. Es erhöht die Anspannung.
Schritt (2):
Sofort ziehe ich mich aus seiner Intimzone wieder zurück und zwinkere ihn mit einem leichten Augenzwinkern kurz an. Die Folge: Irritation.
Schritt (3):
Ich sage „Ich brauche mal einen Kaffee… “Möchtest du auch einen?“
Und ohne eine Antwort abzuwarten, drehe ich mich um, verlasse möglichst den Raum und gehe einen Kaffee oder etwas anderes trinken… Die Folge: Noch mehr Irritation und offene Fragen.
Diese Methodik hat bereits in sehr sehr vielen Fällen geholfen, den Gegenüber von seiner ersten Wut und seinem Zorn abzulenken und die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen…
Warum dieses Vorgehen? Nun, durch die Anspannung (Schritt 1), den sofortigen Rückzug mit einem Zwinkern (Schritt 2) und das anschließende Anbieten eines Getränkes gefolgt von einem Wegdrehen (Schritt 3) sind mehrere Handlungen, die
- gewöhnlich nicht in einem Streit vorkommen und
- die das Gehirn / seine Kognition vom Streit ablenken und für gewöhnlich auch überfordern
Vergleichen könnte man dies indem man zwei oder drei Bälle gleichzeitig fangen müsste. Fast jeder von uns wäre davon überfordert. So auch hier… Und die Überforderung hat ein wichtiges Ziel: Vom Streit ablenken, um eine „Kommunikations-Kernschmelze“ zu verhindern.
9.3. Das vierte der 36 Kriegsstrategeme – Vorbereitung ist alles
- Bibelbuch der Sprüche 27:12 der Kluge sieht die Gefahr, weicht ihr aus, die Unerfahren aber gehen weiter und bekommen, die Folgen zu spüren
- Louis Pasteur der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist…
- Ausgeruht auf den erschöpften Feind warten – Strategem Nummer 4.
All diese Zitate zeigen, wie wichtig eine Vorbereitung auf eine wahrscheinliche Konfrontation ist. Bei dem letzten Zitat handelte es sich um das vierte der 36 Kriegslisten (Strategeme), welche in der chinesischen Kultur seit Jahrhunderten bekannt und gelehrt werden. Auch wenn wir hier über eine Kriegslist sprechen, so ist der Nutzen hiervon auch auf die Kommunikation im „normalen Leben“ übertragbar.
Ein politisch aktiver Mann ließ sich mal eine Zeitlang von mir in seiner Rededarstellung coachen. Er fühlt sich immer wieder stark verunsichert, wenn er bei seinen Reden vor einem großen Auditorium immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen wurde. Was war unser Lösungsansatz? Wir haben uns vorbereitet! Seine Reden hat er zuerst einmal auf ein DIN-A 4-Blatt geschrieben, welches quergelegt, in drei Spalten unterteilt wurde.
- In der Spalte 1 ganz links schrieb er erst einmal seine Rede…
- Einen Tag später fing er dann an, in der Spalte 2 all die Einwürfe und Widersprüche aufzuschreiben, die seiner Meinung nach aus dem Zuhörerraum kommen müssten.
- Wiederum einen Tag später – es ist wichtig, sich durch eine Nachtruhe einen zeitlichen / emotionalen Abstand zu der Arbeit zu verschaffen – setzte er sich dann hin und schrieb all die Kommentare auf, die ihm als rhetorische Konter dazu einfielen.
In wirklich aller kürzester Zeit wurde er ein sehr brillanter Redner und konnte diese Form der Vorbereitung zu seinem Markenzeichen machen. Denn seien wir mal ehrlich … All die Sprüche, die uns in Verlegenheit bringen, ähneln sich in der Regel. Meist müssen wir uns nur auf maximal 5 unterschiedliche Gruppen an Zwischenrufen oder Beleidigungen vorbereiten und sind dann für alles Weitere ebenso gewappnet.
Sich auf etwas vorzubereiten, wie mein Borderline-Partner reagieren könnte, hilft kolossal, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu halten. Was spricht zum Beispiel dagegen, sich vor einen Spiegel zu stellen und immer wieder die eine oder andere Methodik einzuüben? Dies haben alle großen Redner und Darsteller gemacht. Warum also nicht auch Du? Wenn ich weiß, wie ich mich auf eine Katastrophe vorzubereiten habe, bin ich innerhalb der Katastrophe sehr viel ruhiger und ich lasse mich nicht so leicht von Emotionen blockieren…
Wenn ich mir im Vorfeld verschiedene Exit-Strategien („Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Kaffee“) überlege und diese dann später einsetze, kann ich hierdurch so manche kommunikative Kernschmelze viel besser vermeiden.
Die U.M.W.E.G.©- Methode ist meines Erachtens die effektivste Profilachse und Prophylaxe ist typischerweise viel, viel günstiger als eine Nachbehandlung…
_____________________
Zusammenfassung Kapitel 9: U.M.W.E.G. – Kriterium 2
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam das Phänomen der Schwarz-Weiß-Spaltung durchdrungen. Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt verstehen, warum die Welt des Borderliners nur aus Engeln oder Teufeln besteht, ohne die drei Millionen Farbnuancen, die wir sehen können.
Besonders wertvoll war die Erkenntnis, dass wir Idealisierungen nicht ablehnen sollten, da eine Rechtfertigung wie “Ich bin kein Engel” vom Borderliner als “Du bist zu blöd, mich richtig einzuschätzen” verstanden wird und zur Wutexplosion führt.
Das Fallbeispiel mit Manfred und Frauke hat uns gezeigt, wie schnell die Idealisierung in Abwertung umschlagen kann.
Die Drei-Schritt-Methode angelehnt aus der Hypnosetechnik ist Gold wert: Schulter berühren, zurückziehen mit Augenzwinkern, Kaffee anbieten und Raum verlassen. Diese kognitive Überforderung unterbricht die Eskalationsspirale.
Peter Fonagys Mentalisierungsprinzip mit “offenem Visier” haben wir als Werkzeug kennengelernt: Den Ärger registrieren und verstehen, aber nicht die Verteufelung akzeptieren.
Die Drei-Spalten-Methode zur Vorbereitung auf typische Angriffe gibt uns strategische Sicherheit.
Das vierte Kriegsstrategem lehrt uns, dass Vorbereitung alles ist – wer seine Exit-Strategien kennt, bleibt in der Krise ruhiger.
Ausblick auf Kapitel 10: U.M.W.E.G. – Kriterium 3
Nachdem wir die Schwarz-Weiß-Spaltung verstanden haben, wenden wir uns im nächsten Kapitel dem eigentlichen Kern der Borderline-Störung zu: der Identitätsstörung.
Du wirst beim Lesen besser verstehen, warum Borderliner sich immer wieder fragen “Wer bin ich wirklich?” und warum sie sich wie Chamäleons nach ihrer Umgebung richten.
Besonders praktisch werden die sechs Werkzeuge sein:
- Das Mentalisieren zur Deeskalation,
- das Beenden des Täter-Opfer-Spiels durch direkte Ansprache,
- das Prinzip “So wie es ist, ist es ok” mit dem biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn,
- die Stabilität von außen durch Vereine und Gruppen als “Außenskelett”,
- das Diplomzimmer als tägliches Ritual zur Selbstwertbildung und
- der Leuchtturm als Metapher für unveränderliche Stabilität.
Du wirst lernen, dass Traumen unbewältigte Erlebnisse sind und die Identitätsstörung aus dieser Fragmentierung entsteht. Das Leuchtturm-Prinzip wird dir zeigen, warum du nicht hinterherlaufen solltest, sondern an deiner Position bleiben musst. Dieses Kapitel ist fundamental, denn ohne ein stabiles Ich können wir keine gesunden Beziehungen führen, und als Freunde, Partner oder Angehörige müssen wir einfach verstehen, wie wir diese Stabilität von außen bieten können.
Kapitel 10 – U.M.W.E.G.© – Kriterium 3
Das Diagnose-Kriterium Nummer 3 für die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreibt die Identitätsstörung. Eine ausgeprägte Instabilität über das eigene Bild / das Gefühl für sich selbst…
Wir bezeichnen uns gerne als Individuum, als eine Entität oder ein einzelnes von anderen klar unterscheidbares Wesen. Der Begriff Individuum stammt von dem lateinischen Wort „individuum“ (ein unteilbares Einzelding) ab. Ein unteilbares Ganzes, eine nicht in sich zerstückelte, fragmentierte oder gespaltene Persönlichkeit – ein wünschenswertes Ziel. Doch auf dem Weg zu einem Individuum, erlebt jeder Mensch eine Vielzahl an Dingen, die er mit seiner Psyche irgendwie be- und verarbeiten muss. Vieles bleibt hierbei auch auf der Strecke.
Ein psychisches Trauma entsteht dann, wenn Erlebnisse so überwältigend sind, dass sie von der Psyche (besonders von der eines Kleinkindes) nicht bearbeitet / bewältigt werden können. Merke: Traumen sind nicht bewältigte Erlebnisse. Wenn ich etwas jedoch unbewältigt weglasse oder verleugne, dann bin ich „nicht ganz“, dann bin ich kein unteilbares Individuum.
Die Frage nach der eigenen Identität kommt also besonders intensiv bei denjenigen auf, die in ihrem Leben viele unbewältigte Lebenserfahrungen erleben mussten. Darum ist sie auch ein berechtigtes Kriterium bei der Diagnose Borderline. Wie kann ich als Betroffener selbst oder als Partner / Angehöriger am besten mit diesem Kriterium umgehen? Gibt es hierfür überhaupt Hilfsmittel?
Lass mich dir im weiteren Verlauf einige Vorschläge unterbreiten, welche sich in der Praxis in vielen Situationen bereits bewährt haben.
Wir sprechen im Einzelnen über folgende sechs Hilfsmittel:
- Mentalisieren – die gemeinsame Sprache finden
- Das Täter-Opfer-Spiel beenden
- So wie es ist, ist es ok
- Stabilität von außen
- das Diplom-Zimmer
- Der Leuchtturm
Zur Wiederholung: Das Kriterium Nummer 3 einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Identitätsstörung. Damit ist ein ausgeprägt instabiles Bild über das eigene Ich / die eigenen Gefühle gemeint.
Identitätsstörung … Das Wort Identität kommt – wie so oft aus dem Lateinischen… „Identitas“ oder „Idem“ steht für „Derselbe“. „Wer aber bin ich wirklich? Bin ich überhaupt jemand? Darf ich überhaupt jemand sein? „Ich kann mich nicht daran erinnern, mir jemals sicher gewesen zu sein, wer ich eigentlich bin.“
Solche Gedankenschleifen sind typisch für die innere Zerrissenheit / die Spaltung eines Borderliners und wirken sich logischerweise auch auf seine Beziehungen mit anderen aus … Im Umgang mit anderen fühlen sie sich, als seien sie nie genug. Sie richten sich schnell – wie ein Fähnchen im Winde – nach den Meinungen der Umgebung. Wir kennen diese Denke vom Perfektionismus – ein Phänomen unserer heutigen „Hochglanz-Social-Media-Zeit“. Nur dass es beim Borderliner um ein Vielfaches stärker auftritt. Durch ihre jahrelang bestens geschulten „Außen-Antennen“ sind sie in der Lage – ähnlich einem Kraken seine Farbe — die eigene Identität hinter den verschiedensten Masken zu verbergen.
Auf einer politischen Veranstaltung wären sie dann
- ein Christdemokrat unter Christdemokraten.
- ein Linker unter Linken.
Oder bei einem Fußballspiel … - B. ein Schalke-Fan unter „Schalkern“ 😊
Abends aber, wenn er / sie dann ganz alleine mit sich selbst in der eigenen Wohnung sitzt, dann weiß er gar nicht mehr so recht, was er nun wirklich von sich glauben soll. Für ihn ist es fast unmöglich, selbst an eigenen Zielen, Interessen, an Transzendentien oder an Lebensvisionen festzuhalten. Er ist oft nicht in der Lage, längere Verpflichtungen einzugehen, und das weder im Beruf noch in der Ausbildung und erst recht nicht in Beziehungen.
Die Folge davon? Oftmals ein Gefühl von ohrenbetäubender Leere – was uns dem Borderline-Kriterium Nr. 7 näher bringt. Um diese Leere irgendwie zu bekämpfen, verfallen viele dann in genau das entgegengesetzte Extrem: In einem hektischen Aktivismus klammern sie sich dann an Gruppen, die einem von außen eine Identität zuschreiben. Ich denke hier sowohl an religiöse Gruppen, Straßengangs, aber auch stark einnehmende Vereine im Bereich Sport, Politik, Gesellschaft. Typisch ist dann eine sektenähnliche Denke, deren dogmatische Kultur einem dann vorschreibt, wie man zu denken, fühlen oder auch zu handeln hat. Lass uns nun einige Werkzeuge näher beleuchten um zu sehen wie sie uns helfen können, mit einer Identitätskrise besser umzugehen:
10.1. Durch Mentalisieren eine „gemeinsame Sprache“ finden…
In den katastrophalen Momenten, wenn das Ich-Gefühl des Borderliners schwankt und sich eine zwischenmenschliche Kernschmelze ankündigt, sind Worte / ein kognitives Gespräch praktisch nicht mehr möglich. Frust, Angst, Misstrauen und Widerstand scheinen dann oft die einzigen noch verbleibenden Emotionen sein, zu denen der Borderliner fähig ist. Und wenn die Amygdala einmal Orgien feiert, die Emotionen förmlich überkochen, dann spielt ab da nichts, aber auch gar nichts mehr eine Rolle, was das Gegenüber sagt oder tut… es ist alles „verbrannte Erde“. Dann gibt es keine Gewinner mehr, aber eine Menge Verlierer…
Zu einer Eskalation benötigt man aber immer zwei Teilnehmer! Und ein Werkzeug, um selbst im „kühlen Denken“ zu bleiben, ist das Mentalisieren.
Mentalisieren beschreibt die von jedem trainierbare Fähigkeit
- zu erkennen, welche seelischen Vorgänge dem eigenen oder dem Handeln des Gegenübers zugrunde liegen.
- Aber auch, was in der Vergangenheit der Auslöser für ein bestimmtes Handeln oder Denken war.
Diese Fähigkeit hat zwar jeder von uns, jedoch ist sie bei jedem einzelnen unterschiedlich trainiert. Um sie nun in die Praxis anzuwenden und der Dynamik ein wenig Luft zu verschaffen, kann die U.M.W.E.G.©-Methode von großem Nutzen sein. Durch sie können wir nämlich in aller Ruhe zuerst einmal die Emotionen ansprechen, um danach über die Amygdala und den Hippocampus zum Präfrontalen Cortex zu kommen. Warum dieser Weg so wichtig ist, erfährst du hier: https://youtu.be/OIIMLTXj5Hs „Einleitung zur Kommunikation mit einem Borderliner“. Schauen wir uns das alles nochmal von der Praxisseite an:
Stellen wir uns hierfür eine Situation vor, wo die Partnerin (als Beispiel) darüber wütend ist, dass ihr Mann mal wieder länger arbeiten muss. Wie könnte er nun nach der U.M.W.E.G.©-Methode sowohl mentalisierend als auch deeskalierend reagieren? Ein Vorschlag wäre:
- „Ich spüre deine Frustration, mein Schatz, weil ich dir sagte, dass ich morgen länger arbeiten muss. Danach ist die Situation leider eskaliert und du meintest, ich würde dir die Schuld geben, wenn ich doch früher nach Hause komme.
- Sei dir bitte sicher, dass du das Wichtigste in meinem Leben bist (Unterstützung). In letzter Zeit hast du viel in unserer Familie durchgemacht mit unseren Kindern und auch mit deinem Beruf (Mitgefühl).
- Ich werde morgen früher nach Hause kommen! Nicht, weil ich mich nun schuldig fühle. Nein, sondern du bist mir wichtiger als die Arbeit und hast in letzter Zeit selber schwierige Zeiten durchgemacht (Unterstützung, Mitgefühl).
Dieser beschriebene Weg zuerst über die Amygdala, dann über den Hippocampus ist oft der letzte funktionierende Ausweg, um ein Gespräch vor einer Kernschmelze zu bewahren. Hierdurch zeige ich meinem Gegenüber zuerst einmal meine Wertschätzung und Anerkennung seiner Gefühle (Amygdala) und gebe ihm auch die Bestätigung, dass er/sie von mir wirklich gesehen wird!
Ist dies nicht exakt dasselbe, was wir im Grunde genommen selber von unserem Partner erwarten? Wir möchten alle gesehen werden – ein elementares Bedürfnis aller! Wann hast du zum Beispiel das letzte Mal wirklich in die Seele deines Partners/deiner Partnerin hineingeschaut? Wann habt ihr euch von Herzen, von ganzer Seele oder auch der ganzen Psyche wirklich einmal wortlos verstanden?
In der Regel geht es nämlich nicht darum, wann du nach Hause kommst. Es geht darum, dass du als Mann deine Frau / deine Partnerin oder du als Frau deinen Mann wirklich respektierst und in seinen ureigenen Bedürfnissen auch siehst.
Durch die U.M.W.E.G.©-Methode (U = Unterstützung, M = Mitgefühl und W = Wahrheit) werden Botschaften in genau der richtigen / gehirngerechten Reihenfolge vernünftig dargelegt. Zwar gibt es dann immer noch keine Aussicht auf 100%igen Erfolg, jedoch kommen wir hiermit deutlich weiter. Und ist es nicht auch oft so, dass allein die Sicherheit eine Exit-Strategie in der Hinterhand zu haben, einen deutlich ruhiger macht? Auch das trägt zu einer entspannten Atmosphäre bei.
10.2. Das Täter – Opfer – Spiel beenden.
Gerät ein Gespräch außer Kontrolle, dann wird oft die „Täter-Opfer-Karte“ gezogen: Du bist an allem schuld und ich bin hier das Opfer!
Erinnert dich das nicht auch wieder an die Ziege im Märchen vom Tischlein-deck-dich von weiter vorne? Was sagte sie nochmal, nachdem sie abends mit einem der drei Söhne nach Hause kam? „Mäh, mäh … “Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein … mäh, mäh …“
Passiert dies, hat man schnell das Gefühl machtlos zu sein. Und genau deswegen – wegen dieser Machtlosigkeit – muss das „Täter-Opfer-Spiel” konsequent angesprochen werden. Was wäre mein Vorschlag? Wie könnten wir hier vorgehen? Ein Gedankengang, der mir haften geblieben ist, ist folgende Argumentation:
- Indem du dich einerseits nun als Opfer beschreibst, andererseits jedoch immer wieder deine Rechte einforderst und dich so zum Täter machst, bringst du mich jetzt in eine recht schwierige Situation.
- Ich könnte hier zum Beispiel gar nicht reagieren. Dann wäre ich jedoch das Opfer deiner Handlungen.
- Ich könnte aber auch strafend reagieren. Dann wäre ich ein Täter und das möchte ich auch nicht sein…
- Da wir nun dieses Problem haben (Wahrheitsgehalt), benötige ich deine Unterstützung!
- Was ist dein (!) Vorschlag in dieser Situation?
- Wie kann ich dich dann dabei unterstützen?
- Wie können wir konstruktiv zusammenarbeiten,
- damit wir weiter im Team bleiben?
Raus aus der Opfer-Täter-Falle! Sofort offenes Visier und dieses Rollenspiel ansprechen! Borderliner haben die Tendenz, sich als masochistisches Opfer zu fühlen und nach außen auch so zu geben. Das ist kein Vorwurf, sondern meine jahrzehntelange Beobachtung. Darum sollte man in der Kommunikation hierauf vorbereitet sein und diese obige Argumentation ruhig auswendig lernen. Sie ist aus der Praxis für die Praxis…
10.3. So wie es ist, ist es auch OK.
Ich beobachte häufig, wie sich Menschen mit einer instabilen Persönlichkeitsstörung (F60.30) von einmal gesetzten Zielen schnell wieder abwenden, mit der Bemerkung: „Ich schaffe es ja doch nicht“.
Der Sohn eines Gesprächspartners, den ich vor einiger Zeit betreuen durfte, war ein Meister darin, sich viele Ziele zu setzen, aber keines wirklich anzugehen oder durchzuziehen … Der beste „90 Meter Läufer“ bei einem 100-Meter-Lauf.
Er verwahrloste schließlich immer mehr und zog irgendwann einmal aus dem Elternhaus aus. Es wurde ihm auch komplett zugestanden, sein Leben so fortzuführen, wie er es gewohnt war. Seine Eltern fanden sich mit der Devise ab: „Dann ist das nun mal so. Er muss sein eigenes Leben erst einmal so weiterführen. Schließlich ist er bereits volljährig…“
Nach seinem Auszug verwahrloste er immer mehr und es kam wie es kommen musste, und irgendwie erinnerte mich all das an ein biblisches Gleichnis… Dem Sohn ging es in seiner neuen Umgebung so dreckig, dass er nach einiger Zeit innerlich aufwachte und sich an sein Elternhaus und die dort befindliche Ordnung zurückerinnte… Was dann kam, war voraus zu sehen: Er kam zurück. Nun aber waren die Vorzeichen anders und er hielt sich deutlich ordentlicher an die Familienregeln…
Was ist meine Botschaft hierbei? Frei nach Gerhard Vollmer, einem deutschen Physiker und Philosoph, irren wir uns alle in unseren Handlungen empor. Manchmal muss man die Sachen auch einfach mal nur laufen lassen und sein Gegenüber in die unvermeidliche Konsequenz hinein laufen lassen. Anschließend kann man ihm dann wieder auf die Füße helfen.
Und auch einen Borderliner muss man hin und wieder mal ziehen lassen. Solange er volljährig und geistig / körperlich gesund ist, sollte man Verantwortung auch da lassen, wo sie ist, bei den Betroffenen. „Dann ist das halt so.” Und wenn er dann irgendwann zur Besinnung kommen sollte, Taten der Reue zeigt und wirklich zurückkommt, dann – aber auch wirklich nur dann – sollte man ihm mit offenen Armen entgegenlaufen.
10.4. Stabilität von außen.
Zu den wirksamen Werkzeugen zählt auch das Stabilisieren von außen… Borderline wird zu Recht in der Gruppe der “Instabilen Persönlichkeitsstörung“ aufgeführt (F60.30/F60. 31). Denn, wenn man im Inneren instabil ist, dann braucht es das Außen, um Stabilität zu lernen …
Ich vergleiche dies gerne mit den beiden unterschiedlichen Skelettarten von Säugetieren und Insekten: Ein Insekt hat durch seinen Chitinpanzer ein Außenskelett… Menschen oder andere Säugetiere haben Knochen, also ein Innenskelett… Bei einer Verletzung – nehmen wir mal einen Knochenbruch – kann durch ein „Außenskelett“ wie einem Gipsverband die innere Heilung gefördert werden, indem dann in aller Ruhe von innen der Knochen nachwächst.
Was meine ich in der Praxis damit? Wenn der Borderliner im Inneren verletzt wird und dadurch instabil ist, dann hilft es, sich im Außen zum Beispiel mit Stabilität fördernden Gruppen zu verbinden. Ich denke hier an Sportvereine, kirchliche Vereinigungen, karitative Organisationen oder auch von der Gemeinde initiierte Gemeinschaftsprojekte. Aber auch ein Haustier kann sehr hilfreich sein. All das fördert die zwischenmenschliche Interaktion, die Grundlage für Beziehungen und hilft dabei, die eigene Identität zu definieren.
10.5. Das Diplomzimmer.
Wer ode was bin ich wirklich? Was habe ich bis heute überhaupt erreicht? Wo komme ich her und wo möchte ich hin? Um diese Fragen zu beantworten, hilft Respekt. Respekt kommt aus dem lateinischen Wortschatz und besteht aus zwei Grundwörtern: Re und Spectare. Re bedeutet – zurück, nach hinten und „Spectare“ hat die Bedeutung von „schauen“. Respekt bedeutet also „ein nach hinten schauen“… Ich schaue auf etwas, was hinten in der Vergangenheit liegt.
Was meine ich jetzt damit? Stellen wir uns mal folgende Frage:
- Für was habe ich in meinem Leben bereits Auszeichnungen wie zum Beispiel ein Diplom verdient? Dazu zählen unter anderem Klassenarbeiten, Zeugnisnoten, Abschlusszeugnisse, Berufsausbildungen, Ehrungen,
Solche offiziellen Diplome von außen sind jedoch nur eine Gruppe von vielen. Welche sonstigen Auszeichnungen würden mir aber noch ausgestellt werden?
- Kann ich mich zum Beispiel sehr gut entschuldigen?
- Bin ich hilfsbereit?
Und anstatt dies lediglich allgemein / abstrakt zu benennen, sollte ich mich dann hinsetzen und mich an eine konkrete (!)Situation erinnern, in der ich mich entschuldigt habe oder hilfsbereit gezeigt habe. Für was würde mein Partner, meine Partnerin mir heute ein Diplom, gestern oder letzten Monat ausstellen?
Scheue dich nicht, ihn oder sie hierfür einmal zu fragen. Du wirst erstaunt sein, wie dich andere betrachten.
Du solltest jeden Abend (!) wirklich jeden einzelnen Abend, wenn du ins Bett gehst, dich daran erinnern, wofür du heute ein Diplom verdient hast! Bereits nach einem Monat fällt es dir viel leichter, dich daran zu erinnern und dieses Ritual durchzuführen. Und ich garantiere dir, nach einem halben Jahr bist du ein ganz anders denkender Mensch, obwohl du nichts anderes machst!
Jedoch bist du dir nun darüber bewusst, für was du Respekt verdienst und wirst diesen Selbstrespekt in deinem Leben ausleben. All das, weil dein Diplomzimmer sichtbar gefüllt ist! Ich wünsche dir, ein Diplomzimmer voll schöner Diplome!
Wenn es um das Erkennen der eigenen gesunden Identität in einer professionellen Traumatherapie geht, ist dieses Diplomzimmer zum Beispiel ein elementarer Einstieg um anschließend dann die Überlebensstrategien und die Traumen anzugehen.
10.6. Werkzeug Nr. 6: Der Leuchtturm!
Stell dir einmal einen Leuchtturm vor. Was sind seine beiden Hauptmerkmale und damit seine wichtigsten Funktionen?
- Er sendet dauerhaft und zuverlässig ein starkes Signal aus, unabhängig davon, ob ein Schiff in Reichweite ist oder nicht. Dieses Signal ist zusätzlich noch codiert, sodass er mit seiner Position klar und eindeutig identifiziert werden kann.
- Aufgrund seines starken Fundaments behält er seine Position auf den Punkt genau. Er weicht auch bei widrigen Umständen hiervon nicht ab.
Dies veranschaulicht m.E. sehr gut, wie die beste Unterstützung für einen Borderliner aussehen sollte: Borderline ist – wie bereits wiederholt gesagt – eine Instabilität aufgrund einer Unreife in der Persönlichkeitsentwicklung. Was er von außen nun benötigt wäre folgende Unterstützung:
- Ein starkes Signal: „Hier ist der sichere Hafen“
- Das Signal muss sowohl in der weißen Phase, aber besonders auch in der schwarzen Phase durchgehend verfügbar sein.
- Das Signal darf sich nicht verändern!
Gerade der Punkt 3 stellt viele Angehörige oder Partner eines Borderliners vor große Herausforderungen:
Die starke emotionale Instabilität führt nämlich immer wieder zu widersprüchlichem Verhalten. Man ist dann konfrontiert von
- einer oftmals unbändigen Wut.
- Das Idealisieren und auch das Denunzieren wechselt sich in immer atemberaubendem Tempo ab…
- Ein häufiges Androhen von Suizidalität
Wie könnte einem hier das Beispiel des Leuchtturms eine Hilfe darstellen?
- Erinnere dich daran, dauerhaft und ohne an dir selbst zu zweifeln, dass Du dein eigenes Signal (!) aussenden musst. Dein eigenes Signal muss wie das des Leuchtturmes codiert, also einwandfrei und ohne Missverständnisse als dein eigenes, persönliches (!) Signal von deinem Partner / Angehörigen erkennbar sein.
- Dein Signal darf sich nicht verändern! Stabilität ist wichtig für den Borderliner. Auch wenn er sich dir gegenüber oft aggressiv verhält, so bist du gerade durch deine Stabilität eine Sicherheit für ihn.
- Wenn der Borderliner auf die schwarze Seite kippt, dann musst Du besonders intensiv leuchten. Lass den Borderliner in diesen Momenten nicht im Ungewissen. Deine Botschaft sollte immer sein:
- Ich stehe an meiner Position!
- Ich laufe dem Borderliner nicht hinterher.
- Er muss zu mir kommen und anerkennen, dass er mei dir Stabilität und Sicherheit bekommt.
Meiner Beobachtung nach stellen sich Angehörige und Partner in den schwierigen Momenten der schwarzen Phase zu stark auf den Borderliner ein. Springt er nach links dann breiten sie links ein Sprungtuch auf. Springt er nach rechts dann rennen sie unverzüglich nach rechts. Was aber bewirkt dies wirklich? Der Borderliner hat dann kein stabiles Signal. Er sucht Ruhe und Stabilität, bekommt jedoch hektischen Aktivismus geliefert.
So schwierig sich dies vielleicht anfühlt … jedoch ist ein starkes Stehenbleiben an einer sicheren Stelle effektiver als ein Hinterherlaufen. Dies und nichts anderes bewirkt Stabilität. Und Stabilität ist das Fundament für eine gesunde Identität!
__________________
Zusammenfassung Kapitel 10: U.M.W.E.G. – Kriterium 3
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam den Kern der Borderline-Störung durchdrungen: die Identitätsstörung.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt verstehen, warum Borderliner die Frage “Wer bin ich wirklich?” nicht beantworten können.
Wir haben gelernt, dass Traumen unbewältigte Erlebnisse sind und dass eine fragmentierte Persönlichkeit kein unteilbares Individuum darstellt.
Die sechs Werkzeuge sind unglaublich wertvoll für unsere Praxis:
- Erstens das Mentalisieren, um durch die U.M.W.E.G.-Methode von der Amygdala über den Hippocampus zum präfrontalen Cortex zu gelangen.
- Zweitens das Beenden des Täter-Opfer-Spiels durch direkte Ansprache mit der Formel “Indem du dich als Opfer beschreibst, aber deine Rechte einforderst, bringst du mich in eine schwierige Situation.”
- Drittens das Prinzip “So wie es ist, ist es ok” mit dem biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn – manchmal müssen wir loslassen und Konsequenzen zulassen.
- Viertens die Stabilität von außen durch Sportvereine, kirchliche Gruppen oder Haustiere als “Außenskelett” für die innere Heilung.
- Fünftens das Diplomzimmer als tägliches Ritual – jeden Abend fragen “Wofür habe ich heute ein Diplom verdient?” Nach einem halben Jahr sind wir ein anderer Mensch.
- Sechstens der Leuchtturm mit seinem unveränderlichen Signal – nicht hinterherlaufen, sondern an der Position bleiben.
Ausblick auf Kapitel 11: U.M.W.E.G. – Kriterium 4
Nachdem wir die Identitätsstörung verstanden haben, wenden wir uns nun dem vierten Kriterium zu: der Impulsivität bei mindestens zwei selbstschädigenden Aktivitäten.
Du wirst verstehen, warum Borderliner nicht auf größere Belohnungen warten können und was neurobiologisch dabei im Gehirn passiert. Die Studien zum Nucleus Accumbens und zum medialen orbitofrontalen Cortex zeigen uns, dass sich das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr strukturell verändert.
Besonders praktisch sind dabei die drei Werkzeuge:
- Das Wut-Tagebuch zur Systematisierung (Wann, wo, unter welchen Umständen?),
- die gemeinsamen Aktivitäten in den weißen Phasen (aus einem Kuss ein DU machen durch gemeinsame Erlebnisse) und
- das offene Visier mit der WARUM-Frage statt WIESO.
Du wirst lernen, dass Bedürfnisaufschub keine angeborene Fähigkeit ist und erst ab dem vierten Lebensjahr gelernt wird. Die Tintenfisch-Studie zeigt uns, dass Impulskontrolle mit Lernfähigkeit zusammenhängt.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn ohne das Verständnis der Impulsivität können wir die selbstschädigenden Verhaltensweisen nicht wirksam angehen, und die 77-mal-Vergebung erinnert uns daran, dass das Leben mit einem Borderliner nichts für Anfänger ist. 😉
Kapitel 11 – U.M.W.E.G.© – Kriterium 4
Das Kriterium Nummer Vier in der Borderline Diagnose lautet: Impulsivität bei mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Aktivitäten. Was könnten dies alles für Aktivitäten sein?
- B. Geldausgeben,
- Sexualität, Promiskuität
- Substanzmissbrauch, Drogen / Alkohol…
- Ladendiebstahl,
- rücksichtsloses Fahren, auf Brückengeländern balancieren
- Extremsport
- und Fressanfälle (ausgenommen Suizid oder Selbstverletzungen)
Impulsivität ist ein Verhalten, bei dem jemand spontan und ohne viel über die Konsequenzen nachzudenken auf äußere Reize oder innere Impulse reagiert. Impulsivität (ein Adjektiv) stützt sich auf den Begriff „Impuls“.
- Lateinisch impulsus (Anstoß, Anregung)
- Lateinisch impellerer / impulsum (anschlagen, stoßend in Bewegung setzen, antreiben
- Lateinisch Impulsiv hat daher die Bedeutung von schnell, spontan oder unmittelbar…
Umgangssprachlich wird Impulsivität deshalb auch mit einer Leichtfertigkeit, einer mangelnden Selbstkontrolle oder mit einer gestörten Impulskontrolle bezeichnet. Für einen Außenstehenden erscheint solch ein Verhalten als nicht angemessen, unreif, unkontrolliert und auch unbedacht.
Wichtiger Merksatz: Die eigene Impulsivität zu kontrollieren, ist keine angeborene Fähigkeit! Säuglinge und Kleinkinder können ihre Impulse noch lange nicht selbst kontrollieren. Darum können wir bei Ihnen auch nicht von einer Impulsivität sprechen. Dieser sogenannte Bedürfnisaufschub wird erst im vierten Lebensjahr gelernt.
11.1. Bedürfnis- Belohnungsaufschub – das Gegenteil von Impulsivität
Der Mensch ist bei seiner Geburt in seiner Psyche noch reiner Bauch / ein komplettes „Es“ (Sigmund Freud lässt grüßen …)
Dieser sogenannte „Bauch“, das ist der Sitz des Temperaments und dieser Temperamentsbereich steuert die Emotionen/Motivationen an. Erst im Laufe des jungen Lebens bekommen unsere Motivationen gewisse Ziele/Motive. Und durch diese werden unsere Handlungen dann immer stärker von äußerlichen auf innere Antriebe verlegt. Äußere Gefühlsauslöser (Trigger) nehmen ab und das eigene Ich / die gesunde Identität wird immer stärker.
Trotz dieser Entwicklung bleibt die „Trieb-Dynamik“ (Zitat Sigmund Freud) – also eine direkte / unreflektierte Beziehung zwischen Gefühlen und Handlungen – das ganze Leben über bestehen. Und je kürzer der Abstand zwischen einem Bedürfnis / einem Trieb und seiner Befriedigung ist, desto größer ist anschließend die Tendenz zum Wiederholen, der Beginn einer Sucht…
Wegen dieser Suchtgefahr ist die Fähigkeit, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bewusst etwas aufzuschieben (auch Belohnungsaufschub genannt) eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben in der persönlichen Entwicklung! Warum? Weil sie eine bewusste Regulierung von Emotionen darstellt.
Und nur durch diese bewusste Regulierung der Gefühle (Emotionen) können später auch unsere Handlungen bewusst gesteuert werden.
Der Merksatz hierbei lautet: Wir sind nicht unsere Emotionen und wir sind damit auch nicht unsere Handlungen! Unsere Emotionen und die sich daraus ergebenden Handlungen sind das Ergebnis eines vorherigen Entscheidungsprozesses… Mehr Informationen hat die brillante Forscherin Lisa Feldmann Barret in ihrem Werk “Wie Gefühle entstehen” herausgearbeitet. Du kannst es unter folgendem Link finden: https://amzn.to/3WQNCW3
Die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub geht Hand in Hand in die Bereitschaft über, eine NICHT sofortige Befriedigung von Wünschen und Erfolg zu ertragen oder auszuhalten, was man dann als Frustrationstoleranz bezeichnet. Unsere Frustrationstoleranz kann durch uns selbst oder durch Übungen von außen gestärkt werden. Leider wird dies durch unsere heutige Konsumgesellschaft recht wenig gefördert, da Frustrationstoleranz uns eher zu einer persönlichen “Konsum-Autonomie” erzieht. Und Autonomie / also Selbstbestimmung passt nun doch nicht so ganz in unsere auf Konsum hin orientierte Gesellschaft
Untersuchungen bei Kindern zeigen jedoch, dass die Fähigkeit zu einem Bedürfnisaufschub auch in enger Verbindung zu dem späteren moralischen Verhalten eines Erwachsenen steht. Spätestens dieser Aspekt sollte uns zeigen, wie wichtig das Thema: „Impulskontrolle versus Frustrationstoleranz“ in der Erziehung sein sollte.
11.2. Die Entwicklung unseres Gehirns
In unserem Alltag stehen wir oft vor kleinen und großen Entscheidungen.
In der Regel handelt es sich dann aber eher um ganz simple Fragen wie
- Welches Getränk trinken wir heute Abend oder
- kaufe ich heute noch etwas ein oder erst morgen?
Entscheidungen gehören zum Alltag in unserem Leben! Psychologen gehen davon aus, dass wir dies ca. 20.000-mal täglich bewusst / unbewusst tun.
Das Wort „Entscheidung“ entstammt dem germanischen Wort „skaipi”, das für eine Scheide steht – zwei Holzplatten, die ein Schwert schützen.
Sich zu entscheiden bedeutete damals, ein Schwert zu ziehen und etwas zu trennen, sich von etwas abtrennen, zu beenden oder ein Urteil zu fällen.
Eine Entscheidung ist ein Prozess von mehreren Stufen: Dazu gehören eine Diagnose, Zielsetzung und Problemdefinition, aber auch eine Informationsbeschaffung. Das alles ist nicht so einfach und setzt einen gewissen Entwicklungsstand unseres Gehirns voraus. Und darum muss dies alles auch erst einmal gelernt werden: In Studien fand man heraus, dass der Bedürfnisaufschub von Jugendlichen noch nicht so gut wie von Erwachsenen durchgeführt werden kann. Warum? Weil sich das Gehirn strukturell bis zum 25. Lebensjahr noch stark verändert. Und wenn es sich strukturell verändert, dann verändern sich auch Funktionen, Gedanken im Gehirn und damit auch unsere Entscheidungen.
In einer Studie ließ man z.B. Jugendliche im Alter zwischen 8 und 25 Jahren eine einfache Entscheidungsaufgabe lösen. Sie mussten sich dabei entscheiden, ob sie einen kleinen Geldbetrag sofort erhalten oder auf einen größeren Betrag etwas länger warten wollten.
Während dieser Aufgabe wurde die Aktivität der für Entscheidungen wichtigen Gehirnregionen (mOFC = medialer orbitofrontaler Cortex…) und ihre strukturelle Verbindung untereinander in einer Kernspintomographie (fMRT) gemessen. Das Ergebnis war, dass sich viele Jugendliche noch recht schwer damit tun, auf den größeren Betrag zu warten.
Bei den Beobachtungen der beiden Gehirnareale (die für die Entscheidungen aktiv werden) fand man heraus, dass diese bei den Jugendlichen noch nicht so stark miteinander verbunden waren, wie bei einem Erwachsenen.
Größere Belohnungen in der Zukunft erscheinen darum für einen jungen Menschen deutlich weniger attraktiv zu sein und erst später, im Erwachsenenalter, wenn die Verbindung zwischen den wichtigen Bereichen stärker ausgeprägt ist, werden Ziele in der Zukunft bei Entscheidungen immer wichtiger.
Eine andere Studie von der „University of Cambridge“ hat unter der Leitung von Rudolf N. Cardinal (Spezialist für Computer Psychiatrie) die Wichtigkeit eines anderen Gehirnbereichs des „Nucleus Accumbens“ aufgezeigt.
Ist dieser beschädigt oder in seiner Funktion gestört, kann er ohne Zweifel am impulshaften Verhalten beteiligt sein. Diese Region reagiert durch das Dopamin (ein Neurotransmitter wie z.B. Serotonin, Adrenalin, GABA, Glutamat, PEA etc….) auf natürliche Belohnungen wie Nahrung und Sex, aber auch auf Drogen wie Amphetamine und Kokain.
Ratten wurde beigebracht, zwischen einer kleinen direkten Belohnung und einer größeren, auf später aufgeschobenen Belohnung auszuwählen. Nachdem bei ihnen der Bereich des Nucleus Accumbens beschädigt wurde, veränderte sich das Verhalten der Ratten elementar. Anders als zuvor, entschieden sie sich für die sofortige Befriedigung der kleinen Belohnung, anstatt auf die Größere nach einer Verzögerung zu warten. Durch solche Studien können wir beweisen, dass solche Abnormitäten ein Verhalten – wie wir es zum Beispiel bei mit ADHS oder Borderlinern diagnostizierten Personen beobachten – verursachen können.“
11.3. Interessante Studien aus dem Tierreich …
In einer recht interessanten Untersuchung wurde gezeigt, dass dieser Versuch zur Impulskontrolle auch bei Tintenfischen funktioniert. Diese Tiere wurden in zwei geteilte Wasserbehälter gesetzt und hatten dabei die Wahl, entweder ein für sie nicht ganz so leckeres Weichtier sofort zum Fressen zu bekommen oder ihre Lieblingsspeise etwas später.
Die Tintenfische – deren Gehirn bis in die Enden der Extremitäten geht – bewiesen in diesem Test außergewöhnliche Geduld und warteten circa ein bis 2 Minuten lang, um den begehrten Leckerbissen zu bekommen.
In dieser Studie wurde auch ihre Lernfähigkeit untersucht: Sie wurden vor die Wahl gestellt, entweder zu einer weißen oder zu einer grauen Boje zu schwimmen. In einer der beiden Bojen wartete eine Belohnung in Form einer Krabbe auf sie. Sobald ein Tintenfisch gelernt hatte, an welcher Boje es die Belohnung gab, wurde das Belohnungssystem umgekehrt, so dass er nun zur Boje mit der anderen Farbe schwimmen musste.
Das Ergebnis hierbei? Es zeigte sich, dass die Tintenfische, die am schnellsten lernten, auch bei dem Experiment zum Bedürfnisaufschub am längsten auf die begehrte Belohnung warten konnten. Offensichtlich hängt die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub bei Tintenfischen auch mit ihrer Lernfähigkeit zusammen!
Dieses Ergebnis sollte uns einen Hinweis auf das menschliche Lernen geben….
11.4. Werkzeuge im Kampf gegen die Impulsivität
11.4.1 Das Wut-Tagebuch
Alles ist Training – auch das Zurückhalten von Impulsen, also die Selbstkontrolle. Das Wort Kontrolle hat seinen Ursprung in dem französischen Wort „conterolle“
- „contre“ bedeutet: gegen
- „role“ bedeutet eine Rolle oder ein Register.
Conterolle ist also ein „Gegenregister zur Nachprüfung“. Und damit wären wir bei unserem ersten Werkzeug: Das „Wut-Tagebuch”.
Das „Wut-Tagebuch“ ist wie eine Art Gegenregister um sich einer Systematik (wann bekomme ich am häufigsten Wut) bewusst zu werden: „Wann, wo oder unter welchen anderen Umständen verfalle ich in die Impulsivität?“ Dies soll absolut kein Register sein, um jemandem mit dieser Hilfe seine Unvollkommenheit aufzuzeigen, ganz im Gegenteil. Es macht einem vielmehr folgendes deutlich:
- Ich nähere mich einer bekannten schwierigen Situation und kann mich vorbereiten, indem ich Gegenmaßnahmen ergreife.
- Auch meine Umgebung hat hierdurch klare Vorteile: Sie kann mich mit diesem neuen Wissen deutlich besser von außen verstehen und entsprechend unterstützen.
- Selbst kleinste Fortschritte werden hierdurch erkennbar und damit auch bewusst. Mit dieser Hilfe kann man z.B. feststellen, dass die Zahl der Tage mit Wut und Aggression langsam aber stetig weniger wird.
👉 Wie sollte solch ein Tagebuch aufgebaut sein?
Um herauszufinden, in welchen Situationen man sich am meisten aufregt und darauf reagiert, sollten folgende Aspekte immer vorhanden sein:
- Datum / Uhrzeit Dies ist wichtig für den Hippocampus.
Fällt er aus, sprechen wir von einer anterograden Amnesie.
- Die Situation Was ist wo, wodurch passiert?
- Verhalten Wie habe ich hierauf reagiert?
- Gedanken Was ging mir dabei durch den Kopf?
- Gefühle Wie habe ich mich gefühlt?
Solch ein Emotionstagebuch ist auch für Eltern, Lehrer und sonstige Bezugspersonen hilfreich. Es ist nicht nur der Erwachsene mit einer Borderline Dynamik diagnostizierte der hiervon eine Unterstützung erfährt. Dieses Tool – wenn konsequent durchgeführt — ist wirklich von großer Bedeutung.
11.4.2. Sei Teil des Lebens eines Betroffenen … und das nicht nur in der Theorie oder mit warmen Worten
Dieser Gedanke erinnert mich an ein biblisches Zitat:
Jakobusbrief 2:15-17 = Wenn jemand Hilfe braucht und ihr lediglich sagt: „Halte dich warm und wohlgenährt, was ist das dann für eine Hilfe?”
Es ist mit Sicherheit nicht leicht, einen Partner zu haben, der emotional instabil ist. Diese Störung zu akzeptieren ist jedoch ein Prozess, der mit einer klaren Entscheidung beginnt. So, wie man einen Marathonlauf beginnt (die Entscheidung), so muss man auch bis zum Ziel durchhalten (der Prozess). Und oft erinnert mich das Zusammenleben von Paaren, wo einer von Beiden mit einer Borderline-Dynamik diagnostiziert wurde, an einen solchen Marathonlauf.
Wenn der Partner in die schwarze Phase kippt, dann ist sowieso alles schwierig. Darum ist meine Empfehlung, bereits in den „weißen Phasen“ gemeinsame Aktivitäten zu starten, die einen als Paar im Leben miteinander verbinden. Denn Grenzen werden in Friedenszeiten aufgebaut und in Kriegszeiten verteidigt.
An was für Grenzen, aber auch gemeinsame Empfehlungen denke ich hierbei?
- Zusammen feiern gehen
- Ein „Themen-Dinner“ besuchen oder ein „Krimidinner” selber veranstalten
- Gemeinsam regelmäßig kochen, das Essen planen und vor allem immer gemeinsam essen.
- Ein gemeinsamer Tanzkurs
- Ein Do-it-yourself-Kochduell
- Gemeinsame Yoga-Sessions
- Ein Filmabend
- Eine Ausstellung / ein Museum / eine Messe besuchen oder wie ein James-Bond Schauspieler angezogen ins Casino gehen
- An einer Verkostung teilnehmen (Bier, Wein, Gin …)
- Geocaching, Segway, Festival, gemeinsam Sport treiben
- Abends auf dem Balkon picknicken
Warum sind diese Aktivitäten zu zweit so wichtig? Die Antwort ist so einfach wie auch komplex: Um aus einem Kuss ein „DU“ zu machen.
Was meine ich damit?
Nun, ab wann fängt Liebe denn wirklich an, Liebe zu werden? Meines Erachtens dann, wenn der Partner nicht mehr austauschbar ist. Und ab wann ist der Partner wirklich nicht mehr austauschbar? Ab dem Moment, wenn ein eineiiger Zwilling von ihm / ihr auftaucht und genauso redet, denkt und handelt, du aber klar und deutlich sagst: nur ER / SIE kann mit mir in der Partnerschaft bleiben, aber nicht der eineiige Zwilling.
Und warum nicht der eineiige Zwilling? Weil du nur mit deinem Partner / deiner Partnerin die gemeinsamen Erfahrungen gemacht hast. Die gemeinsamen Erfahrungen sind es, die einen zusammenhalten über viele Jahre hinaus.
Wenn dir dies so langsam bewusst wird, kannst du bestimmt auch verstehen, warum es in einer Beziehung mit einem Borderline-Partner besonders wichtig ist, gemeinsame Aktivitäten / Erlebnisse konkret einzuplanen und durchzuführen.
11.4.3. Offenes Visier – klare Ansprache – nichts wird verheimlicht
Diese recht bekannte Redewendung: „mit offenem Visier zu kämpfen“ geht auf die mittelalterlichen Turnierkämpfe zurück, zu der Zeit der Ritter und Edelfrauen. Die Ritter jagten mit gezückter Lanze oder Schwert aufeinander zu.
Das Visier am Helm diente dem Schutz der Augen vor Verletzungen.
Der Nachteil / Vorteil dabei war, dass man sich nicht mehr gegenseitig in die Augen schauen und die Handlungen des Gegners vorhersehen konnte.
Wer unter den Ritten nun Mut, Mumm und Ehre hatte, der ließ sich von dem anderen „in die eigenen Karten“ schauen und kämpfte mit offenem Visier.
Wie hilft uns dies beim Thema Borderline? Wer an einer instabilen Persönlichkeitsstörung leidet – und nichts anderes ist Borderline – der hat in seinem gesamten Leben Angst, Angst und nochmals Angst. Diese flottierende Angst vor dem Leben ist die wohl am deutlichsten kennzeichnende Grundhaltung eines von Borderline Betroffenen. Ähnlich einem Schiff auf offener, unruhiger und stürmischer See, das immer wieder von den Wellen hin- und hergeworfen wird, so fühlt sich auch der Borderliner dem Leben und seinen Unwägbarkeiten ausgesetzt.
Was hilft ihm dann in solchen Momenten? Eine Umgebung, die fast schon phlegmatisch und stoisch an ihrer Grundhaltung festhält. Dazu gehört aber auch, das Verhalten des Borderliners offen und mutig anzusprechen! Wenn der Borderliner wieder in die „schwarze Phase“ kippt, dann ziehen sich viele Angehörige oder Partner schnell zurück, um diesem Zorn, dieser Wut die einem „Tornado oder Mähdrescher“ gleicht der über einem hinwegfegt aus dem Weg zu gehen. Aber gerade dann ist diese Haltung „mit offenem Visier“ oder „standhaft wie ein Leuchtturm in stürmischer See“ so wichtig!
Viele Angehörige versuchen durch ein “sich Wegducken”, oder auch “ein anbetteln” dass er / sie sich doch „normal“ verhalten sollte, die Situation zu retten. Dabei bewirken sie dann jedoch oft nur das Gegenteil.
Mein Rat: Mach aus dem WIESO lieber ein WARUM! Was ist damit gemeint? Stelle dich aufrecht vor den Partner und konfrontiere ihn klar und deutlich („mit offenem Visier und standhaft einem Leuchtturm gleich) mit der Frage:
- WARUM bist du jetzt zornig?
- WARUM gehst Du gerade so selbstzerstörerisch vor?
Die Frage nach dem Warum und einer anschließenden abwartenden Pause (Pausen, in denen der Fragende schweigt, können ohrenbetäubend laut sein) können deutlich mehr Wirkung haben als ihn sich ausagieren lassen. Die Frage nach dem Warum und dem Schweigen danach zeigt deutlich, dass du ein Gespräch willst und kein Agieren! Hierdurch kannst du eine Selbstreflexion anregen, die durch das Wort Respekt gut beschrieben wird. Denn Respekt bedeutet nichts anderes als ein nach hinten schauen (re = hinten und spectare = sehen).
Durch eine kompromisslos stabile Grundhaltung (ähnlich dem Leuchtturm), die geprägt ist von Offenheit (offenes Visier) kann mit der Zeit beim Gegenüber ein Lernprozess beginnen.
Ich betone ausdrücklich: „mit der Zeit“. Ähnlich einem kleinen, sich noch entwickelnden Kind, benötigt auch der Borderliner die Zeit, sich zu entwickeln.
Auch hier finde ich ein biblisches Zitat nicht ganz unangebracht: Als Petrus Jesus fragte, wie oft man seinen Nächsten vergeben solle, schob er noch nach „bis zu sieben Mal?“ Petrus hoffte, durch diese Zahl seine Bereitschaft zur Vergebung bereits deutlich genug zu zeigen. Wie ernüchternd muss wohl die Antwort Jesu auf ihn gewirkt haben, als dieser ihm sagte: „Nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 77-mal.“
Späestens hierdurch lässt sich erkennen, dass das Zusammenleben mit einem Borderliner nichts für Anfänger ist. Selbst ein Marathonlauf hat irgendwann einmal ein Ende.
Das Leben in Gemeinschaft mit jemandem, der emotional dermaßen unreif und instabil ist, wie wir es von einem Borderliner her kennen, ist mit einem Marathonlauf nur unzureichend zu beschreiben.
Sisyphos, der König von Korinth, aus der griechischen Mythologie könnte auch als Vergleich herhalten. Von Hermes wurde er gezwungen, einen Felsblock immer wieder einen Berg hinauf zu wälzen. Kurz vor dem Ziel, rollte der Stein dann aber immer wieder den Berg hinunter.
Deutlicher könnte man das Leben mit einem Borderliner wohl nicht beschreiben. Jedoch, es lohnt sich! Denn die weißen Phasen sind an Genuss und Intensität oft denen einer „normalen Beziehung“ weit überlegen.
_______________
Zusammenfassung Kapitel 11: U.M.W.E.G. – Kriterium 4
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam die Impulsivität als viertes Borderline-Kriterium durchleuchtet.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt verstehen, warum Borderliner nicht warten können und was neurobiologisch dahintersteckt. Wir haben gelernt, dass Impulskontrolle keine angeborene Fähigkeit ist und erst ab dem vierten Lebensjahr erlernt wird.
Die Studien zum medialen orbitofrontalen Cortex zeigen uns, dass sich das Gehirn bis zum 25. Lebensjahr strukturell verändert und die Verbindungen zwischen Entscheidungsbereichen bei Jugendlichen noch schwächer ausgeprägt sind. Der Nucleus Accumbens und seine Rolle beim Bedürfnisaufschub haben uns gezeigt, dass neurologische Schädigungen impulsives Verhalten verursachen können. Die Tintenfisch-Studie war besonders aufschlussreich: Impulskontrolle hängt direkt mit Lernfähigkeit zusammen. Die drei Werkzeuge sind unglaublich wertvoll: Erstens das Wut-Tagebuch mit den fünf Aspekten (Datum, Situation, Verhalten, Gedanken, Gefühle) zur Systematisierung. Zweitens die gemeinsamen Aktivitäten in den weißen Phasen – aus einem Kuss ein DU machen durch gemeinsame Erlebnisse, denn der Partner wird erst durch gemeinsame Erinnerungen unersetzbar. Drittens das offene Visier mit der WARUM-Frage statt WIESO und der anschließenden schweigenden Pause. Die 77-malige Vergebung und der Sisyphos-Vergleich erinnern uns daran, dass das Leben mit einem Borderliner nichts für Anfänger ist, aber die weißen Phasen an Intensität normale Beziehungen übertreffen.
Ausblick auf Kapitel 12: U.M.W.E.G. – Kriterium 5 Suizidalität
Nachdem wir die Impulsivität verstanden haben, wenden wir uns nun dem ernstesten aller Kriterien zu: der Suizidalität und dem nicht-suizidalen selbstverletzenden Verhalten (NSSV).
Wir werden besprechen, warum das Suizidrisiko bei Borderline bei 5-10% liegt – tausendfach höher als in der Gesamtbevölkerung.
Die erschreckende Zahl von 5,6 Millionen betroffenen Jugendlichen in Deutschland (zwei von drei!) wird uns zeigen, wie dringend dieses Thema ist.
Besonders wichtig sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Männer sind zu 75% “erfolgreicher”, während Frauen häufiger Versuche unternehmen.
Drei Werkzeuge können hier lebensrettend wirken:
- Erstens kompetente Hilfe holen (0800-1110111) mit der U.M.W.E.G.-Formel zum Täter-Opfer-Spiel.
- Zweitens die Umgebung sichern – 20 Millionen Schusswaffen in Deutschland sind 20 Millionen Gelegenheiten.
- Drittens das Alternativprogramm mit Sport, Eiswürfeln und rotem Filzstift statt Ritzen.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn ohne das Verständnis von Suizidalität können wir Leben nicht schützen, und die Erkenntnis, dass jede Androhung ernst genommen werden muss, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Kapitel 12 – U.M.W.E.G. – Kriterium 5 Suizidalität
Das Kriterium Nummer in der Borderline Diagnose lautet: Wiederkehrende suizidale Handlungen, -gesten oder -drohungen oder selbstverletzendes Verhalten.
Bitte siehe hierzu bitte auch meine Vorträge „Selbstmord ist keine Lösung“ auf meiner Webseite www.psychologie-hilft.de
Selbstmord und die Androhung von Selbstmord – das ist grundsätzlich immer ein ernstes Thema! Deshalb ist auch jede einzelne Suizidandrohung immer ein Grund, ärztliche Hilfe anzufordern! Denn bei Suizidandrohung sollte keine falsche Zurückhaltung geübt werden!
Die konsequente Zuhilfenahme ärztlicher Unterstützung hat auch gleich zwei wichtige Vorteile:
- Einerseits bekommt der Betroffene auf jeden Fall immer die bestmögliche Unterstützung …
- Andererseits sieht er aber auch, dass jede seiner Drohungen zwangsläufig eine Konsequenz nach sich zieht – ein Fakt, der nicht zu unterschätzen ist.
Wir werden später – bei den Werkzeugen – nochmal auf dieses „Täter-Opfer-Spiel“ in dieser Thematik zurückkommen.
Warum ist das Thema Selbstmord gerade im Rahmen von Borderline so wichtig? Weil das Selbstmordrisiko innerhalb der Borderline – Persönlichkeitsstörung zwischen 5 und 10 % der Betroffenen liegt. Also fast jeder Zehnte unter hundert. Im Vergleich dazu die offiziellen Zahlen der Gesamtbevölkerung: Jeder Zehnte unter 100.000 begeht einen Selbstmord in Deutschland. Wir sprechen hier also um einen tausendfach höheren Faktor, wenn es sich um Suizidalität und die Borderline-Persönlichkeitsstörung dreht!
Bei der nicht suizidalen Selbstverletzung (NSSV) liegen wir – je nach Studie – bei einer Zahl zwischen 69% und bis hin zu 80%. Von 10 mit BPS diagnostizierten Menschen begehen 7 bis 8 regelmäßig nicht suizidale Verletzungshandlungen! Das ist erschreckend, zeigt aber auch, dass dies nicht auf 100% zutrifft.
Merke darum: Nicht jeder Borderliner verletzt sich zwangsläufig!
Ein Grund für die vielen Selbstverletzungen liegt – neben weiteren – in der starken Belastung durch
- begleitende (komorbide) Angststörungen (ca. 90 Prozent),
- Soziale Phobien und
- Posttraumatische Belastungsstörungen (ca. 45 Prozent).
Außer diesen „nackten Zahlen“ ist Folgendes noch wichtig zu beachten: Obwohl im Alter viele Symptome der Borderline – Persönlichkeitsstörung an Intensität nachlassen, trifft dies auf das Thema Suizidalität nicht zu.
Es ist eher das Gegenteil zu beobachten! Einige Studien lassen den Eindruck entstehen, dass es sich im Alter sogar verstärkt. Und bedenken wir noch einen weiteren Punkt: Gab es bereits versuchte Suizidversuche in der Vergangenheit, dann ist dies sowohl der stärkste Indikator / bzw. Risikofaktor für einen „erfolgreichen Suizid“ in der Zukunft. Welche Zahlen gibt es sonst noch zu beachten?
- Die Verteilung zwischen den Geschlechtern Männer / Frauen….
Es ist immer noch ein weit verbreiteter Mythos, dass mehr Frauen als Männer an Borderline leiden, obwohl ¾ aller therapeutisch behandelten Borderline-Betroffene Frauen sind. Für diese Annahme gibt es gleich mehrere Gründe (bitte beachte hierbei immer die Gaußsche Verteilungskurve)
- Borderline-Männer kommen aufgrund ihrer nach außen gerichteten Wut eher mit dem Gesetz in Konflikt und werden dadurch viel eher mit der „antisozialen Persönlichkeitsstörung“ in Verbindung gebracht. (Frauen tendieren hierbei nach innen, gegen den eigenen Körper)
- Borderline-Männer fallen durch eine deutlich höhere Impulsivität
- Selbstverletzung kommt bei beiden Geschlechtern in etwa gleich oft vor, jedoch achten die Frauen eher darauf ihre Verletzungen zu verbergen, während männliche Betroffene sich häufig sichtbar(er) verletzen.
- Männer gehen mit Wut generell offensichtlicher um und übertragen Trauer und Ohnmacht häufiger in Wut. Frauen hingegen flüchten sich öfter in die Trauer – gestehen sich die Wut im Außen nicht zu.
- Weibliche Betroffene haben öfter Probleme mit den Themen Körper, Sexualität und Näh Meist aufgrund sexueller Übergriffe und damit einer ausgefüllten Traumabiographie in der Vergangenheit.
- Weibliche Borderliner weisen oft eine deutlich höhere Symptomausprägung wie zum Beispiel dissoziative Symptome
- Unterschiede beobachten wir auch bei den Begleiterkrankungen (Komorbiditäten🙂
- Borderlinerinnen leiden oft an affektiven Störungen (z.B. Depressionen), erkranken öfter an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und entwickeln häufiger dazu Essstörungen – alles nackte Zahlen aus der Studienlage.
- Männliche Borderliner dagegen haben eher die Neigung zur Narzisstischen und Antisozialen Persönlichkeitsstörungund greifen häufiger auf Drogen zurück.
- Borderlinerinnen leiden oft an affektiven Störungen (z.B. Depressionen), erkranken öfter an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und entwickeln häufiger dazu Essstörungen – alles nackte Zahlen aus der Studienlage.
- Die „Erfolgsquote“
Sowohl männliche als auch weibliche Borderliner(innen) unternehmen in etwa gleich oft einen Selbstmordversuch. Trotzdem sind die Versuche der Männer deutlich „erfolgreicher“, sowohl in der Stärke der Verletzung aber auch bis zu dem Punkt, sich selbst „erfolgreich“ zu töten. Männliche Suizide liegen bei 75%. Jedoch neigen Frauen paradoxerweise häufiger zu einem Suizidversuch… Gemäß einer Studie der „American Foundation for Suicide Prevention“ liegen Frauen hier mit 20% vor den Männern… Männer machen es aber leider erfolgreicher – der Leser möge den traurigen Unterton hierbei immer mitlesen…
- Selbstmord bei älteren Menschen
Der Versuch, sich das Leben zu nehmen, ist für sich betrachtet sehr eindeutig. Jedoch unterscheidet sich das Motiv hierfür oft sehr stark, wenn man mal beobachtet, in welchem Alter jemand diese Handlung unternimmt. In der allgemeinen Selbstmord-Statistik („www.destatis.de) liegt die Haupt-Altersgruppe der Betroffenen zwischen 50 und 70 Lebensjahren (ca. 30%). Ältere, selbstmordgefährdete Patienten die bereits einen oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich haben,
- zeigen einerseits sehr häufig dauerhaft erkennbare Borderline – Merkmale auf.
- Andererseits sind ihre Selbstmordversuche weniger das Ergebnis einer Charakterpathologie, sondern vielmehr eine Zwanghaftigkeit, ihre Umwelt irgendwie noch unter Kontrolle zu behalten. Konnten sie diese Affekte früher noch durch den Beruf unterdrücken, können später – in Kombination mit Depressionen und einem Gefühl von Wert- und Hoffnungslosigkeit – Suizidgedanken wieder verstärkt aufkommen.
12.1. NSSV … Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten
Was versteht man unter diesem Kürzel NSSV, dem sogenannten „Nicht-suizidalem Selbstverletzenden Verhalten”? Es beschreibt Handlungen wie „selbst zugefügte” Schnittverletzungen, Verbrennungen, oder auch mit dem Kopf gegen die Wand schlagen. Oder etwas trockener beschrieben: „Eine freiwillige, direkte Zerstörung oder Veränderung des Körpergewebes ohne suizidale Absicht.“
Wenn man so etwas liest, dann bekommt so etwas wie großflächiges Tätowieren, Piercing, Bulimie, Anorexia, Extremsport, aber auch Fingernägel Kauen, Rauchen und nicht zuletzt extreme Schönheits-OP’s einen anderen „Farbanstrich“ oder Beigeschmack.
Typisch bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist diese ewige störende innere Angst vor „dem Unbekannten“, begleitet von einem dauerhohen Spannungslevel. Dabei können aber gerade diese ungewöhnlichen Verhaltensweisen (und mit ungewöhnlich sind sie noch sehr sanft beschrieben) paradoxerweise dabei helfen
- Spannungen abzubauen
- sich selbst zu bestrafen,
- das Gefühl der Entfremdung von sich und anderen (Dissoziation) zu überwinden.
- Andererseits aber auch dabei helfen die eigene Umgebung irgendwie doch noch zu kontrollieren
- um durch eigene Handlungen wenigstens ein kleines Gefühl von Kontrolle, Erregung und Aufregung aufzubauen (Selbstwirksamkeit).
Verletzt sich der geliebte Partner, das eigene Kind, ein Elternteil, dann ist dies durchaus mit einem Trauma für die Umgebung zu vergleichen. Für Familienangehörige und Freunde kann das wie eine Provokation oder eine Herausforderung erscheinen, diesem für sie schwierigen Thema dem „selbstverletzenden Verhalten“ richtig zu begegnen. Einige Handlungsalternativen hierauf, werden wir anschließend im zweiten Teil dieses Kapitels betrachten.
NSSV beginnt am häufigsten im Jugendalter, so hauptsächlich zwischen dem 12. und dem 15. Lebensjahr.
In Deutschland sind laut Wikipedia über 5,6 Millionen Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren betroffen. Über diese gewaltige Zahl liest man schnell hinweg … 5,6 Millionen Betroffene. Beachten wir aber noch eine weitere Zahl zum Vergleich: Laut Statistika.de zählen 8.4 Millionen Menschen zu dieser Altersgruppe von 15 Jahre bis 24 Jahre.
Jetzt bekommt Bild einen noch drastischeren Anstrich: 8,4 Millionen Menschen in einer bestimmten Altersgruppe, von denen 5,6 Millionen sich selbst verletzen… Das sind 2/3! Man stellt drei Jugendliche nebeneinander und zwei davon begehen in irgendeiner Form eine Handlung, die selbstverletzend ist. Welch ein trauriger Fakt!
Obwohl dieses Symptom des NSSV ein klar definiertes Kriterium für die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist und im ICD 10 gemeinsam mit Suizidalität in einem gemeinsamen Bereich aufgeführt wird, so wird dennoch von einigen Experten empfohlen, dieses Verhalten als eine eigenständige separate Störung zu betrachten. Und ja, in der 5. Auflage des «Diagnostic and Statistical Manual» (DSM-5 Mai 2013) der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft (APA) wurde dies in der «Sektion 3» auch zum ersten Mal getan indem NSSV und SVS (Suizidale Verhaltensstörung) als eigene diagnostische Kategorien aufgenommen wurden. Damit wurden diesen beiden Störungsbilder (Suizidalität und NSSV) zwar noch keine formal unterschiedlichen Diagnosen, werden aber doch eindeutig innerhalb eines Klassifikationssystems separat und mit einem eigenständigen Erscheinungsbild beschrieben.
Noch eine letzte Zahl zum Schluss:
In Deutschland liegt die Ein-Jahres-Prävalenz von NSSV bei Jugendlichen bei ca. 4 % und bei SVS (Suizidale Verhaltensstörung) bei ca. 9 %. Auch das soll uns zeigen, wie dramatisch sich die Entwicklungen in der Jugendpsychiatrie darstellen.
Kommen wir nun zum zweiten Teil dieses Kapitels: Welche Werkzeuge stehen uns bei Suizidalität und NSSV zur Verfügung?
12.2. Hole dir kompetente Hilfe.
0800-1110111 – Die 24/7 Telefonseelsorge
Auch wenn oft nur der Wunsch nach Außenkontrolle die Ur-Motivation ist … eine Selbstmorddrohung oder Selbstmordhandlungen müssen von der Umgebung immer ernst genommen werden! Ruf sofort einen Gesundheitsexperten, den Notdienst, eine Selbstmord-Hotline, oder andere zu Hilfe. Solch ein klares und unmissverständliches Vorgehen hat auch einen psychologisch edukativen Hintergrund: Wir sprechen hier von Suiziddrohungen im Rahmen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie bereits erwähnt, kann dabei – neben der realen Absicht, dem eigenen Leben ein Ende zu bereiten – auch einfach nur der Wunsch nach Macht, Kontrolle und Angstabbau im Außen stehen. Viele Angehörige sind von solch drastischen Handlungen überfordert und reagieren hierauf fast flehentlich:
„Bitte tu dir das nicht an“ „Bitte sei doch vernünftig…“ etc.
Wenn wir uns jedoch einmal in aller Ruhe zurücklehnen, dann erkennen wir sofort ein dahinterliegendes Machtspiel. Auch wenn sich dies für den ersten Moment noch etwas befremdlich anhört: es ist – im Rahmen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung – oft nichts anderes als ein Machtspiel und Angstabbau.
Was sollte darum immer gewährleistet sein? Die Selbstwirksamkeit der Umgebung. Und Selbstwirksamkeit kommt durch eine eigene Meinung, eigenes Handeln sehr klar zum Ausdruck.
Wenn die Suizidandrohungen mal wieder kommen, könnte man zum Beispiel folgende Aussage nach der U.M.W.E.G.-Methode machen:
„Dadurch, dass Du mir gegenüber drohst, dich umzubringen, bringst Du mich in eine schwierige Situation:
Reagiere ich nicht und du tust Dir etwas an, dann werde ich Zeit meines Lebens hierunter leiden – ich wäre ein Opfer.
Reagiere ich aber und hole Hilfe, dann muss ich mit Deinem Zorn rechnen – und ich wäre ein Täter.
Darum möchte ICH (!) Dich fragen:
- Was ist Dein (!) Vorschlag hierbei?
- “Wie kann ich Dich dann dabei unterstützen, damit wir beide noch lange ein TEAM bleiben?“
Hast Du gemerkt, was der Unterschied hierbei ist? Im Gegensatz zu vielen anderen Reaktionen wird hier das „Täter-Opfer-Spiel“ zum einen deutlich benannt, aber auch die Verantwortlichkeit an das Gegenüber delegiert. Er sollte sich seiner eigenen Verantwortung klar bewusst sein, wenn du externe Hilfe holst. Dies ist von großem erzieherischen Nutzen…
12.3. Gelegenheit schafft Handlung – Sichere darum die Umgebung.
Der erste Merksatz lautet: Entferne alle schädlichen Objekte in deiner Umgebung!
Da dies aber unrealistisch umzusetzen ist, solltest du die Zahl der Objekte zumindest auf ein Minimum reduzieren.
- Wirf zum Beispiel nicht mehr benötigte Medikamente weg.
- Entferne nicht gebrauchte scharfe oder spitze Instrumente.
- Schließe sie ab, wie man auch Schusswaffen abschließen sollte.
Ich frage mich immer wieder, wieso und warum man überhaupt zu Hause eine Schusswaffe braucht? Denn es gibt da einen sehr inspirierenden Spruch, der zwar Bertold Brecht aber auch dem amerikanischen Dichter Carl Sandburg (1878-1967 in seinem Buch „The People, Yes“) zugeschrieben werden, 1981 jedoch weltweite Beachtung fand: Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ Der Hamburger Designer Johannes Hartmann hatte diese Graffiti-Parole am Hamburger Bunker auf dem Heiligengeistfeld aufgesprüht.
Was hat dies mit unserem Thema zu tun? Seit Januar 2013 gibt es in Deutschland das „Zentrale Waffenregister“. Gemeldet sind dort 5,5 Millionen Schusswaffen. Das BKA geht jedoch von einer höheren Dunkelziffer im Bereich von 20 Millionen aus. 20 Millionen Gelegenheiten, jemand anderem oder sich selbst das Leben zu nehmen. „Stell dir vor, es gäbe den Wunsch, sich umzubringen, jedoch keine Waffen…
Da die Amygdala kein Marathonläufer, sondern eher ein Kurzstrecken-Sprinter ist, können die Minuten zwischen dem Wunsch und der Suche nach einem Mittel in vielen Fällen entscheidend über Leben und Tod werden.
Und in diesen Minuten ein vernünftiges Gespräch führen ist oftmals lebensrettend!
Wie könnte solch ein vernünftiges Gespräch geführt werden? Mein Vorschlag hierbei ist folgender:
- Ich spüre, dass Du gerade großen Schmerz in dir fühlst. Sei Dir sicher, dass ich diesen nicht übersehe.
- Sei Dir auch sicher, dass ich weiterhin an Deiner Seite bin.
- Die Wahrheit aber ist, dass Du noch am Leben bist.
- Das bedeutet, dass ein wichtiger Teil in Dir nicht sterben möchte. Und genau mit diesem Anteil möchte ich nun sprechen.
- Wer oder was wartet noch auf Dich?
- Welche Verantwortung hast Du dem Leben gegenüber?
12.4. Am Problem „vorbei agieren” – erstelle ein Alternativprogramm
In der Logotherapie von Viktor Frankl wird im Rahmen der paradoxen Intention sehr viel Wert auf die „Rechte, die vernünftige Aktivität“ gelegt.
Diese „rechte Aktivität“ kann man auch als „Am-Symptom-vorbei-Agieren” beschreiben.
Stell dir folgende Situation einmal gedanklich vor: Du fährst spät abends, es ist dunkel, auf einer regennassen Landstraße. Dir kommt jemand im Gegenverkehr entgegen, der sein Fernlicht nicht abblendet. Da er nicht auf dein Signal reagiert, musst du nun etwas tun. Zum Beispiel deinen eigenen Blick am entgegenkommenden Fernlicht vorbei lenken. Anstatt wie ein Reh gebannt in das blendende Licht zu schauen, wendest du deinen Blick nun nach rechts auf den Fahrbahnrand.
Ist dies aber nicht ein Ignorieren des Problems? Nein! Du schaust ganz bewusst am Problem vorbei und zwar auf den sicheren Bereich. Dieses „Am Problem Vorbei Agieren” ist die einzig korrekte Verhaltensweise in diesem Falle.
Jetzt übertragen wir das mal auf unseren Fall. Wir wissen nun, dass ein Mensch in unserer Umgebung starken Belastungen ausgesetzt ist und in seiner Ausweglosigkeit von Suizidgedanken oder selbstverletzendem Verhalten betroffen ist. Was wäre hier ein vernünftiges „Am-Problem-Vorbei Agieren”?
Suche nach alternativen Tätigkeiten, um Selbstverletzungen keinen Raum mehr zu bieten. Dazu gehören unter anderem: Intensive sportliche Betätigung, oder grundsätzlich auch körperliche Bewegung und Aktivitäten
Warum wird immer wieder so viel Wert auf das Thema Bewegung gelegt?
Weil wir heute besser als noch vor wenigen Jahren wissen, dass körperliche Aktivität mit einer Reihe positiver Effekte auf physiologischen, psychologischen und nicht zuletzt sozialen Gebieten verbunden ist. Die Auswirkungen kontinuierlicher Bewegung auf die Freisetzung von Neurotransmittern in unserem Gehirn sind gewaltig, weil
- die Auslösung und auch die Kontrolle von Bewegungen ist nachweisbar mit der Neurotransmitter Konzentration im Striatum (Teil der Basalganglien im Vorderhirn das für Kognition, Motivation und Bewegungsabläufe verantwortlich ist) verbunden … und
- Zum anderen, weil eine der besten Therapieformen bei motorischen oder geistigen Störungen immer noch die Bewegungstherapie ist und bleibt.
Bei Bewegung reden wir sowohl von einer Ausdauerbewegung aber auch intensiver Kraft- Einzelbewegung
- Sei gestalterisch / aktiviere deine eigene Selbstwirksamkeit:
Handwerklich tätig werden, wie z.B. Tonformen oder ein Musikinstrument spielen, kann definitiv die Spannung abbauen.
Eine der drei Grundsäulen für die Suche nach einem Sinn im Leben nach den Prinzipien der Logotherapie ist die Selbstwirksamkeit (neben der Resonanz mit anderen Menschen und dem Erleben des Augenblicks). Wenn ich etwas erschaffe, dann spüre ich einen erhöhten Sinn in meinem Dasein und dies wirkt der Sinnlosigkeit im Leben eines suizidgefährdeten Betroffenen wirksam entgegen. - Thermische Reize von außen – ich denke hier an ein heißes oder eiskaltes Bad – können auf ganz andere Weise helfen. Das Eisbaden erhöht nachweislich in wenigen Sekunden den Dopamin- und Serotoninspiegel im Gehirn. Dies wiederum hat deutlich regulierende Auswirkungen auf das Wechselspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus.
Als Beispiel möchte ich die Erfahrungen des Niederländers Wim Hof anführen. Mit 26 internationalen Rekorden im Ertragen extremer Kälte – wie z.B. das längste Eisbad – hat er seit einigen Jahrzehnten bewiesen, dass solch ein bewusster Kältereiz auch starke positive psychologische Auswirkungen hat.
- Aber wir müssen ja nicht gleich mit dem gesamten Körper in ein Eisbad eintauchen. Nimm einen Eiswürfel und halte diesen eine Zeitlang in deiner geschlossenen Hand. Manchmal helfen auch solche kleineren Mittel für die gewünschten starken Empfindungen, sind unkomplizierter in der Anwendung und oft auch weniger schädlich – Gefrierbrandblasen ect..
- Für viele von Borderline Betroffenen ist auch der Anblick von Blut ein Mittel, sich herunter zu regulieren. Um dem “sich Schneiden / Ritzen” zu entgehen, kann man einen kleinen Umweg nehmen: Entweder mit den eigenen Händen oder mit einem festen Gegenstand massiert man sich bis an die Schmerzgrenze. Dann markiert man diese Stelle mit einem dicken blutroten Filzstift – das Auge soll dies für Blut halten. Der Reiz des Schmerzes und der Anblick von etwas, was nach Blut aussieht, kann die Gefühle stärker beeinflussen, als viele es vermuten. Studien belegen diese Vorgehensweise.
_____________________
Zusammenfassung Kapitel 12: U.M.W.E.G. – Kriterium 5 Suizidalität
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam das ernsteste aller Borderline-Kriterien durchdrungen: die Suizidalität und das nicht-suizidale selbstverletzende Verhalten.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt die erschreckenden Zahlen kennen: Das Suizidrisiko bei Borderline ist tausendfach höher als in der Gesamtbevölkerung, und zwei von drei Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren zeigen selbstverletzendes Verhalten.
Wir haben die Geschlechterunterschiede verstanden: Männer sind zu 75% “erfolgreicher” bei Suizidversuchen, während Frauen häufiger versuchen.
Die drei lebensrettenden Werkzeuge, die wir uns merken sollten sind:
- Erstens kompetente Hilfe holen über die Telefonseelsorge 0800-1110111, kombiniert mit der U.M.W.E.G.-Formel zur Entlarvung des Täter-Opfer-Spiels.
- Zweitens die Umgebung sichern – die Amygdala ist ein Sprinter, keine Marathonläuferin, und die Minuten zwischen Impuls und Ausführung können lebensrettend sein.
- Drittens das Alternativprogramm nach Viktor Frankls paradoxer Intention: am Problem vorbei agieren mit Sport, gestalterischen Tätigkeiten, Eisbaden nach Wim Hof oder dem roten Filzstift statt Ritzen. Die Erkenntnis, dass NSSV im DSM-5 als eigenständige Störung aufgenommen wurde, zeigt uns die Komplexität dieser Thematik.
Ausblick auf Kapitel 13: U.M.W.E.G. – Kriterium 6 – Stimmungsschwankungen
Nach der Suizidalität, wenden wir uns nun dem sechsten Kriterium zu: den affektiven Instabilitäten und extremen Stimmungsschwankungen.
Du wirst dadurch noch besser verstehen, warum Borderliner selber durch ihre Emotionen wie von einem Mähdrescher überrollt werden und ihre Umgebung damit gleich mit.
Die fMRT-Studien der Universität Ulm zeigen uns, dass die Spiegelneuronen bei Borderline-Betroffenen deutlich stärker aktiviert sind, während der präfrontale Cortex weniger arbeitet – Mentalisierung wird dadurch fast unmöglich. Besonders aufschlussreich ist, dass sich bei Gesunden ein Gewöhnungseffekt einstellt, während Borderliner bei wiederholten Reizen immer intensiver reagieren.
Das Fallbeispiel mit Eva und Christoph wird uns zeigen, wie das Täter-Opfer-Dilemma funktioniert: Geht er auf ihre Stimmungen ein, ist er Täter, ignoriert er sie, ist er auch Täter.
Die drei Tipps werden praktisch umsetzbar sein:
- Das ausweglose Dilemma mit U.M.W.E.G. erklären,
- die Situation intelligent hinauszögern mit der Drei-Schritt-Methode,
- und mehr Stabilität durch das eigene Wut-Tagebuch als Vorbild aufbauen.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn die emotionale Achterbahn ist der Alltag im Leben mit Borderline. Und ohne solche Werkzeuge für diese Schwankungen bleiben wir dem Chaos hilflos ausgeliefert.
Kapitel 13 – U.M.W.E.G.© – Kriterium 6 – Stimmungsschwankungen
Kriterium Nummer 6 der Borderline-Persönlichkeitsstörung: Affektive Instabilität: Schnelle Stimmungsschwankungen, die meist nur wenige Stunden anhalten und selten länger als ein paar Tage dauern.
In dem sechsten der 9 Kriterien welche die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreiben, geht es um die emotionale Instabilität:
- Um extreme Stimmungsschwankungen, um den Wackelpudding der Persönlichkeit (Zitat Otto Kernberg)
- Um ein zu wenig an struktureller oder funktioneller Vorhersehbarkeit oder Belastbarkeit.
Borderliner reagieren in der Regel sehr viel feinfühliger auf kleine und kleinste Signale, dafür jedoch mit deutlich intensiveren Affekten, als man es sonst üblicherweise gewohnt sein könnte. Ihre „Antennen“ sind nicht sowohl nach innen und außen, sondern fast ausschließlich auf „das Außen“ gerichtet. Und weil „dieses Außen“ nie stabil ist, können diese sich ständig veränderten Umständen keinem wirkliche innere Ruhe geben.
Dies erinnert sowohl an den „emotional Unsicheren“ als auch an den Perfektionisten. Beide sind immer nur darauf aus, sich an anderen zu orientieren, um Liebe oder Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie machen ihre Existenz praktisch vom Urteil Ihrer Umgebung abhängig. Ja, ein Borderliner, ein “emotional Unsicherer“ und auch ein Perfektionist haben einiges gemeinsam. Der Unterschied ist meines Erachtens die Intensität der eigenen Unsicherheit und der daraus resultierenden Affekte bei alledem.
Mit Affekten beschreiben wir die im außen sichtbaren „Reflexionen unserer Gefühle / Emotionen“. Dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen „afficere”, was übersetzt „verstehen, anregen“ bedeutet.
- Auf die Gefühle bezogen beschreibt dies, sich in einen anderen versetzen, jemanden beeindrucken.
- Daraus wurde später dann das Wort „affectus“. Ein Zustand, eine Leidenschaft oder eine Gemütsbewegung.
Diese Affekte sind in der Regel eine Reaktion auf äußere Umstände und dementsprechend auch recht unstet, variabel und damit überhaupt nicht vorhersehbar. Sie entspringen dem prozeduralen Gedächtnis, welches wir von der Traumatherapie her kennen. Besonders die negativen Affekte / Reaktionen können beim Borderliner dermaßen intensiv sein, dass man als Gegenüber das Gefühl bekommt, urplötzlich und ohne Vorahnung von einem Mähdrescher überrollt zu werden. Kann man dies auch irgendwie im Gehirn belegen?
Eine Studie der Universität Ulm von Forschern rund um Professor Roberto Viviani hat sich mit Veränderungen der Aktivität spezifischer Spiegelneuronen befasst. In ihrer Studie haben sie die bildgebende funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) eingesetzt.
Das Ergebnis war in verschiedener Hinsicht überraschend:
- Die von Borderline betroffenen Studienteilnehmer zeigten eine stärkere Empfindlichkeit in Bezug auf Gefühle – selbst, wenn diese lediglich an Dritten beobachtet wurden.
- Zweitens waren bestimmte Areale im Spiegelneuronensystem deutlich stärker aktiviert als in der gesunden Kontrollgruppe, wenn sie mit dem Thema Verlust (Bindungsverlust Kriterium Nummer 1) konfrontiert wurden.
- Ein weiteres drittes Ergebnis war:
Auf den fMRT-Aufnahmen war – im Vergleich zur Kontrollgruppe – ein deutlich erkennbarer Unterschied in der Arbeitsweise des präfrontalen Cortex zu erkennen:- Bei den Borderline-Patientinnen war der Bereich, der für die kognitive Beurteilung von Gefühlszuständen Anderer zuständig und entscheidend ist, weniger stark aktiviert. Dieser ist für die Fähigkeit des „Mentalisierens“ verantwortlich – also für die reflektive Einstufung von Gefühlswahrnehmungen. Im Alltag hilft uns das, die Absichten und Motivationen Anderer besser einschätzen zu können (siehe die Theory-of-Mind von Peter Fonagy)
- Ein anderer Faktor, der die Forscher beeindruckt hatte, war, dass sich bei den „normalen“ Studienteilnehmern ein Gewöhnungseffekt / eine Abstumpfung eingestellt hat, wenn immer wieder dieselben Reize angesprochen wurden. Die von Borderline Betroffenen hingegen reagierten dann immer intensiver, emotionaler und gestresster.
Fallbeispiel 3 – Eva und Christoph
Ein großes Problem, das hierbei entsteht, ist, dass diese plötzlichen Stimmungsänderungen nicht nur für den Borderliner, sondern auch für die Umgebung sehr belastend sind. Ich möchte in diesem Beispiel einmal die Geschichte von Eva und Christoph erzählen… (Alle Namen und Personen in meinen Beispielen sind natürlich verfremdet, um die Privatsphäre zu respektieren).
Eva arbeitete bereits seit einigen Jahren als Prostituierte in Tschechien.
Ihre Mutter hat sie und ihre jüngere Schwester in dieses Gewerbe eingeführt und war praktisch ihre Zuhälterin… Eines Tages betrat ein deutscher Geschäftsmann das Bordell, verliebte sich in sie und beide wurden ein Paar.
Nach wenigen Wochen wurde sie schwanger und zog bei ihm in sein frisch gekauftes Haus ein. Die Idylle schien perfekt zu sein, bis kurz nach der Entbindung…
Für den Partner anscheinend völlig grundlos veränderte sich ihre bisher gute Laune ohne jede Warnung in eine tiefe Verzweiflung, Abneigung und auch Panik vor ihm. Ihr Mann (wir nennen ihn mal Christoph) war am Anfang ihrer Beziehung von ihrer Offenheit, ihrem Humor und natürlich auch von ihrem tollen Aussehen magisch angezogen. Aber Evas Verhalten schlug immer öfter und recht drastisch von den humorvollen Augenblicken zu einem fast schon selbstmörderischen Verhalten um. Ihre Launen wurden so unberechenbar, dass er sich nie sicher sein konnte, ob er sie am Ende des Tages – wenn er nach Hause kam – überhaupt noch antreffen würde. Viel zu oft hatte sie ihm mit Suizid gedroht … von den vielen Trennungsdrohungen mal ganz abgesehen. Für Christoph waren Evas Stimmungsschwankungen sehr quälend, da auch Medikamente nicht anschlugen – was recht typisch bei einer Borderline-Therapie ist.
Was wäre in diesem Falle nun eine vernünftige Therapie gewesen? Drei Schritte bilden hier die Basis:
- Die Ursachen für die Stimmungsschwankungen als ihre Trigger erkennen.
- Dann die Verantwortung für die eigenen Stimmungsschwankungen übernehmen.
- Erst danach lernen, sich der neuen Situation anzupassen.
Wenn Eva gerade depressiv war, konnte sie
- mithilfe eines „Wut/Trigger-Tagebuches“ mit der Zeit ihre Gefühle identifizieren und letztendlich damit auch lernen,
- ihrer Umgebung in Ruhe zu erklären, dass sie sich gerade in der schwarzen Phase befand (Verantwortung übernehmen). Wir kennen dieses Wut/Trigger-Tagebuch bereits aus der Abhandlung Kriterium Nummer 4 – „Starke Impulsivität. Es beruhigt sowohl den Borderliner als auch die Umgebung mit der Zeit und, wenn „die Schuldfrage“ keine Frage mehr ist.
- Konnte sie zu Beginn der Therapie ihre Situation noch nicht so gut erklären, lernte sie anfangs erst kleinere und damit auch leichtere Schritte:
Zum Beispiel erst einmal Durchatmen (das Körperempfinden im prozeduralen Gedächtnis ansteuern) und versuchen zumindest ein paar der Trigger aus dem Weg zu gehen. Ein Marathon wird auch nicht in wenigen Schritten vollzogen… es sind tausende einzelner kleiner Schritt und nicht zwei oder drei Sprünge.
Das Ziel einer Borderline-Therapie war das Lernen von Stabilität – nicht jedoch eine „triggerfreien Umgebung“.
Es geht immer in erster Linie darum
- Eine nicht perfekte Umgebung auszuhalten und damit
- eine gleichbleibende konstante Haltung sich selbst und anderen gegenüber.
Ihr Mann Christoph befand sich in der Beziehung in einem typischen Borderline-Szenario: Was auch immer er machte, ihr war nie etwas recht. Er pendelte in ihren Augen immer wieder zwischen Opfer und Täter hin und her.
Wenn er auf ihre Stimmungen einging, reagierte sie mit Rückzug und Zorn und damit die Rolle eines Opfers. Ignorierte er ihre Gefühle, dann warf sie ihm vor, dass er sich nicht für sie interessierte. Dann war er ein Täter!
Gibt es für dieses Dilemma überhaupt nützliche Tipps? Nun, drei sollten wir hier einmal besprechen.
13.1. Tipp 1 – Das ausweglose Dilemma und seine Wahrheit erklären
Oft bleiben einem Borderliner – der sich gerade in einer typisch emotional instabilen Situation befindet – nur noch Abwehr, Frustration und Widerstand als die einzigen noch sicheren (weil bekannten) Emotionen. Dann spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr, was man als Gegenüber sagt oder tut … Darum merke: Hier – in der schwarzen Phase – kann einfach keiner mehr gewinnen!
Eine Möglichkeit, zumindest noch eine kleine Handlungsvollmacht zu erhalten, wäre die Dynamik und die Hintergründe der Situation mit Hilfe der U.M.W.E.G.©–Methode zu erklären:
- „Ich spüre, dass du vorhin frustriert warst, als ich dir sagte, dass ich heute Abend doch noch länger arbeiten müsste. (M = Mitgefühl) Du wurdest sogar wütend, als ich mich umentschieden hatte, um früher zu Dir nach Hause zu kommen.
- Bitte spüre immer, dass du für mich das Wichtigste in meinem Leben bist. (U=Unterstützung)
- Ich bin mir dessen bewusst, dass du in letzter Zeit selber viel durchgemacht hast. (M = Mitgefühl)
- Da du sowieso im Moment sauer auf mich bist, habe ich mich dann entschieden, zu Hause zu bleiben. Nicht, weil ich irgendwelche Schuldgefühle dir gegenüber habe, wie du es mir vorwirfst (Wahrheit).
- Ich tue es aus einem viel wichtigeren Grund: Wegen Dir! Denn Du bist mir wichtig und ich bin mir bewusst, dass auch du eigene Schwierigkeiten hast (Unterstützung, Mitgefühl).
13.2. Tipp 2. Auf intelligente Art und Weise die Situation verlängern und hinauszögern.
Kennst du solche Sätze wie: „Lebe und nutze den Moment“, oder einfach „Carpe diem“?
Nach der Lehre des Zen-Buddhismus zum Beispiel geht es darum,
- immer weiter zu gehen und das zu tun, was der jeweilige Moment verlangt, egal ob es etwas Gutes oder Schlechtes ist.
- Leben bedeutet hierbei, den Weg und den Augenblick zu gehen, der gerade vor einem liegt.
Dieser Rat, „die Gegenwart zu nutzen“ ist für einen angemessenen Umgang mit Sorgen, Schuld und Schamgefühlen an sich eine recht nützliche Sichtweise – wenn es da nicht die Borderline-Thematik gäbe. Die Erfahrung im Umgang mit Borderline zeigt nämlich, dass sich gerade diese Menschen in Bezug auf ihre Wahrnehmungen und ihre Gefühle sowieso fast immer im Augenblick befinden!
Der Rat, den Moment stärker zu beachten wäre hier wie „Wasser in den Rhein“ oder „Eulen nach Athen“ tragen.
Was aber ist dann so schlimm an dem Moment im Rahmen einer Borderline-Persönlichkeit? Weil unsere Welt in der wir leben und damit auch jeder einzelne Moment nie stabil ist! Je kleiner die Zeitabstände, umso größer werden die permanenten Veränderungen und immer kleiner die Zusammenhänge / der Kontext mit der Vergangenheit und der Zukunft. Durch die hohe Aktivität der Amygdala entsteht grundsätzlich so etwas wie eine emotionale Demenz: Was war oder was kommt, hat für den Moment und damit für meine Empfindungen keinerlei Auswirkungen. Der Borderliner reagiert dann wie ein kleines Kind quengelnd, fordernd und ungeduldig – will alles sofort um es dann später auch nicht mehr zu wollen.
Bitte denke aber immer daran: Die Amygdala ist kein Marathonläufer! Vielmehr könnte man sie mit einem Sprinter vergleichen: Nach einem explosionsartigen Start kommt sie schnell in Fahrt, aber auch genauso schnell aus der Puste. Aus diesem Grunde kann es in solchen Situationen nur von Vorteil sein, die eigene Reaktion – wenn auch nur um 1 bis 5 Minuten – einfach hinaus zu verzögern, statt mit eigener starker Emotionalität in den Diskurs einzutreten.
Ein paar nützliche Antworten könnten sein:
- Ich spüre deine Sorge, lass mich trotzdem zuerst mal in meinen Terminkalender schauen.
- Ich sehe, dass du dies alles so schnell wie möglich erledigt haben möchtest. Lass mich zuerst einmal sehen, ob ich selber ein paar Dinge neu organisieren muss.
- Lass mich bitte diese für mich eine wichtige Angelegenheit erledigen – ich komme später auf alle Fälle zu Dir zurück und dann reden wir hierüber.
Sofern du zu mehr eigenen Handlungen neigst – unter Umständen kann dies auch hilfreich sein, um die eigenen Emotionen runter zu regeln – könntest du auch die „3-Schritt-Methode“ anwenden. Wir hatten diese bereits weiter vorne beschrieben, aber ich würde sie gerne in diesem Kapitel noch einmal wiederholen. Sie dient zum einen dazu, etwas Zeit heraus zu arbeiten, verwirrt den Partner jedoch auch dermaßen, dass für ihn sein eigentliches Ziel nicht mehr im Fokus steht. Die drei Schritte gehen folgendermaßen:
- () Auf den Partner zugehen
- Ihn kurz am Arm berühren…
- (2.) Sofort wieder aus der „intimen Nähe-Zone“ raus
- Mit einem Augenzwinkern wegdrehen
- (3.) Dann sagen: „Ich nehme mir mal einen Kaffee … Möchtest Du auch einen?
- Und ohne eine Antwort abzuwarten, solltest du dann weiter weggehen und dich möglichst aus dem Raum entfernen.
Du spürst bestimmt, wie dies dein Gegenüber fast schon hypnotisch verwirrt und genau das ist doch das eigentliche Ziel: Einen Streit, eine Eskalation mit allen möglichen Mitteln verhindern. Es geht in diesem Moment nicht darum, Recht zu haben, einen Streit zu gewinnen – das ist sowieso unmöglich! Das Verhindern einer Eskalation / einer Kernschmelze steht im Fokus und nichts anderes!
13.3. Tipp 3. mehr Stabilität und Kontinuität aufbauen
Typischerweise spürt es ein Borderliner sogar selber, dass er gerade mal wieder „in Fahrt“ gerät.
Was er sich dabei aber so gar nicht bewusst wird ist das
- WARUM das jetzt mal wieder passiert …
- Warum ist er so unbeständig?
- Warum macht er sich sein eigenes Leben oft so unnötig kompliziert?
Hier kann es eine Hilfe darstellen, diese für die Umgebung sichtbaren widersprüchlichen Einstellungen sehr vorsichtig und behutsam deutlich zu machen und dann gemeinsam (!) an einer neuen Sichtweise arbeiten.
Oder anders ausgedrückt: wenn der Borderliner kein „Wut/Trigger-Tagebuch“ schreiben kann, warum sollten wir dies nicht tun?
Was sagte Karl Valentin bereits? „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen … “Sie machen uns sowieso alles nach.“
Durch das eigene Vorbild und nicht durch viele Worte können wir den Partner, das Familienmitglied, den Freund oder Kollegen ganz einfach in die richtige Richtung motivieren. Das und nichts anderes ist das Prinzip des Leuchtturmes.
Vielleicht entsteht dann folgende Erkenntnis:
- „Als wir dich zum Klavierunterricht angemeldet haben, warst du erst ganz begeistert. Mal bist du voller Freude und dann sagtest du, dass du all das absolut nicht mehr willst und am liebsten den Unterricht aufgeben willst.
Sei dir bitte sicher: Beide Entscheidungen sind für mich okay.
Was aber ist dein wirklicher Wunsch? Wie kann ich dich hierin unterstützen? Nicht der Klavierunterricht, sondern unser Verhältnis zueinander ist mir wichtig. “Deswegen müssen wir darüber reden und letztendlich entscheiden, ob wir hiermit weitermachen wollen oder nicht.“
Solch eine „emotionsgerechte Vorgehensweise“ zeigt, dass das Täter-Opfer Prinzip auf alle Fälle umgekehrt werden sollte.
Was meine ich mit „Emotionsgerechter Vorgehensweise“?
- Zuerst einmal sprechen wir mit Unterstützung und Mitgefühl die Amygdala und den Hippocampus an
- und danach (!) kann dann der Präfrontale Cortex in aller Ruhe mit in die Argumentation involviert werden.
___________________
Zusammenfassung Kapitel 13: U.M.W.E.G. – Kriterium 6 – Stimmungsschwankungen
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam die affektive Instabilität als sechstes Borderline-Kriterium durchdrungen. Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt verstehen, warum Borderliner wie von einem Mähdrescher überrollt werden und ihre “Antennen” ausschließlich nach außen gerichtet sind.
Die fMRT-Studien der Universität Ulm haben uns gezeigt, dass die Spiegelneuronen bei Borderline deutlich stärker aktiviert sind, während der präfrontale Cortex für Mentalisierung schwächer arbeitet. Besonders aufschlussreich war, dass sich bei Gesunden ein Gewöhnungseffekt einstellt, während Borderliner bei wiederholten Reizen immer intensiver reagieren. Das Fallbeispiel mit Eva und Christoph hat uns das ausweglose Täter-Opfer-Dilemma verdeutlicht: Egal was er tat, er war immer schuld.
Die drei Tipps sind praktisch umsetzbar:
- Erstens das Dilemma mit U.M.W.E.G. erklären und die Wahrheit aussprechen.
- Zweitens die Situation intelligent hinauszögern – die Amygdala ist ein Sprinter, keine Marathonläuferin, daher helfen bereits 1-5 Minuten Verzögerung oder die Drei-Schritt-Methode mit Berührung, Augenzwinkern und Kaffee-Angebot.
- Drittens, mehr Stabilität durch das eigene Vorbild aufbauen. Nach Karl Valentin machen uns Kinder sowieso alles nach, also können wir selbst ein Wut-Tagebuch führen und als Leuchtturm dienen.
Ausblick auf Kapitel 14: U.M.W.E.G. – Kriterium 7 – Innere Leere
Nachdem wir die emotionale Achterbahn besprochen haben, wenden wir uns nun dem siebten Kriterium zu: dem chronischen Gefühl innerer Leere. Du wirst hierbei viel besser verstehen, warum die Sinnfrage so zentral ist und wie unsere Social-Media-Gesellschaft mit ihren Hochglanz-Bildern diese innere Leere noch weiter verstärkt.
Viktor Frankls Logotherapie wird uns zeigen, dass wir die Frage umdrehen sollten: Frage nicht, “Was kann das Leben mir bieten?”, sondern “Was kann ich dem Leben bieten?”.
Die drei Wege zur Sinnfindung – Selbstwirksamkeit durch Arbeit, Resonanz durch Liebe und Miteinander, und die Haltung zu unveränderlichen Situationen – werden praktisch umsetzbar.
Besonders wertvoll sind die drei Werkzeuge:
- Sport als Antidepressivum ohne Nebenwirkungen (bereits 20 Minuten lockeres Laufen erhöht nachweisbar Dopamin und Serotonin),
- Hobbys zur Selbstverwirklichung und
- soziales Engagement gegen Einsamkeit. Die erschreckende Zahl, dass Einsamkeit das Sterberisiko um 32% erhöht, zeigt die Dringlichkeit.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn ohne Sinn im Leben bleibt nur die Leere, und ohne Werkzeuge gegen diese existenzielle Verzweiflung können wir Borderline nicht wirksam behandeln.
Kapitel 14 – U.M.W.E.G. – Kriterium 7 –
Kriterium Nummer 7 der Borderline Persönlichkeitsstörung nach dem DSM 5: Ein chronisches Gefühl innerer Leere.
👉 “Der, die das … wer wie was … wieso weshalb warum … wer nicht fragt bleibt dumm …”
14.1. Die Suche nach einem höheren Sinn
Kennst Du noch das Lied von der Sesamstrasse? Dieses Fragen nach einem „Warum“ begleitet uns durch unser gesamtes Leben. Ein „Warum“ fragt nach einem dahinter liegenden größeren Sinn einer Sache und ist wohl DER Unterschied zwischen dem Menschen und der gesamten restlichen Schöpfung.
Einzig der Mensch geht in seiner Fragestellung über die Immanenz (das erfahrbare, greifbare, endliche) hinaus und fragt ab einem gewissen Alter nach einer Transzendenz (das, was uns und unser Leben „übersteigt“ und auch nach unserem Leben noch von Bedeutung ist. Noch nie hat ein Tier ein Grab für ein anderes Tier errichtet, geschweige denn etwas wie einen Grabstein zur Erinnerung nach seinem Tod erstellt.
Wenn für einen Menschen jedoch der Sinn im Leben / ein höheres Ziel fehlt, dann kommt es zu einer inneren Leere. Und genau diese innere Leere ist ein derart charakteristisches Kriterium für die Borderline-Störung, dass sie als eine der neun zentralen Kriterien für ihre Diagnose in den ICD 10 und 11 und den DSM 5 aufgenommen wurde.
Sie kann sehr schmerzhaft sein, denn es fehlt dem Betroffenen oft an einer Lebensvision oder einem Gefühl für höhere Werte / Transzendenzen. Er hat das Gefühl, dass er – ähnlich dem Bild eines Perfektionisten – nichts wert sei, weil er wegen seiner „Störung“ ja nicht viel zu geben hat und / oder es einfach nicht verdient, die Liebe oder Aufmerksamkeit anderer zu erhalten.
Der Vergleich mit dem Perfektionisten ist m.E. nicht weit hergeholt, denn zwischen der Unsicherheit des Borderliners und der des Perfektionisten gibt es viele Gemeinsamkeiten. Meiner Beobachtung nach driftet unsere Gesellschaft nicht zuletzt wegen der vielen Hochglanz-Social-Media Plattformen – in denen sich nur perfekte Menschen in perfekten Situationen darstellen möchten – in eine kollektive innere Leere ab, für die der Borderliner besonders anfällig ist.
→ Was ist die Folge davon?
Nun, wenn ich der Überzeugung bin, lediglich nur dann beachtet, geachtet und geliebt zu werden, wenn ich eine perfekte Leistung abliefere, dann entsteht fast zwangsläufig eine tiefe emotionale Unsicherheit. Und aus einer emotionalen Unsicherheit kann sich dann schnell eine „Emotionale Instabilität 60.30” bilden.
Die Nähe zu Borderline wird dadurch deutlich, dass Borderline die Diagnosenummer F60.31 im ICD 10 hat und von Anfang an in die Gruppe der „Emotionalen Unsicherheit“ unter gelistet wurde.
Emotionale Instabilität und chronische Leere stehen darum sehr eng miteinander in Verbindung – sind aber nicht die einzigen Gemeinsamkeiten. Ähnlich sieht es nämlich auch mit den anderen Kriterien für eine Borderline-Diagnose aus. Zu einer inneren Leere zählen u.a.
- Ein unklares Selbstbild (Kriterium 3 – die Identitätsstörung),
- Sprunghaftigkeit, launisch (Kriterium 6 – Instabile Affekte) und nicht zuletzt
- die Angst vor dem Verlassenwerden (Kriterium 1 – ein verzweifeltes Bemühen, ein Alleinsein zu verhindern).
Dieses alles erdrückende Gefühl einer gigantischen inneren Leere führt häufig zu einem totalen Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben, was logischerweise weitere Schwierigkeiten nach sich zieht (ein circulus vitiosus). Darum ist es das erste Ziel, diese Trennung und Isolierung zu unterbinden.
Das Problem hierbei: So ein Rückzug, ein sich verschließen vor der Gesellschaft ist ein „Minus-Phänomen“ … Im Gegensatz zu den „Plus-Phänomenen“ – bei denen es vergleichsweise einfacher ist, einen Affekt, eine Handlung oder eine Gemütsbewegung wie z.B. Wut zu reduzieren – müssen wir bei „Minus-Phänomenen“ erst einmal eine Antriebsquelle finden und diese auch „anzapfen“.
Das zu erreichen ist in der Praxis oft ein schwieriges Unterfangen und ich kann dir gleich sagen, dass Du mit Worten alleine nichts (!) erreichen wirst.
Denn wie sagte es bereits Karl Valentin (1882 – 1948): „Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen, sie machen uns sowieso alles nach“… Du wirst nicht darum herumkommen, neben Deinen Worten auch Taten, Emotionen und Motivationen folgen zu lassen. Wir werden später über verschiedene Werkzeuge sprechen, die aber alles gemein haben: es muss Kraft, Zeit und Ausdauer (alles gehört zur Kardinaltugend Tapferkeit) investiert werden – und wenn es sein muss, müssen diese zuerst zu 100% von der Umgebung ausgehen.
14.2. Die Logotherapie von Viktor Frankl
Chronische Leere zu bekämpfen ist nichts für Anfänger…
Was dies alles aber noch viel schwieriger macht, ist, dass dieses chronische Gefühl der Leere (vergleichbar mit einem existentiellen Vakuum) bereits seit einigen Jahrzehnten ein Problem unserer gesamten Gesellschaft geworden ist, dem wir uns weltweit immer stärker gegenübersehen. Wir leben in einer Zeit zunehmender Automation (künstliche Intelligenz scheint dies offensichtlich noch stärker anzufeuern) und dies bringt auch eine immer größere Freizeit mit sich.
Aber: Es gibt nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern auch eine Freiheit zu etwas. Was ist damit gemeint? Viele Menschen empfinden eine innere Leere, da sie das Gefühl haben, dass ihnen das Leben nichts mehr zu bieten hätte.
Um nun aus diesem Dilemma herauszukommen, können wir diese Sinnfrage einmal umdrehen.
Fragen wir uns nicht mehr:
- „Was kann das Leben mir bieten?“, sondern stellen wir uns vielmehr die umgekehrte Frage
- „Was kann ich (!) dem Leben bieten?“
Kommt dir diese Frage im ersten Moment noch etwas merkwürdig vor?
Immer mehr Menschen sind existenziell frustriert und erkennen immer weniger, womit sie ihre Lebenszeit ausfüllen sollten. Dieses Problem wird in einer Studie des US-Psychologen Stanley Krippner recht deutlich: Er forschte mit einer Vielzahl junger Drogenabhängiger und hat bei nicht weniger als 100 % von Ihnen erfahren, dass Ihnen alles / ihr gesamtes Leben als sinnlos erscheint. Ein deutliches Signal!
Und das alles, obwohl unsere Industriegesellschaft doch permanent darauf aus ist, möglichst alle unsere Bedürfnisse zu befriedigen…
Schafft sie nicht sogar mit Hilfe von Werbung völlig neue Bedürfnisse entstehen zu lassen, die sie dann befriedigen kann? Aber das menschlichste unserer Bedürfnisse – das „Sinn–Bedürfnis“ geht bei all dem immer öfter als der Verlierer raus. Immer tiefer wird der Einzelne von seinen Traditionen entwurzelt und verliert damit den Bezug zu seinen früher vermittelten Werte.
Gerade aus diesem Grund leiden besonders junge Menschen unter dem starken Gefühl der Sinnlosigkeit. Und wo entsteht Borderline am häufigsten? Statistisch in der Jugend, gegen Ende der Pubertät.
Die chronische Leere (Kriterium Nummer 7) und die Suche nach einem Sinn im Leben gehen wirklich Hand in Hand einher. Darum lass uns kurz etwas tiefer in dieses „Sinn-Thema“ anhand der Logotherapie von Viktor Frankl eindringen:
Viktor Frankl (1905 – 1997) war ein Neurologe und Psychiater in Wien.
Nach Sigmund Freud und Alfred Adler gründete er die 3. Wiener Schule der Psychotherapie. Sein sehr bewegtes Leben war gekennzeichnet von seiner Erfahrung, die er während der drei Jahre langen Gefangenschaft in verschiedenen Konzentrationslagern (Auschwitz, Dachau, Kaufering, Türkheim) machen musste.
Trotz dieser entwürdigenden Erfahrungen – er musste sogar sein erstes Kind unter Zwang abtreiben lassen und verlor bis auf seine Schwester alle seine Familienmitglieder und seine erste Ehefrau in den Konzentrationslagern – war sein ganzes Bestreben immer in Richtung Versöhnung. Bereits vor, während und nach seiner Gefangenschaft arbeitete er an seinem ersten großen Werk: „Ärztliche Seelsorge. Grundlage der Logotherapie und Existenzanalyse“
Dieses Thema (Logotherapie) und die Suche nach einem Sinn im Leben auf der Grundlage der Medizin / Psychologie wurde seine zentrale Vision in seinem Leben – frei nach dem Motto des Schildes, was über dem Haupteingang des vor 230 Jahren erbauten „Allgemeinen Krankenhauses in Wien“ von dem österreichischen Kaiser Joseph II aufgehangen wurde: „Saluti et solatio aegrorum – Zum Heil und zum Trost der Kranken.“ Zu einem Sinn im Leben gehört also nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch der Trost und die seelische Heilung.
Die Bedeutung des Wortes Sinn ist mitunter etwas sehr schwer zu fassen.
Im Althochdeutschen steht hier das Wort „Sin“. Etymologen sind sich nicht ganz sicher, vermuten aber, dass sowohl
- das althochdeutsche „sinnan“ (reisen, streben, danach trachten) als auch
- das lateinische „sentire“ (empfinden, wahrnehmen)
die Grundlage hierfür bilden. Ein Sinnsuchender ist also nichts anderes als „ein Reisender auf der Suche nach Empfindungen“. So betrachtet ist das alles dann nicht mehr ganz so abstrakt. Die Suche nach einem Sinn bezieht sich nämlich nicht mehr auf etwa vages, sondern
- auf ein konkretes Ziel,
- auf eine Situation oder
- auf eine bestimmte Person.
Ein konkreter Sinn hat viel mit einem „Aufforderungscharakter“ zu tun, denn jede Situation stellt ja eine
- Forderung an uns indem sie
- eine Frage an uns stellt. Eine Frage, auf die wir eine Antwort geben müssen. Wir haben also eine Verantwortung indem wir etwas unternehmen oder eine „Herausforderung“ annehmen.
Wir Menschen haben alle einen freien Willen und damit immer die Möglichkeit, eine Situation so oder so nach eigenen Werten / nach eigenen Transzendentien zu gestalten. Das ist der Weg, dem Leben einen Sinn zu geben und einem chronischen Gefühl von Leere wirksam entgegenzutreten.
Einen persönlichen Sinn im eigenen Leben zu finden, dass geht nach der Logotherapie auf 3 Wegen:
- Indem ich in die Selbstwirksamkeit Das schaffe ich durch eine Tat oder ein Werk, was ich verrichte – meine Arbeit, mein Lebenswerk.
- Indem ich in Resonanz mit etwas oder jemandem gehe. D.h. also, dass ich nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Liebe und dem Miteinander mit anderen Menschen einen Sinn erfahre.
- Hier möchte ich einmal den Unterschied zwischen Dostojewski und Goethe herausstellen.
Dostojewski sagte: „Der Mensch kann vieles ertragen.“ Und das stimmt auch, wenn man all das Leid auf dieser Welt einmal betrachtet.
Goethe fügte diesem Umstand aber eine weitere Nuance hinzu. Er sagte:
„Wann immer ein Mensch mit einer Situation konfrontiert wird, die er nicht mehr ändern kann (z.B. sein bevorstehender Tod), so hat er immer noch die Möglichkeit, dieser durch seine Einstellung oder seiner Haltung zur Situation Würde zu verleihen.“
Unsere Einstellung, unsere Haltung zu einer Situation hilft uns, über uns selbst hinaus zu wachsen – etwas Transzendentes zu schaffen. Unser Leben besteht nicht nur aus Leid, Schuld und Tod! Wir können es jederzeit umformen in eine Leistung. … Auch, wenn diese Leistung einzig darin besteht, der Situation eigenverantwortlich mehr Würde zu verleihen.
14.3. Die heutige Gesellschaft fördert innere Leere
Aber was macht es denn so schwierig, in unserer heutigen Zeit einen konkreten Sinn/einen universalen Sinn in unserem Leben zu finden?
Ich möchte mal einen Vergleich heranziehen: Stell dir einen Film vor. Er wird aus unzähligen einzelnen Szenen, Sequenzen und Bildern zusammengesetzt.
Jedes einzelne Bild ist für sich betrachtet aber wichtig, weil es den Zuschauer an einen größeren Sinn heranführt. Und dieser Gesamtsinn des Films dämmert uns oft erst an seinem Ende.
Ähnlich ist dies auch mit unserem realen Leben. Oft zeigt sich uns der Sinn unseres Lebens erst gegen Ende unseres Lebens… Aber genau dieser letzte Sinn am Ende unseres Lebens hängt davon ab, dass wir zuerst einmal den Sinn der einzelnen Lebenssituationen erfüllen, nach bestem Wissen und Gewissen…
Was aber macht es so schwer, heute einen Sinn zu finden? Nun, es hat den Anschein, dass wir immer mehr unsere Vergangenheit und damit unsere Traditionen und Werte verlieren und keine Hoffnung auf die Zukunft setzen.
Dieses „Leben / diese Existenz nur noch für den Moment“ ist zu einem Synonym unserer Zeit geworden. Haben wir uns früher die Spielfilme nur zu einer bestimmten Uhrzeit im Fernsehen ansehen können, so ist heute alles „On Demand“ verfügbar. Die Filme werden immer kürzer bis hin zu einzelnen Snapchat – Bildern… Reels und kurze Stories sind das Maximum, was man heute noch mit der Konzentrationsfähigkeit ertragen kann…
Diese vielen, vielen, kleinen, kleinsten und kurzen Sequenzen, die auf uns permanent einströmen, wirken wie ein Stroboskop-Feuerwerk, verwirren unsere Aufmerksamkeit und damit auch unseren Blick auf das große Ganze…
Und wenn ich keinen Sinn mehr im Großen und Ganzen finde, dann bleibt lediglich ein großes Loch übrig… Und genau hierin liegt einer der vielen Gründe der chronischen Leere, die wir – und ganz besonders der dafür anfällige Borderliner – in unserer heutigen Zeit spüren…
14.4. 3 Werkzeuge im Kampf gegen die innere Leere
Lass uns im weiteren Verlauf einmal drei unterschiedliche Werkzeuge betrachten, die uns hierbei helfen können, der chronischen Leere ein Schnippchen zu schlagen. Wir lassen uns dabei auch weiterhin von den Ratschlägen des großen Viktor Frankls ein wenig inspirieren ….
■ 1. Körperliche Aktivität.
Es ist eine alte Weisheit, jedoch kann diese nicht hoch genug betont werden:
Sorge dafür, dass der Betroffene in Bewegung und vor allem aus dem Haus kommt! Jede Form von Bewegung in einer Außenumgebung ist besser als Sitzen in einem abgeschlossenen Raum. Gehen Sie spazieren, joggen Sie oder nehmen Sie gemeinsam an einem Sportkurs teil. Körperliche Anstrengung und Aktivitäten an der frischen Luft mit einem Blick in die Ferne (wichtig für die Augen damit die Linse flexibel und die angespannten Augenmuskeln gelockert werden) ziehen ihn weg von einem „schwarzen Loch“, in dem er zu versinken droht.
Wir alle sind als Lebewesen für ein Leben draußen in der Natur geeicht. Wir sind förmlich auf körperliche Bewegung gepolt. Nahrung sammeln und jagen, das waren unsere ursprünglichen, zentralen Bewegungsmittel. Unser gesamter Körper – inklusive unserer Verdauung – ist auf diese Bewegungsabläufe perfekt eingestellt. Und ja: er braucht sie sogar, um sowohl den gesamten Organismus als auch seine Psyche (der Vagusnerv lässt grüßen) weiterhin in Schwung zu halten. Ohne ein angemessenes Maß an Sport oder Bewegung in unserer täglichen Routine werden wir trübsinnig, antriebslos und auf Dauer unglücklich… Ein chronisches Gefühl der Leere hat auch viel mit fehlender Bewegung zu tun.
Darum ist Sport ein mehr als vernünftiges Mittel, um unsere körperliche und geistige Gesundheit auf einem vernünftigen Level zu halten und steht nicht umsonst an erster Stelle der Tipps. Regelmäßige Bewegung ist für unser Glücksgefühl viel viel viel wirksamer als jedes erdenkliche Medikament! Schau Dir mal mein Video an „Sport – ein Antidepressiva ohne Nebenwirkungen https://youtu.be/VaRHHUUYlK0
Warum ist das alles so wirksam? Nun, weil durch Bewegung und körperliche Aktivitäten unsere Glückshormone (wie z.B. Dopamin, Serotonin und Endorphine) ausgeschüttet werden. Diese bleiben dann auch über eine deutlich längere Zeit präsent, da sie zwar langsamer als z.B. Glutamat dafür jedoch länger und über einen größeren Gehirnbereich wirken.
Diese Gruppe der breit / diffus wirkenden Botenstoffe wurden einmal mit den Bass- und Höhenreglern eines Radios verglichen. Sie können zwar nicht den Gesang oder die Melodie verändern, jedoch ihre Wirkung drastisch beeinflussen.
Und genau das ist das gute Gefühl nach dem Sport, was wir alle kennen.
Muss ich für solch eine Wirkung nun aber gleich mit dem Marathonlaufen anfangen? Nein! Bereits 20 Minuten lockeren Laufens mehrmals die Woche reichen aus, um den Dopaminspiegel nachweisbar ansteigen zu lassen.
Noch schneller geht es jedoch mit intensiven Sportarten, wo das Gehirn schon nach wenigen Minuten mit dem Ausstoß dieses Botenstoffes anfängt, der uns wacher, konzentrierter und fokussierter werden lässt. Der Dopaminspiegel sinkt nach dem Training zwar wieder ab, jedoch erhöht sich im Gegensatz dazu sein Gegenspieler das Serotonin.
Dieser Neurotransmitter hat auch viele Funktionen in unserem Körper. Unter anderem ist er für die Steuerung des Schlaf- Wach-Rhythmus, unsere Körpertemperatur, unseren Appetit und nicht zuletzt unsere Schmerzempfindlichkeit verantwortlich. Durch Serotonin stellt sich ein Gefühl der inneren Zufriedenheit ein, die sich nicht nur auf das unmittelbare Sportereignis beschränkt, nein! Bei regelmäßigem Training erhöht sich die Konzentration von Dopamin und Serotonin dauerhaft in vielen Bereichen unseres Gehirns und zwar auch in denen, die vom ausgeübten Sport zuerst gar nicht betroffen sind. Solch nachhaltige Steigerungen von Glück, Konzentration und Zufriedenheit sind hier sehr, sehr angenehme Nebenwirkungen.
Regelmäßiger Sport senkt außerdem das Stresshormon Cortisol. Damit erhöht sich wiederum auch unsere Toleranz gegenüber physischen als auch psychischen Stress.
Und noch ein Punkt am Schluss ist wichtig: Sport schenkt uns ein Erfolgserlebnis. Dieser Erfolg steigert dann Stück für Stück unser Selbstvertrauen, das uns dann zu weiteren Prüfungen und Höchstleistungen ermuntern kann. Frei nach Bob dem Baumeister: „Yo, wir schaffen das“
Mit sportlicher Bewegung werden wir darum nicht nur körperlich fitter, sondern auch insgesamt positiver, zuversichtlicher, zufriedener in unserer Haltung dem Leben gegenüber.
Bewegung ist und bleibt eines der wirksamsten Mittel gegen chronische Leere…
■ 2. Zu neuen Interessen anregen
Die Wichtigkeit von Hobbys und persönlichen Interessen kann nicht hoch genug betont werden. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der sich nur noch die wenigsten unter uns durch ihre Broterwerb-Arbeit in ihrem Selbst verwirklichen können. Oft nimmt man eine Arbeit an, die gerade zur Verfügung steht, um irgendwie seine Ausgaben / seine Kosten zu bestreiten.
Wer aber bin ich wirklich, wenn ich mich nicht durch meine Berufstätigkeit bestätigen kann? Die hier aufkommende Leere ist deutlich am Horizont erkennbar. Darum erinnere ich gerne ein weiteres Mal an das Zitat von Viktor Frankl: Wir brauchen nicht eine Freizeit VON etwas, sondern eine Freizeit ZU etwas. Hobbys, wie z.B. Musik hören oder Bücher lesen, regen zu einer intellektuellen Stimulation an, die einen Teil der inneren Leere wieder ausfüllen können. Sie haben aber noch viele weitere Nutzen.
Hobbys können zu einem interessanten Faktor in unserem Lebenslauf werden.
Stell dir mal einen Personalchef vor, der für eine ausgeschriebene Stelle unzählige gleich gute Bewerbungen erhält. Was könnte aus diesen vielen gut qualifizierten Bewerbern herausstechen? Richtig! Unsere Soft Skills werden neben den fachlichen Kompetenzen immer wichtiger!
Unsere Hobbys sagen immens viel über uns aus, ob wir eher introvertiert oder gesellig, ein Teamplayer oder Einzelkämpfer, ein Adrenalin-Junkie oder ein vorsichtiger Typ sind. Je nach ausgeschriebener Stelle ist mal das Eine oder eben das Andere wichtiger.
Hobbys können der Sprung in die eigene berufliche Selbständigkeit sein. Stell dir vor, du interessierst dich für Autos oder ein anderes Thema und beginnst im Internet oder in Fachzeitschriften mit eigenen Blogs über dein Lieblingsthema zu schreiben. Oder du gehst gerne ins Fitness-Studio und siehst, dass du als Trainer sehr geeignet bist. Bist du vielleicht recht begabt im Webdesign und erstellst hobbymäßig Webseiten für deine Freunde und Bekannten? Das sind dann tolle Referenzobjekte für einen Einstieg in die Selbständigkeit.
Hobbys können dein Selbstbewusstsein stärken. Durch Hobbys können wir uns oft selbst verwirklichen und auch Anerkennung von anderen bekommen. Das wiederum stärkt unser Selbstbewusstsein. Die Erfolgserlebnisse, die ich bei meinen Hobbys erlebe, wirken sich zwangsläufig auf mein Ego aus. Und durch ein gestärktes Ego traue ich mir dann auch im Berufsleben deutlich mehr zu.
Zum Beispiel ist das Spielen eines Musikinstrumentes eine gute Übung um ein besseres Gehör zu erlangen, zu experimentieren und die Selbstdisziplin zu steigern.
Hobbys machen Leistungsfähiger (Work-Life-Balance). Gemäß einer Studie des Psychologie Professors Kevin Eschleman machen uns unsere Hobbys um 30 % kreativer und leistungsfähiger, indem sie uns helfen, auf neue Gedanken zu kommen und auch unsere Stärken zu trainieren. Wenn wir uns feste Termine für unsere Hobbys in unseren Kalender eintragen, hilft uns dies, außerhalb unseres Berufes aktiv zu werden (ein Tipp nicht zuletzt für überarbeitete Manager😊).
■ 3. Zu sozialem Engagement ermutigen.
Nach einer Studie des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) aus den Jahren 2013 und 2017 stellte man fest, dass ca. 14 Prozent der Deutschen zumindest zeitweise einsam waren. Während der Corona-Pandemie ab März 2020 stieg diese Zahl dramatisch auf rund 42 % an.
Einsamkeit ist besonders bei jungen Erwachsenen und sehr alten Menschen am stärksten zu beobachten. Vor der COVID-19 Pandemie waren besonders Menschen über 75 Jahren betroffen, gefolgt von der Altersgruppe zwischen 30 und 45 Jahren und erst danach kam die jüngere Altersgruppe von unter 30-Jährigen. Während der Pandemie hat sich dieses Verhältnis dramatisch verschoben, sodass sich die unter 30-Jährigen ebenso einsam fühlten.
Einsamkeit und das chronische Gefühl einer inneren Leere können das Sterberisiko dramatisch beeinflussen. Dies bestätigen immer mehr Forschungen.
- Ein Mangel an sozialen Kontakten erhöht um ca 32 %
- und das Gefühl von Einsamkeit um ca. 14 % das Sterberisiko berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Nature Human Behaviour“.
Eine der verschiedenen körperlichen Ursachen hierfür ist eine höhere Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, was die Körperfunktionen auf Dauer negativ beeinflusst. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, haben Forscher der Harbin Medical University in China hierfür 90 Untersuchungen aus verschiedenen Ländern mit insgesamt mehr als 2,2 Millionen Teilnehmern ausgewertet. Solche Zahlen können darum einfach nicht geleugnet werden. Sie sind ein dramatischer Fakt.
Bereits Martin Buber (ein österreichisch-israelischer Philosoph, 1878 – 1965) kam zu der wichtigen Erkenntnis, dass wir als Menschen nur über ein DU zu unserem ICH kommen. Oder ein anderer Professor für Neurologie sagte einmal: “Die größte Droge eines Menschen, ist der Kontakt zu anderen Menschen.”
Einfach ausgedrückt: Unser Leben wird am intensivsten durch Begegnung gesteuert. Besonders in der Ich-Du-Begegnung finden wir die Beziehung, die uns am ehesten einen Sinn fürs Leben vermittelt.
Und wie können wir solch eine Ich-Du-Beziehung überhaupt aufbauen? Unter anderem durch ein aktives soziales Engagement – das dritte Werkzeug in diesem Kapitel, um etwas gegen die chronische Leere einzusetzen.
Mit dem Begriff des „Sozialen Engagement“ ist gemeint, dass man sich freiwillig und ehrenamtlich – also ohne eine geldmäßige Bezahlung — für einen wohltätigen Zweck einsetzt. Wir „opfern“ praktisch einen Teil unserer uns zur Verfügung stehenden Zeit, um anderen Menschen, Tieren oder der Umwelt zu helfen, sie zu unterstützen oder ihr Leben bzw. ihren Alltag zu verschönern und zu bereichern.
Was für Projekte gibt es bereits, die sich dem Thema Einsamkeit und Kampf gegen eine chronische innere Leere verschrieben haben?
- Im Oktober 2022 startete der DOSB der deutsche Olympische Sportbund das Projekt „Verein(t) gegen Einsamkeit“
Die 87.000 Sportvereine, die im DOSB organisiert sind, gehen dieses Thema ganz offen an und bieten die Möglichkeit, auf ihrer „Plattform“ Gleichgesinnte zu treffen, zu Begegnungsstätten und auch zu einer neuen sozialen Heimat zu werden.
- Hilfstelefone
Hier gibt es die „Nummer gegen Kummer, das Elterntelefon (0800 1110550),
das Kinder- und Jugendtelefon 116111, die Telefonseelsorge 0800 1110111
aber auch das „Silber Telefon” 0800 4 708090 (täglich von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
Die Teilnahme an unterschiedlichen Initiativen wie kirchlichen Gruppen, freiwilligen Organisation, sozialen Vereinen oder die Anmeldung zu Bildungsveranstaltungen runden dieses Thema gut ab und können die Isolation wirksam vermindern.
In den nächsten Kapiteln geht es nun um Themen wie
- (8) Nicht angepasste starke Wut, Schwierigkeit, Wut bzw. Ärger zu kontrollieren.
- (9) Temporäre, paranoide Vorstellungen / starke Dissoziative Symptome (z.B. Depersonalisation)
_______________________
Zusammenfassung Kapitel 14: U.M.W.E.G. – Kriterium 7 – Innere Leere
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam das chronische Gefühl innerer Leere als siebtes Borderline-Kriterium besprochen. Der praktische Nutzen dabei liegt darin, dass wir jetzt noch besser spüren und verstehen, warum die Sinnfrage so zentral ist und wie unsere Social-Media-Gesellschaft mit ihren Hochglanz-Plattformen diese existenzielle Leere noch weiter verstärkt.
Viktor Frankls Logotherapie hat uns gezeigt, dass wir die Sinnfrage eigentlich umdrehen müssen. Wir sollten nicht fragen “Was kann das Leben mir bieten?”, sondern “Was kann ICH dem Leben bieten?”.
Die drei Wege zur Sinnfindung sind praktisch umsetzbar geworden:
- Selbstwirksamkeit durch Arbeit und Lebenswerk,
- Resonanz durch Liebe und Miteinander mit anderen Menschen, und
- die Haltung zu unveränderlichen Situationen – nach Goethe können wir jeder Situation durch unsere Einstellung Würde verleihen.
Die Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft durch Snapchat, Reels und Stories wie ein Stroboskop-Feuerwerk wirkt und den Blick aufs große Ganze vernebelt, erklärt die kollektive Leere. Folgende drei Werkzeuge zur Sinnfindung sind wissenschaftlich fundiert:
- Sport als Antidepressivum (bereits 20 Minuten lockeres Laufen erhöht Dopamin und Serotonin nachweisbar),
- Hobbys zur Selbstverwirklichung (machen uns laut Professor Kevin Eschleman um 30% kreativer und leistungsfähiger) und
- soziales Engagement gegen die Einsamkeit, die das Sterberisiko um 32% erhöht.
Martin Bubers Erkenntnis, dass wir nur über ein DU zu unserem ICH kommen, zeigt die existenzielle Bedeutung von Begegnung.
Ausblick auf Kapitel 15: U.M.W.E.G. – Kriterium 8 – Wutausbrüche
Nachdem wir die existenzielle Leere verstanden haben, wenden wir uns nun dem achten Kriterium zu: den unangemessenen, intensiven Wutausbrüchen und der Schwierigkeit, diese zu kontrollieren.
Du wirst beim Lesen noch besser verstehen, warum Wut, Borderline und Trauma fast immer Hand in Hand gehen und was neurobiologisch im Gehirn passiert.
Die drei Ebenen des Gehirns – Reptiliengehirn für Homöostase, limbisches System mit der Amygdala als Warnmelder, und der Neokortex als Wächter – werden uns zeigen, warum traumatisierte Menschen ihre Wut nicht kontrollieren können.
Besonders aufschlussreich ist, dass die Broca-Region bei Wutanfällen abgeschaltet wird und Betroffene dann verstummen oder wie ein kleines Kind reagieren. Die Erkenntnis, dass alle Traumen präverbal sind, erklärt die Sprachlosigkeit. Die fünf Werkzeuge könnten der Retter für deine Beziehung sein:
- Erstens Zeit geben (die Amygdala ist ein Sprinter, kein Marathonläufer),
- zweitens deeskalieren mit paradoxer Intervention nach van der Kolks Beispiel mit den Kriegsveteranen,
- drittens neu fokussieren wie beim Autofahren mit Fernlicht,
- viertens fair streiten nach der Transaktionsanalyse von Eric Berne mit der unsichtbaren psychologischen Ebene, und
- fünftens die Exit-Strategie mit der Drei-Schritt-Methode.
Dieses Kapitel ist essentiell, denn ohne das Verständnis der neurobiologischen Grundlagen von Wut können wir die explosiven Ausbrüche nur sehr schwer deeskalieren. Und nicht zuletzt lehrt uns das letzte der 36 Strategeme, dass Flucht alles, aber keine Niederlage ist.
Kapitel 15 – U.M.W.E.G. – Kriterium 8
Kriterium Nummer 8 für eine Borderline-Diagnose nach dem DSM 5 sind unangemessene, intensive Wutausbrüche. Probleme, die eigene Wut zu kontrollieren.
Kennst du diese Zitate zum Thema Wut?
- „In der Wut verliert ein Mensch seine Logik“
- „Lange saß ich in meiner Wut bis sie mir sagte dass ihr richtiger Name „Trauer“ sei…
„Wut, Borderline und Trauma! … “Das sind Themen, die zusammen gehören, gleichzeitig aber auch nichts für Anfänger sind“. Weil sie in unserer Gesellschaft jedoch immer häufiger vorkommen, lohnt es sich, damit zu befassen.
- Wut ist eine Emotion wie Ärger, Trauer, Freude, Ekel, Überraschung, Verachtung, Scham, Schuld, Verlegenheit und Scheu.
- Emotionen, (lateinisch emovere = hinausbewegen) sind Körpersignale die allem was wir tun sowohl eine Form als auch eine Richtung geben.
- Wut ist auch eine Botschaft / ein Signal an die Umgebung
- „Komm mir nicht näher“
- Geh aus meiner intimen Sicherheitszone schnell wieder heraus…
Bereits Charles Darwin schrieb in seinem großen aber leider nicht so bekannten Werk mit dem Titel „Der Ausdruck der Gemütsbewegungen“ (1872) dass der wichtigste Zweck von Emotionen ist, eine Bewegung / eine Handlung zu anzustoßen um entweder
- die Sicherheit und / oder
- die körperliche Balance wiederherzustellen
Was werden wir in diesem Kapitel nun besprechen? Im ersten Teil werden schauen, was diese häufig zu beobachtende Wut des Borderliners
- mit einer Traumabiographie und
- einem veränderten Zusammenspiel einzelner Gehirnregionen zu tun hat. Hat ein Trauma wirklich Auswirkungen auf unsere Gehirnaktivität?
- Und im zweiten Teil schauen wir uns an, welche Werkzeuge uns im Umgang mit einem vor Wut schäumenden Menschen zur Verfügung stehen.
Lass uns direkt in das Thema eintauchen. Das Wort Wut stammt – wie so vieles aus unserem Wortschatz – vom lateinischen Wort „Furor“ ab und beschreibt recht gut einen emotionalen Ausnahmezustand.
Furor bedeutet Raserei, Wahnsinn aber auch Leidenschaft. Mir fällt hier der Comic-Held Hulk ein. Im echten Leben ein ganz gewöhnlicher Atomphysiker, nach einem Strahlenunfall jedoch verwandelt er sich – “sobald er wütend wird“ – in ein grünes, starkes Monster.
Psychologisch grenzen wir Wut von Zorn und Ärger durch ihre stärkere Intensität ab. Zornig ist man, wenn sich die ärgerliche Angelegenheit nicht konkret auf das eigene Ich bezieht, sondern auf etwas Übergreifendes. Zorn ist distanzierter als Wut. Wut und Ärger haben aber auch eine wichtige biologische Funktion: Sie sollen uns rechtzeitig alarmieren, falls eine Grenzüberschreitung oder Verletzung droht und mobilisieren in uns Abwehrkräfte (die „Kampf-Flucht-Mobilisierung“)
15.1. Was passiert in unserem Körper bei Wut?
Der Körper wird durch diese Wut-Emotion in eine Alarmbereitschaft versetzt, da er jetzt von Adrenalin und Noradrenalin (unsere Stresshormone) förmlich geflutet wird. Blutdruck und Puls schnellt in die Höhe. Wie eine innere Welle beginnt dieses negative Gefühl durch uns durch zufließen und verbreitet Unruhe bis hin zu Ohnmacht. Neurologen nennen dies die Ausbruchsphase.
Die Folge davon ist, dass dies alles nun auch äußerlich sichtbar wird, wie zum Beispiel durch die Anspannung der Muskulatur des Kiefers oder weit geöffnete Pupillen und zusammengezogene Augenbrauen. Der Körper macht sich praktisch bereit für die Flucht-Kampf-Verteidigung.
- Was löst diese Wut aus?
Hinter Wut verbergen sich zuerst oft ganz andere Gefühle, die eigentlich nichts Schlimmes bedeuten müssen. Das können so vollkommen unscheinbare körperliche Empfindungen sein wie zum Beispiel
- Hunger …
- Oder eine Kränkung wirft uns völlig aus der Bahn,
- Wir vergessen bei einem Auftritt den Redetext.
- Oder wenn wir in einer schwierigen Situation – aus der wir nicht sofort herauskommen können – Hilflosigkeit verspüren (Ohnmacht / Trauma).
In all diesen Situation ist in unserem Gehirn dann mächtig was los, vor allem im limbischen System wo die Amygdala liegt,
- die sehr stark in unsere Gefühlsreaktionen involviert ist
- uns vor Gefahren warnt
- und die Stressreaktionen im Körper einleitet.
Was hat dies alles eigentlich mit unserem Thema „Borderline, die Wut und Trauma“ zu tun? Lass uns zuerst einmal auf das Trauma fokussieren.
Zwar entwickelt bei weitem nicht jeder traumatisierte Mensch eine „Borderline-Störung“, jedoch habe ich noch keinen einzigen Borderliner kennengelernt, der keine imposante Trauma-Biografie vorweisen konnte.
Borderline, Wut und Trauma gehen fast immer Hand in Hand… Darum sind die Trauma-Studien in Verbindung mit der Borderline-Therapie so immens wichtig.
Studien zeigen, dass die Amygdala stark traumatisierter Personen – durch Bilder, Geräusche oder Situationen die ihrem damaligen traumatischen Erlebnis ähneln – sofort eine Alarmreaktion / eine Angstreaktion auslöst – selbst wenn das belastende Ereignis schon viele Jahre zurückliegt. Und es ist ein nachgewiesener Fakt, dass der Betroffene durch diese Bilder in seinen Empfindungen genau so intensiv belastet wird, als müsste er die damalige traumatisierende Situation wieder einmal live durchleben. Das ist klar eine Retraumatisierung und diese löst dann im Angstzentrum automatisch den inneren Kampf- oder Fluchtmodus aus.
Und wenn wir schon bei der Amygdala im limbischen System angekommen sind, dann sollten wir uns auch mit der folgenden Frage beschäftigen:
15.2. Was passiert bei Wut im Gehirn bei traumatisierten Borderlinern?
Lass uns das hochkomplexe Gehirn der Einfachheit halber mal in drei Ebenen unterteilen (auch wenn dies nach den Forschungen von Lisa Feldman Barrett nicht ganz korrekt ist – es soll aber ein Bild hierdurch als Vergleich herangezogen werden)
- das Reptiliengehirn.
- das Säugetiergehirn und
- den Neokortex.
15.2.1. Unser Reptiliengehirn.
Dieses befindet sich in unserem Hirnstamm und zwar direkt über dem Punkt, an dem das Rückenmark in den Schädelknochen eintritt. Alles was wir als Baby zum Zeitpunkt unserer Geburt können, verdanken wir diesem Bereich des Gehirns:
Hunger, Essen, wachen / schlafen, atmen, Körpertemperatur, Schmerz und nicht zuletzt durch Ausscheiden den Körper von Giftstoffen befreien.
Unser Hirnstamm und der Hypothalamus (er liegt direkt über dem Hirnstamm)
- regulieren gemeinsam das Energieniveau unseres Körpers
- Sie beeinflussen die Funktionen von Herz, Lunge, Endokrine und auch das Immunsystem.
- und sind für eine stabile innere Körper-Balance – Homöostase genannt – verantwortlich.
Diese Körperfunktionen sind so fundamental, dass wir schnell übersehen können, wie wichtig sie im Grunde genommen für unser Leben sind. Wenn unser Schlaf mal länger gestört, unser Darm nicht vernünftig arbeitet, wir uns hungrig fühlen oder bei jeder kleinsten Berührung unseres Körpers am liebsten schreien würden (was bei traumatisierten Menschen oft der Fall ist) … dann erst merkt man, wie dringend wir diese Homöostase so brauchen.
Und oft kommen wir aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir erkennen, wie viele psychischen Probleme mit diesen scheinbar „einfachen Störungen“ rund um unseren Schlaf, Appetit, Berührungsempfindlichkeit, Verdauungsproblemen oder anderen unangenehmen Erregungszuständen zusammenhängen. Darum sollte sich jede Trauma-Behandlung – wenn sie wirklich helfen soll – auch mit diesen grundlegenden Körperfunktionen auseinandersetzen.
Was hat all dies mit Wut, Trauma und Borderline zu tun? Wir kommen der Antwort immer näher … Schauen wir uns erst einmal die „zweite Ebene“ unseres Gehirns an:
15.2.2. Das limbisches System – unser Säugetier-Gehirn
Das limbische System ist der in der Entwicklung zweite Bereich und wird auch unser Säugetier-Gehirn genannt, da dieser bei allen in Gruppen lebenden Säugetieren vorhanden ist.
Es entwickelt sich größtenteils erst nach der Geburt und ist der Sitz unserer Gefühle und Emotionen. Hier werden alle möglichen Situationen registriert und beurteilt nach
- Gefahr / Nicht-Gefahr,
- Was ist angenehm oder beängstigend?
- Was ist für das Überleben wichtig oder unwichtig?
- Oder wie sollten wir uns im zwischenmenschlichen Bereich oder in den heutigen komplexen sozialen Netzwerken verhalten?
Unser limbisches System ist im Gegensatz zu dem vorprogrammierten Reptiliengehirn neuroplastisch, adaptiv d.h. es ist lernfähig und es kann lernen aufgrund
- der Reaktion auf das, was es erlebt.
- Durch die Forschungen von Robert Cloninger wissen wir, dass dieses Lernen immer unter Beteiligung der Gene und damit in Verbindung mit unserem angeborenen Temperament geschieht.
Wer mehrere Kinder hat weiß, dass sich Babys von Geburt an in Bezug auf ihr Temperament und ihre Reaktionen auf ähnliche äußere Reize stark voneinander unterscheiden. Diese Neuroplastizität können wir mit einem sehr bekannten Lehrsatz beschreiben: „Neuronen (unsere Gehirnzellen), die „gemeinsam feuern”, vernetzen sich auch gemeinsam.“ („What fires together, that wires together“). Das Ergebnis davon: Wir werden (!) immer nur das, was wir durch unser Leben auch selber erfahren haben… Und wenn ich in einer wut fördernden Umgebung aufwachse, dann fördert dies nicht Ruhe und Ausgeglichenheit – ganz im Gegenteil!
Das limbische System und das Reptiliengehirn werden auch das „emotionale Gehirn“ genannt. Sie sind das Zentrum unseres Zentralnervensystems und haben einzig und allein die Aufgabe, für unser persönliches Wohl zu sorgen.
Kommen wir in eine Situation die das emotionale Gehirn entweder als Gefahr oder als Chance erkennt (z.B. als Reaktion auf ein potentiell angenehmes oder gefährliches Gegenüber), dann versucht es uns durch das Ausschütten bestimmter Hormone in unseren Handlungen zu lenken.
Solche körpereigenen (viszeralen) Empfindungen verlaufen über ein sehr breites Empfindungs-Spektrum. Das kann von leichter Übelkeit bis hin zu einer Panik in der Brust reichen. Ihre Wirkung ist recht einfach erklärt: Sie legen sich wie ein Störfeuer über das, womit sich unser Neokortex kognitiv logisch denkend im Augenblick gerade beschäftigt und lenkt ihn oft nur subtil, dafür aber hocheffektiv in eine ganz andere Denk- oder Handlungsrichtung.
Auch wenn diese sogenannten Steuergefühle Gefühle oft subtil und kaum wahrnehmbar sind, haben sie dennoch einen starken Einfluss auf unsere großen und kleinen Entscheidungen wie z.B. über dass,
- was wir gerne essen möchten
- wo und mit wem wir lieber schlafen,
- was unsere Lieblingsmusikrichtung ist,
- ob wir gerne Autofahren,
- alleine unter der Dusche oder im Chor singen
- und mit wem wir uns anfreunden und wen wir meiden.
15.2.3. Der Neocortex – die 3. Schicht
Auch wenn wir uns bis jetzt etwas intensiv mit dem Aufbau des Gehirns befasst haben, sind wir immer noch beim ursprünglichen Thema: Wut und Kommunikation mit einem Borderliner.
Oft ist das, was die Kommunikation mit einem wütenden Menschen erschwert, nämlich auch die Erwartungshaltung der Umgebung…
- „Warum benutzt Du nicht Deinen Verstand?“
- „Denk doch mal nach / überleg doch mal logisch….“
Solche Sätze hört man oft in einer Diskussion. Aber … Können Betroffene jedoch voll auf ihren kognitiven Verstand zurückgreifen? Werfen wir für die Beantwortung dieser Frage einmal einen Blick auf den Neocortex. Mit ihm können wir deutlich komplexere Entscheidungen treffen als mit dem emotionalen Gehirn, das nur für recht grobe Schlussfolgerungen geeignet ist.
Ein Beispiel: Wir sehen aus dem Augenwinkel einen Gegenstand, der ungefähr wie eine Schlange aussieht. Sofort und ohne Verzögerung reagiert das emotionale Gehirn mit einer Kampf-/ Fluchtreaktion.
Der Neocortex, sieht darin erst nach einem prüfenden Überlegen ein zusammengerolltes Seil und kann unsere Fluchthandlung schnell auslaufen lassen. Er hat in unserem Gehirn wie ein Wächter die Aufgabe, das emotionale Gehirn zu überwachen.
Beide Bereiche: Der Neocortex und das emotionale Gehirn können kaum unterschiedlicher arbeiten: Das limbische System stößt sofort – praktisch automatisch — eine Bewegung an, ohne dass wir uns darüber auch nur einen einzigen bewussten Gedanken oder Plan machen müssen. Ganz anders arbeitet der Neokortex! Diesen haben zwar auch andere Säugetiere, bei uns Menschen ist er jedoch besonders dick und deutlich größer (3 mal größer z.B. als bei einem Schimpansen).
Ab dem zweiten Lebensjahr nach unserer Geburt entwickeln sich unsere Frontallappen (das ist der größte Bereich des Neocortex), mit immer größerer Geschwindigkeit und wir beginnen selber zu denken.
Wir erkennen hier die dritte der drei Internalisierungsphasen – die Phase der Identifikation – in der nicht nur zwischen der Innen- und der Außenwelt, sondern auch zwischen den eigenen Vorlieben und denen anderer unterschieden wird. Interessanterweise bezeichneten die alten Philosophen diese Altersstufe – besonders ab dem 7. Lebensjahr — als das Alter der Vernunft. Und genau in diesem Alter beginnt für viele ja ein komplett neuer Lebensabschnitt:
- Wir kommen in die Schule
- Wir können längere Zeit stillsitzen,
- die Kontrolle über unseren Schließmuskel halten,
- Wir entwickelten die Fähigkeit, uns sprachlich auszudrücken, ohne uns immer auszuagieren.
- Wir lernen zu planen
- und entwickeln die Fähigkeit, uns mit unseren Lehrern und Klassenkameraden irgendwie zu engagieren.
Der Neocortex macht uns als Menschen unter allen anderen Lebewesen einzigartig, denn er ermöglicht es uns,
- eine mehr als komplexe Sprache zu benutzen und auch
- abstrakt zu denken.
- Durch ihn haben wir die Fähigkeit, riesige Mengen von Informationen
- in uns aufzunehmen,
- zu integrieren,
- und mit unserem bisherigen Verständnis zu verknüpfen.
Durch diesen Bereich unseres Gehirns können wir planen, reflektieren, uns Dinge vorstellen und Zukunftsszenarien im Kopf durchspielen. Er hilft uns Voraussagen zu treffen, uns auf eine zukünftige Arbeitsstelle zu bewerben oder gewisse Dinge zu tun oder eben auch nicht zu tun und die Folgen davon im Voraus zu berechnen (zum Beispiel nicht die Rate für das Auto zu bezahlen). Durch ihn haben wir eine Kultur geschaffen, die uns vom Einbaum zum Düsenjäger gebracht hat.
Unser Gehirn ist wirklich ein Wunderwerk im Universum. Trotzdem spielt es uns aber oft auch einen Streich. Und das besonders, wenn es sich um ein Trauma und eine Wutreaktionen handelt.
15.3. Borderline und das Trauma
Borderline und Trauma – diese beiden Themen gehören fast immer zusammen!
Aber nochmals: Auch wenn nicht jeder traumatisierte Mensch ein Borderliner wird, so habe ich praktisch keinen einzigen Borderliner ohne größere Traumabiographie kennengelernt. Darum sollten wir diesem Thema unsere nötige Aufmerksamkeit geben.
Traumatisierte Menschen neigen überdurchschnittlich dazu – anstatt über ihr Leid ruhig zu reflektieren – ihre erlittene Ohnmacht eher in wütenden Handlungen auszuagieren. Der wichtige Merksatz in diesem Zusammenhang ist, dass alle Traumata „präverbal“ sind. Das ist meines Erachtens wohl eine der wichtigsten Entdeckungen, die man seit der Einführung der Gehirnscans hat machen können.
Betrachten wir einmal den linken Frontallappen des Cortex etwas genauer, dann finden wir dort die sogenannte Broca-Region. Sie ist eines der Sprachzentren unseres Gehirns und oft bei Schlaganfall-Patienten betroffen, wenn die Durchblutung in diesem Bereich unterbunden wird. Funktioniert das Broca- Areal nicht richtig, dann können wir unsere eigenen Gedanken und Gefühle nicht mehr in Worte fassen.
Interessant ist zu wissen, dass bei Wutanfällen und Flashbacks dieses Broca-Areal jedes Mal „abgeschaltet“ wird. Die Betroffenen verstummen oder reagieren wie ein kleines ausagierendes weinendes Kind…
Unter extremen Umständen
- brüllen die Betroffenen dann manchmal ganze Schimpftiraden,
- rufen nach ihrer Mama,
- heulen entsetzt auf
- oder verstummen komplett.
Dieses Verhalten erinnert dann an
- Opfer von Überfällen oder Unfällen, die nach dem Ereignis stumm / starr in einer Notaufnahme sitzen.
- Traumatisierte Kinder verlieren hier oft ihre Sprache oder weigern sich einfach nur zu reden.
- Und schauen wir uns Fotos von aus dem Kampf heimkehrenden Soldaten an, dann blicken wir oft in leere, hohle Augen.
Selbst einige Jahre nach den Trauma-Ereignissen fällt es vielen Betroffenen immer noch schwer, über ihre Erlebnisse zu erzählen. Zwar spürt ihr Körper immer wieder dieses Gefühl von Entsetzen, Wut und Hilflosigkeit und auch der Impuls, zu kämpfen oder zu fliehen, kommt hoch, aber es ist ihnen praktisch unmöglich, diese Gefühle mit Worten vernünftig auszudrücken.
Traumata bringen uns buchstäblich an den Rand unseres Fassungsvermögens und machen es uns unmöglich, mit Worten zu vermitteln, was in einem vor sich geht. Und damit sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Thema: Der Borderliner und die Wut und die Kommunikation unter diesen speziellen Umständen mit Hilfe der U.M.W.E.G.©-Methode.
Auch in diesem Kapitel möchte ich den direkten Zusammenhang zwischen
- Wut
- Trauma
- Borderline
- Und PTBS
immer wieder aufzeigen.
Diese Themen gehören fast immer zusammen. Leidet jemand unter einer PTBS, dann kämpft der Körper (nicht der Geist!!!) immer weiter gegen eine ohnmächtig große Bedrohung, die jedoch schon jahrelang nicht mehr besteht (Stichwort Kriegsveteranen oder traumatisierte Kinder). Und diesen Kampf beobachte ich seit Jahren bei praktisch an allen mir bekannten Borderliner.
15.4. Typisch Borderline: Plötzliche Wutausbrüche aufgrund kleinster Reize
Die Wutausbrüche eines Borderliners haben eine ganz besondere Art:
- Sie treten oft ohne Warnung aufgrund allerkleinster niederschwelliger Reize auf.
- Sie erscheinen oft als unangemessen und nicht angebracht
- und werden in Beziehungen immer öfter „vorhersehbar unvorhersehbar“.
Vergleichbar mit dem Frosch in einem sich langsam erhitzenden Wasserglas, erkennen Partner(innen) von Borderlinern oft nicht die langsam immer mehr zunehmende Frustrationen in ihrer Partnerschaft. Wahrscheinlich überhören Sie die Warnsignale des einem Mähdrescher ähnelnden Zorns der sie unverhofft aber laut und zerstörerisch überrollt.
Viele kennen diese Situation: In Sekundenbruchteilen verliert dein Partner / deine Partnerin wegen einer vollkommen belanglosen Bemerkung oder einer Lappalie die Ruhe und verwandelt sich in eine Furie.
Diese plötzlichen Explosionen können für beide Parteien gleich schockierend sein … und um nun in dieser hitzigen Atmosphäre doch noch einen kühlen Kopf bewahren, den Wutausbruch nicht selbst mit giftigen Bemerkungen kontern – das verlangt praktisch eine übermenschliche Kraftanstrengung.
Aber genau das ist die einzig richtige Vorgehensweise! Denn …., wenn sich beide Seiten nun gleichermaßen sehenden Auges bewusst mit in Rage bringen lassen, was kommt dann zurück? Klar! Die Gegenprojektion:
Der Partner / die Partnerin wird die eigene Verantwortung dieser Situation leugnen und stattdessen sagen. „Ich? … Ich bin doch nicht wütend! Du (!) bist derjenige, der wütend ist!“ … das klassische Täter – Opfer – Spiel beginnt nach dem Motto der Ziege im Märchen Tischlein-deck-Dich: „Mäh Mäh … ich spräng über Gräbelein und Bächlein und fand kein einzig Blättelein … Mäh mäh…“
Diesen Part der Beziehung zu ertragen, wo das „Ich hasse dich!“ im Vordergrund steht – das kann für die Beziehung die größte Herausforderung sein. Darum werden wir uns nun mit fünf exemplarischen, aber sehr wichtigen Werkzeugen auseinandersetzen, um die Situation irgendwie doch noch in „ruhige Fahrwasser“ zu bringen. Eine 100%ige Erfolgsgarantie gibt es zwar nicht, sie erhöhen die Chance auf die Abwehr einer Kommunikations-Kernschmelze jedoch massiv.
Tipp (1.) Gib der Sache ihre Zeit (lass Gras über die Sache wachsen).
Zu warten, bis die Zorntirade vorüber ist und erst einmal nicht zu reagieren hört sich so banal an, ist aber mit dem Aufbau unseres Gehirns absolut stimmig. Denn auch wenn wir im Zusammenhang mit Wut als Emotion oft von der Amygdala im limbischen System sprechen, so sollten wir ihren „Wächter“, den medialen Präfrontalkortex niemals außer Acht lassen. Der alte Rat: „Zähle bis 10 und warte dann noch einen weiteren Augenblick, damit die sekundenlange Stille ihre ohrenbetäubende Kraft aufbauen kann“ ist genau der richtige Kontrast zu dem lauten Echo des Ausbruchs und entspricht exakt dem Aufbau unseres Gehirns. Es ist nämlich genau dafür konstruiert, uns vernünftig auf Signale von außen reagieren zu lassen. Diese Informationen gelangen über Augen, Nase, Ohren und die Haut zum
Thalamus und werden dort zu einer Gesamtheit zusammengeführt. Hier im Thalamus – dem sogenannten “Tor zum Bewusstsein” – entsteht das Empfinden dessen, “was ich erlebe.“
Diese Empfindungen werden dann in zwei Richtungen weitergeleitet:
- Einerseits zur tiefer im limbischen System liegenden Amygdala
- und andererseits hinauf in die Frontallappen, wo sie das kognitive logische Bewusstsein erreichen.
Ein Neurowissenschaftler bezeichnete diesen Weg zur Amygdala, den „niederen Weg“ da er eine extrem schnelle und auch unkomplizierte Verbindung darstellt und den Weg zum Frontalkortex, den „höheren Weg“ der im Falle einer ohnmächtigen und bedrohlichen Gefahr jedoch einige Millisekunden länger braucht, um die ankommenden Informationen zu verarbeiten.
Diese Sortierung durch den Thalamus kann aber bei einem Trauma zusammenbrechen. Dann werden übermächtige Geräusche, Anblicke und Berührungen nur noch als isolierte, getrennte oder dissoziierte Fragmente erkannt. Die normale Verarbeitung der Erinnerungen zerfällt, die Zeit bleibt stehen und erstarrt und alles fühlt sich nur noch unendlich lange und gefährlich an. Ein Trauma / oder eine Situation, die uns handlungsohnmächtig zurücklässt bringt unsere Gehirnordnung völlig durcheinander. Was passiert dann aber in der Amygdala, wenn die Wut dann irgendwann die bevorzugte Reaktion wird?
Mit die wichtigste Aufgabe der Amygdala – die auch als Warnmelder des Gehirns bezeichnet wird – besteht in der Prüfung, ob die eintreffenden Signale für unser Überleben wichtig sind. Dies geschieht automatisiert und rasend schnell, wobei der Hippocampus hierbei eine wichtige Rolle spielt.
Spürt die Amygdala irgendeine Form von Gefahr – egal ob möglicher Unfall oder eine bedrohlich wirkende Person – sendet sie unverzüglich ein Signal an Hypothalamus und Hirnstamm, damit das Autonome Nervensystem mit der Produktion von Stresshormonen beginnt (ACTH – Corticotropes Hormon, Cortisol, Adrenalin, Oxytocin, Vasopressin.
Für unser Thema Wut und Wutvermeidung müssen wir jetzt beachten, dass die Amygdala die Informationen vom Thalamus deutlich schneller verarbeitet als die Frontallappen. Und damit entscheidet nämlich sie (!) – lange bevor sich unser Bewusstsein der Situation bewusst ist – ob die Information nun eine Gefahr darstellt oder nicht. Wenn uns später dann mal klar wird, was da vor wirklich sich gegangen ist, ist unser Körper möglicherweise schon längst dabei, sich wieder in Sicherheit zu bringen.
Forschungen mit Personen, die traumatisiert wurden, haben ergeben, dass diese die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung einer Situation zwischen Gefahr und Nicht-Gefahr deutlich erhöhen. Und was ist die Folge davon? Nun, arbeitet unser Alarmsystem fehlerhaft, dann können Wutausbrüche oder eine ganze Systemabschaltung die Reaktion auf harmlose Bemerkungen oder Gesichtsausdrücke die Folge sein.
Wie komme ich nun aus dieser Nummer wieder raus?
Wieso kann mir ein Zählen bis 10 hierbei helfen?
Die Amygdala steht zum Glück nicht alleine da, wenn es um die Einschätzung von Situationen geht. Sie wird durch den medialen Präfrontalen Cortex kontrolliert. Die Amygdala selbst fällt keine Urteile. Ihre Aufgabe ist es lediglich, uns auf einen Kampf oder eine Flucht vorzubereiten, bevor die Frontallappen ihre Einschätzung entwickeln können. Wenn die Amygdala nicht zu sehr feuert, dann können die Frontallappen die innere Balance wiederherstellen. Die Frontallappen prüfen permanent die Reaktionen der Amygdala und wenn sie einen Fehlalarm erkennen, brechen sie die Stressreaktion wieder ab.
Wenn ich also in der Lage bin, durch Achtsamkeit ruhig und objektiv über meinen Gedanken, Gefühle, Emotionen zu schweben und ich mir genug Zeit zum Reagieren nehme, ermögliche ich dadurch den exekutiven Funktionen meines Gehirns, die schnellen aber vorprogrammierten, automatischen Reaktionen im emotionalen Gehirn zu hemmen, neu zu organisieren und eventuell auch bewusster zu formen.
Dadurch ist es uns möglich, nicht bei jeder Kleinigkeit in Wut ausbrechen und die Beziehung zu unserem Partner in Frage zu stellen… Dadurch verlieren wir nicht jedes Mal in Wut unsere Fassung, wenn wir zu lange etwas warten oder wir der Person in der Hotline zum wiederholten Male etwas erklären müssen.
Noch mal zur Wiederholung, da dieser Gedanke sehr wichtig ist: Durch Traumatisierung verändert sich die Balance zwischen der Amygdala und dem Präfrontalkortex radikal. Dadurch wird es ungleich schwerer, die eigenen Emotionen und Impulse unter Kontrolle zu behalten.
Neuroimaging Untersuchungen an Menschen, die sich in emotional stark aufgewühlten Zuständen befinden, zeigen, das starke Wut die Aktivierung besonders der subkortikalen Regionen verstärkt, die bei der Entstehung von Emotionen eine Rolle spielen. Gleichzeitig verringern jedoch genau diese Emotionen die Aktivität verschiedener Bereiche des Frontallappens, die ja eine beruhigende Wächter- Kontrollfunktion für die Emotionen haben sollen. … Na, wenn das nicht ein Teufelskreislauf ist.
Tipp (2.) Erst mal die Wogen glätten – Deeskalieren
In der Psychotherapie gibt es den Begriff der „Paradoxen Intervention“
Sie wird als die Erweiterung der von Viktor Frankl in seiner Logotherapie entwickelten „Paradoxen Intention“ bezeichnet. Die Paradoxe Intervention beschreibt eine Handlung, die auf den ersten Blick erst einmal widersprüchlich zum eigentlichen Zweck erscheint, jedoch gerade durch diesen Umweg schneller zum erhofften Ziel führt.
In der Praxis könnte es nun so ablaufen: Unser Gegenüber wird immer lauter und wir senken unsere Stimme. Die Bewegungen des Partners werden immer hektischer und lebhafter, wir aber kontrollieren unsere Körpersprache immer stärker.
Ein Beispiel aus der Praxis des bekannten Trauma-Therapeuten und Forschers – Bessel van der Kolk soll diese Vorgehensweise einmal plastisch veranschaulichen:
In seinen Arbeiten mit traumatisierten Kindern, Frauen, Kriegsveteranen kommt er mit vielen Arten ohnmächtiger Wut in Kontakt.
Rohe Gewalt, Schlägerei, Trunkenheit und auch die Zahl der Suizide ist in dieser Personengruppe alarmierend hoch. Van der Kolk begann seine regelmäßigen Gruppensitzungen mit jungen Vietnam Kriegsveteranen. In der ersten Sitzung erklärte ein Teilnehmer ohne Zögern frei heraus: „Ich will nicht über den Krieg sprechen.“ Wie sollte man hier reagieren? Ist die weitere direkte Konfrontation mit dem Trauma der richtige Weg, oder sollte man vielleicht doch lieber einen Umweg nehmen?
Van der Kolk antwortete, dass die Teilnehmer über alles reden können, worüber sie reden möchten und fing an zu schweigen. Dieses Schweigen wurde von Minute zu Minute immer unerträglicher (paradoxe Intervention). Nach einer halben Stunde nahezu ohrenbetäubender Stille sprach dann doch ein Veteran über das, was ihm im Krieg zugestoßen ist: der Absturz eines Helikopters. Verblüffender Weise schienen auf einmal alle anderen Teilnehmer urplötzlich zum Leben zu kommen, und sprachen mit Inbrunst und hoher Intensität über ihre eigenen traumatisierenden Erlebnisse.
Das Ergebnis dieser Sitzung: Ab hier kamen dann alle regelmäßig zu den Sitzungen. Warum? In diesem Rahmen fanden sie endlich einmal Gehör für ihr Erlebtes und auch einen Sinn in dem, was für sie vorher nur mit Entsetzen und einer chronischen, tiefen Leere verbunden war. Auch entdeckten sie das Gefühl von Kameradschaft wieder, das für sie während des Kriegseinsatzes so wichtig war.
Van der Kolk verstand damals, dass in traumatisierten Zuständen ein Gegenüber nur entweder „in“ oder „out“ sein konnte. Entweder man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. In der Sprache der Veteranen: Entweder man gehörte zu ihrer Einheit oder man war ein Niemand.
Kommen wir zu unseren Wutanfällen des Borderliners zurück. Verfällt jemand in einen Wutanfall, dann muss man sich mit ihm / ihr erst einmal emotional verbinden, bevor man kognitiv weiterarbeiten kann.
Jeder Mensch mit einer Borderline-Diagnose hat eine Trauma-Biografie. Und durch die Arbeit mit den Kriegsveteranen können wir uns eins merken:
Es ist egal, ob ich ein einzelnes Trauma durch einen Unfall oder ein Entwicklungstrauma habe… Trauma ist und bleibt Trauma!
Und nach einem schweren Trauma teilt sich die Welt für die Betroffenen einfach in diejenigen, die wissen, worum es geht und in diejenigen, die von alledem überhaupt keine Ahnung haben! Personen, die dieses Trauma nicht selbst erlebt haben, sind nicht vertrauenswürdig, da sie gar keine Möglichkeit haben, die Betroffenen in ihrem Leid irgendwie verstehen zu können. Bedauerlicherweise betrifft dies auch recht häufig Ehepartner, Familie, Freunde und Arbeitskollegen.
Mein Lösungsvorschlag hier wäre ganz klar die U.M.W.E.G.©-Methode da sie die gehirngerechte Reihenfolge berücksichtigt:
- Zuerst Amygdala und danach erst
- Der Präfrontalkortex
- (1) Amygdala Sei dir sicher …. ich spüre deine Angst!
- (2) Hippocampus Sei dir sicher … ich werde dich immer unterstützen!
- (3) Präfrontaler Kortex Die Wahrheit aber ist, dass …
- (3.1) wir dieses Problem haben
- (3.2) und ich auf Deine Unterstützung angewiesen bin.
- (3.3) Was wäre Dein Vorschlag und
- (3.4) Wie kann ich dir dabei helfen?
- (3.5) Denn … WIR sind das Team!!!
Tipp (3.) Sich neu fokussieren.
Wenn man in einem Wutanfall die Quelle ignoriert, dann flammt der Zorn an einer anderen Stelle wieder neu auf. Mein Tipp in diesem Zusammenhang: Lenken wir den Fokus der Sinneseindrücke auf einen anderen Bereich.
Wut ist eine Emotion und Emotionen sind Signale an die Umwelt und von der Umwelt. Ich muss also für neue Signale sorgen, welche mich in ein ruhigeres Fahrwasser lenken.
Frei nach dem Motto:
- Ich kann zwar nicht verhindern, dass ein Vogel über meinem Kopf fliegt, aber ich kann verhindern, dass er ein Nest auf meinem Kopf baut.
- Auf uns übertragen würde dies bedeuten, dass wir schlechte Gedanken, die zu Wut führen, nicht verhindern können. Da wir aber nicht diese Gedanken sind (!) können wir uns mit anderen Gedanken und Sinneseindrücken bewusst befassen.
Ich vergleiche dies sehr gerne mit der Situation eines Autofahrers:
Du fährst abends auf einer dunklen Landstraße. Es regnet und es kommt Dir ein Autofahrer mit Fernlicht entgegen. Trotz deinem freundlichen und kurzen Aufblinken bleibt sein Fernlicht an. Was solltest du nun tun, um dein Fahrzeug sicher an dieser Situation vorbeizuführen?
Richtig: Du konzentrierst dich auf den rechten Fahrbahnrand. Dadurch hast du den Blick vom blendenden „Problem“ abgelenkt und dich auf den sicheren Bereich fokussiert.
Solch ein Vorgehen ist kein Ausblenden eines Problems! Ganz im Gegenteil! Es ist ein Fokussieren auf die Lösung.
Tipp (4.) Fair streiten.
Das Wort fair kommt aus dem mittelenglischen Wort „fair / fager“ ist verwandt mit dem althochdeutschen „fagar“ und dem norwegischen „vakker“ die alle die Bedeutung haben von
- „schön“
- Gut, gerecht, den Regeln entsprechend.
Was bedeutet dies in der Praxis? Was ist faires Streiten und wie hilft uns dies bei Wutanfällen eines Borderliners oder überhaupt eines wütenden Menschen?
- Faires Streiten ist kein gegeneinander Aufrechnen… „Wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, dann möchte ich dir folgendes mal an den Kopf werfen…”
- Es ist kein Kontern in dem Sinne: „Du bist wie Dein Vater / Deine Mutter…“, „Hast du etwa Deine Tage?“ oder „Ist die Wirkung deiner Medikamente vorbei?”“
- Vermeide immer und ganz besonders im Streit, dein Gegenüber mit einer Diagnose anzusprechen. „Hast du mal wieder dein Borderline?“
Lass uns lieber aus einem „Streit“ einen Tanz machen. Wie geht das?
Wer sich mal etwas intensiver mit der Transaktionsanalyse von Eric Berne auseinandergesetzt hat, der weiß, dass jede Kommunikation eigentliche eine Transaktion von Informationen auf 2 Ebenen darstellt: Sie ist unterteilt
- in eine sichtbare, soziale „deskriptive“ Ebene und
- in eine unsichtbare „psychologische“ Ebene unterteilt werden kann.
Darum ist es wichtig, in einem Streit auch die dahinter liegende unsichtbare psychologische Botschaft zu erkennen.
Nehmen wir das Beispiel „Es geht mir ums Prinzip“. Gesagt wird: „Das wurde mir angetan“. Auf der nicht sichtbaren / nicht ausgesprochenen Ebene kommt aber die Botschaft „Bitte sieh doch, dass mir Unrecht angetan wird. Ich brauche deinen Zuspruch. “Bitte sage, dass ich nicht falsch bin.“ Spürst du die Tiefe der Botschaft, die oft im Streit einfach untergeht?
Wenn du dich mehr mit der Transaktionsanalyse auseinandersetzen möchtest, dann schau dir bitte meine Playlist mit über 30 Vorträgen hierzu auf meiner Webseite www.psychologie-hilft.de an…
Tipp (5.) Nutze die Exit-Strategie
Wenn nichts mehr geht und du das Gefühl hast, dass es gleich sogar körperlich werden kann, dann verlässt der Schlauere von Beiden die Kampf-Arena. Denn, ist ein Borderliner erst einmal in seinem Wut-Modus, dann lässt sich der Konflikt oft nicht mehr mit Worten oder kognitiven Denkansätzen lösen.
Diskussionen und Debatten sind hier völlig fehl am Platze – sogar kontraproduktiv, weil sie zu einer Verschlechterung der Situation beitragen.
Statt die Vorwürfe des anderen zu kontern, sollte man das eigentliche Thema des Konfliktes ansprechen und anerkennen, dass das Gegenüber eine eigene Meinung hat, die man im Moment zwar nicht teilt und sich keine Übereinkunft erzielen lässt … jedoch ist man sich zumindest darin einig, dass man sich im Moment noch nicht einig ist.
Dieser Satz ist recht wichtig! Wir suchen Übereinstimmung mit unserem Gegenüber. Und so ungewöhnlich es sich auch zuerst einmal anhört: sich darin einig zu sein, dass man zwei unterschiedliche Meinungen hat, kann die Situation paradoxerweise spürbar entlasten!
Weitere Diskussionen kann man immer noch später führen, wenn sich die Atmosphäre etwas beruhigt hat, was auch recht schnell vonstattengehen kann, da die Amygdala kein Marathonläufer, sondern eher ein Sprinter ist. Denke immer daran, dass Grenzen im Frieden aufgebaut und nur im Krieg verteidigt werden. Suche also die ruhigen Augenblicke um zu reden und gehe in emotional aufgeladenen Situationen schnell aus dem Ring.
Damit dies alles wirkungsvoll geschieht, empfehle ich dir, eine Exit-Strategie einzuüben, die sich oft schon bewährt hat. Das Ziel hierbei ist es, aus dem Streit hinauszugehen, indem man sein Gegenüber fast schon hypnotisierend verwirrt und damit seinen Fokus vom Streit ablenkt: meine bereits beschriebene “Drei-Schritt-Methode”.
Hier die drei Schritte im Einzelnen:
- () Auf den Gegenüber zugehen und
- Kurz am Arm berühren
- (2.) Sofort aus der „Nähe-Zone“ raus
- Mit einem Augenzwinkern wegdrehen
- (3.) „Ich nehme mir mal einen Kaffee … Möchtest Du auch einen?
- Ich gehe weiter weg (am besten ohne eine Antwort abzuwarten)
Vielleicht wirst Du bereits durch das Lesen dieser Strategie verwirrt. Da sich diese Schritte – einzeln betrachtet – jedoch völlig unlogisch zu dem Streit verhalten, ergeben sie in der Gesamtheit wiederum ein logisches Ziel:
- Maximale Ablenkung vom eigentlichen Streit!
Und dieses „Raus aus dem Streit“ ist beileibe keine Niederlage. Ich bin ein Freund der 36 chinesischen Strategeme. Das Wort Strategem könnte man zwar auch mit einer Kriegslist übersetzen, hat aber eine sehr viel umfassendere Bedeutung. Die letzte der 36 Strategeme lautet: „Weglaufen.”
Wenn ich von meinem Gegner überwältigt bin, dann kämpfe ich nicht mehr, sondern ich wähle aus zwischen sich ergeben, einen Vergleich anbieten oder die Flucht eingehen.
Sich zu ergeben, ja das wäre eine Niederlage. Einen Vergleich eingehen ist eine halbe Niederlage. Zu flüchten ist jedoch keine (!) Niederlage! Denn solange ich nicht geschlagen wurde, habe ich immer noch die Chance zu gewinnen. Flucht ist vielmehr ein Wechsel der Position – das aber nur für die Strategen unter uns 😊
_________________
Zusammenfassung Kapitel 15: U.M.W.E.G. – Kriterium 8 – Wutausbrüche
In diesem Kapitel haben wir gemeinsam die unangemessenen, intensiven Wutausbrüche als achtes Borderline-Kriterium kennengelernt.
Der praktische Nutzen in diesem Wissen liegt darin, dass wir jetzt deutlicher verstehen, warum Wut, Borderline und Trauma fast immer Hand in Hand gehen und was neurobiologisch im Gehirn passiert.
Die drei Ebenen des Gehirns haben uns so manches neues gezeigt:
- Das Reptiliengehirn reguliert die Homöostase,
- das limbische System mit der Amygdala als Warnmelder reagiert auf Gefahr, und
- der Neokortex als Wächter überwacht das emotionale Gehirn.
Die zentrale Erkenntnis, dass alle Traumen präverbal sind und die Broca-Region bei Wutanfällen abgeschaltet wird, erklärt die Sprachlosigkeit. Betroffene verstummen oder reagieren wie ein weinendes Kind.
Unser Thalamus als “Tor zum Bewusstsein” leitet die Informationen in zwei Richtungen: zum niederen Weg zur Amygdala und zum höheren Weg zum Frontalkortex, der Millisekunden länger braucht.
Fünf Werkzeuge haben wir besprochen, die Leben retten können:
- Erstens Zeit geben und bis 10 zählen, damit der mediale präfrontale Kortex die Amygdala kontrollieren kann.
- Zweitens deeskalieren mit paradoxer Intervention z.B. nach der Art von Bessel van der Kolks Beispiel mit den Vietnam-Veteranen und der ohrenbetäubenden Stille.
- Drittens sich neu fokussieren wie beim Autofahren mit Fernlicht auf den rechten Fahrbahnrand.
- Viertens stets fair streiten nach der Transaktionsanalyse mit den zwei Ebenen – der sichtbaren deskriptiven und der unsichtbaren psychologischen Botschaft.
- Fünftens die Exit-Strategie mit der Drei-Schritt-Methode zur hypnotischen Verwirrung.
Das letzte der 36 Strategeme lehrt uns, dass Flucht keine Niederlage ist, sondern immer ein Wechsel der Position.
Ausblick auf Kapitel 16: U.M.W.E.G. – Kriterium 9 – Paranoide/Dissoziative Symptome
Nachdem wir nun auch die Wutausbrüche tiefgründig besprochen haben, wenden wir uns nun dem neunten und letzten der Borderline-Kriterien nach dem DSM-5 zu: den paranoiden und dissoziativen Symptomen.
Du wirst verstehen, warum diese im Gegensatz zur paranoiden Persönlichkeitsstörung nur temporär und unter großem Stress auftreten.
Ruth Lanius‘ bahnbrechende Studie mit dem Gehirnscanner wird uns zeigen, dass chronisch Traumatisierte ihren Präfrontalkortex bei Blickkontakt nicht aktivieren können und stattdessen das Periaquäduktale Grau aktiviert wird – das Zentrum für Erschrecken, Niederkauern und Fluchtreflexe.
Die Abgrenzung zur paranoiden Persönlichkeitsstörung F60.0 wird deutlich: Bei Borderline ist es temporär, bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung stabil und lang andauernd.
Die beiden Therapieformen KVT und Fokaltherapie werden uns zeigen, dass kognitive Ansätze in der Akutphase nicht helfen.
Die vier plus eins Werkzeuge werden praktisch umsetzbar sein:
- Erstens für eine sichere, reizarme Umgebung sorgen.
- Zweitens beruhigen. Am besten mit tiefer Stimme und dem Katzenschnurren-Prinzip bei 22-30 Herz.
- Drittens direkte Konfrontation vermeiden und mit Aussagen tanzen.
- Viertens professionelle Hilfe suchen und dem Borderliner eine stabile Beziehung vorspielen.
- Fünftens die drei Verbote: nicht abschätzig reden, sich nicht verteidigen, und niemals lügen.
Dieses Kapitel schließt unsere Reise durch alle neun Kriterien ab und zeigt, dass Borderline eine unreife Stufe in der Entwicklung der Bindungsreife ist.
Kapitel 16 – U.M.W.E.G. – Kriterium 9 –
Kriterium Nummer 9 der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach dem DSM 5: paranoide / Dissoziative Symptome
Borderline ist unter anderem auch eine Störung in der Wahrnehmung, verursacht durch eine komplexe Entwicklungs-Traumatisierung! Nicht jedes Trauma verursacht Borderline, jedoch habe ich noch keinen einzigen Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erlebt, der nicht auf eine lange Traumabiographie zurückblicken musste.
Lass uns darum in diesem Kapitel einmal darüber sprechen, wie sich eine paranoide Wahrnehmung im Rahmen der Borderline-Persönlichkeitsstörung (-Verletzung) zeigt und mit welchem Verhalten man ihr am besten begegnen sollte. Es ist die 9. und letzte der neun Diagnosekriterien für eine Borderline-Störung und vielleicht die am wenigsten Verstandene. Aber es ist möglich, ein wenig den Schleier, der über diesem Thema liegt, zu lüften.
Lass uns
- den Begriff der Paranoia etwas genauer betrachten
- und gegen eine Neurose und Psychose unterscheiden.
Lass uns dabei auch folgendes klarstellen:
- Was ist der Unterschied zwischen einer paranoiden Persönlichkeitsstörung und dem 9. Diagnosekriterium BPS und
- Welche Therapieformen werden aktuell am meisten verwendet?
Im zweiten Teil kommen dann 4 + 1 Werkzeuge (4 x was ich tun sollte und 1 x eine Übersicht darüber was ich vermeiden sollte) zur Sprache, wenn ich mit dem Phänomen paranoider Handlungen in Kontakt komme.
Die drei Begriffe
- Neurose
- Psychose und auch
- Paranoia
werden umgangssprachlich immer wieder sehr ähnlich verwendet. Ihre Bedeutung kann in Wahrheit jedoch nicht unterschiedlicher sein…
Eine Neurose ist ein heute nicht mehr ganz so gebräuchlicher Sammelbegriff für eine größere Zahl unterschiedlicher seelischer Störungen ohne konkrete körperliche Ursache.
Dazu zählen zum Beispiel Angst- und Zwangsstörungen und auch Posttraumatische Belastungsstörungen. Im Unterschied zu einer Psychose verliert der Neurotiker jedoch nie den Bezug zur Realität. Ihm ist klar, dass seine Ängste und seine Zwänge – zum Beispiel eine Angst vor Spinnen oder Höhenangst – überzogene Reaktionen sind.
Wie sieht es mit der Psychose aus? Sie ist eine deutlich stärker gestörte Wahrnehmung der Realität. Im Gegensatz zur Neurose glaubt der Betroffene in seiner Psychose nämlich seinen eigenen Wahrnehmungen. Er ist sich seiner falschen, verzerrten Wahrnehmung gar nicht bewusst und hält sich – zumindest in der akuten Phase – für vollkommen gesund. Psychotiker halluzinieren, entwickeln Wahn- und Verfolgungsideen und hören oft Stimmen. In diesem Zustand sind sie komplett mit allen Bereichen Ihrer Persönlichkeit von Ihren Eindrücken beeinflusst – bei Neurosen sind es nur Teilbereiche.
Der dritte Begriff ist Paranoia – Sie gehört zu den 9 Kriterien, um eine Borderline-Diagnose zu erstellen. Das Wort Paranoia kommt ursprünglich aus dem griechischen Wortschatz.
- Para heißt: daneben, an etwas vorbei….
- Nous hat die Bedeutung des Denkens.
Paranoia können wir mit „Wahnsinn“ und Paranoid mit „missverstehen“ übersetzen.
Sind die Dissoziationen und paranoiden Vorstellungen im Rahmen einer Borderline-Diagnose eigentlich dieselben wie die einer paranoiden Persönlichkeitsstörung? Oder kann man diese voneinander abgrenzen?
Nun, im Gegensatz zu anderen psychiatrischen Krankheiten – wie zum Beispiel einer Schizophrenie – treten diese paranoiden Realitätsverzerrungen bei Borderline (ähnlich Zorn, Wut oder all die anderen Stimmungsschwankungen) oft urplötzlich und dann auch nur in sehr stressigen Momenten auf. Bricht dieser „psychoseartige Schub“ dann aus, so wirkt der Borderliner auf einmal völlig dissoziiert, von der Realität losgelöst und desorientiert. Er fühlt sich von der Wirklichkeit getrennt, kann sich und andere nicht mehr als wirkliche Personen erkennen und spürt paranoide Ängste und Bilder in sich hochkommen. Und auch wenn sich dies alles für einen Außenstehenden als sehr bedrohlich, befremdlich anfühlt … eine Gefahr stellen von Borderline Betroffene in diesen Situationen für andere nicht wirklich da. Ihre Wut geht vielmehr gegen sie selbst und Ihre Ohnmacht der Situation gegenüber.
16.1. F60.0 paranoide Persönlichkeitsstörung./ Eine Abgrenzung
Lass uns mal einen kurzen Ausflug in die Welt der paranoiden Persönlichkeitsstörung unternehmen, damit wir diese Diagnose vom neunten Kriterium der Borderline-Diagnose ein wenig besser abgrenzen können.
Ich finde, dass hier noch einiges an Wissen in der Bevölkerung fehlt, um mit solch einer Form von verändertem Denken und Wahrnehmen umzugehen.
Sie zählt zu den schwersten Störungen innerhalb der Gruppe der Persönlichkeitsstörungen. Die Betroffenen erkennt man an einer misstrauischen Grundhaltung ihrer Umgebung gegenüber. Fast immer sind sie davon überzeugt, dass man ihnen nur Schlechtes antun will und darum ist ihr Verhalten gereizt und aggressiv. Schaut sie zum Beispiel ein Fußgänger in der Einkaufsstraße freundlich an und lächelt dabei, fühlen Sie sich sofort ausgelacht. Ist der Partner abends nicht zu Hause, geht er vor seinem inneren Auge bereits fremd.
Das dies keine Einbildung ist, zeigt eine Forschungsarbeit der kanadischen Psychiatrie-Professorin Ruth Lanius von der Universität Western Ontario. In ihren Forschungen fokussiert sie sich seit Jahrzehnten auf die Neurobiologie der PTBS und hat bereits mehr als 150 Artikel zu diesem Thema verfasst. Eine ihrer interessantesten Arbeiten war die Studie zur Frage, was bei chronisch Traumatisierten im Gehirn passiert, wenn sie mit anderen Menschen in Blickkontakt treten…
Hintergrund dieser Frage ist, dass viele Personen mit einer Persönlichkeitsstörung einfach nicht in der Lage sind, zu anderen einen Blickkontakt aufzubauen, da es ihnen besonders schwerfällt, einem freundlichen aber fremden Blick zu begegnen. Wenn ich dies bei meinen Gesprächspartnern beobachte und weiter nachhake, stelle ich fast immer fest, dass sie von sich selbst ein nicht ertragbares ekelhaftes Bild haben und sie sich aus ihrer Sicht widerlich vorkommen.
Ist so etwas überhaupt im Gehirn nachweisbar? Ruth Lanius ist genau dieser Frage nachgegangen und hat einen Gehirnscanner so präpariert, dass sie vor dem Gesichtsfeld der Patienten einen kleinen Bildschirm anbrachte.
Auf diesem wurden dann zwei kurze Videosequenzen abgespielt:
Zuerst kommt ein freundlicher Mann mit abgewandtem Blick auf den Beobachter zu und schaut erst in der zweiten Filmsequenz direkt nach vorne in die Kamera. Dadurch konnte die Wirkung von einem direkten Blickkontakt und dem eines indirekten / abgewandten Blick auf die Aktivierung der einzelnen Gehirnbereiche verglichen werden.
Zwischen einem „normalen Betrachter“ und einem chronisch Traumatisierten könnte der Unterschied nicht deutlicher ausfallen. Er liegt in der Aktivierung bzw. der Nicht-Aktivierung des Präfrontalen Kortex auf die Reaktion des Blickkontaktes.
Normalerweise hilft uns unser Präfrontalkortex mit den Spiegelneuronen, eine auf uns zukommende Person vernünftig einzuschätzen … Ist sie eventuell gefährlich oder nicht?
Personen mit einer Traumabiografie konnten Ihren Frontallappen jedoch nicht (!) aktivieren und sind deshalb auch nicht in der Lage, an der Person, die auf dem Bildschirm auf sie zukommt, irgendwelche kognitiven Auffälligkeiten zu erkennen. Dieser „blinden Fleck“ in der kognitiven Wahrnehmung aktiviert nun aber eine ganz andere Gehirnregion und zwar das „Zentrale Höhlengrau / die Substantia grisea centralis / das Periaquäduktale Grau“.
Dieser recht einfache Bereich in unserem Gehirn dient jedoch nicht der Einschätzung einer äußeren Situation, sondern in erster Linie dem Selbstschutz. Hier werden das Gefühl des Erschreckens, des Niederkauerns und die Angst- und Fluchtreflexe gebildet. Kein einziger Bereich, der für irgendein soziales Engagement wichtig war, konnte im Gehirn von den traumatisierten Probanden bei dieser Studie aktiviert werden. Wenn jemand sie anschaute, wechselten sie automatisch in Flucht, Kampf oder das Überleben sichernde Verhalten. Erinnert uns das alles nicht an das typisch paranoide Verhalten der Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Mein persönliches Fazit lautet daher: Die veränderte Aktivierung unterschiedlicher Gehirnbereiche und die klar und deutlich nachweisbaren Forschungsergebnisse im fMRT sollten uns daran erinnern, dass Menschen mit dem Störungsbild der Borderline –Persönlichkeitsstörung und ihrem zeitweilig paranoiden Verhalten nicht verrückt sind, sondern dass ihre Gehirnstruktur durch frühere Auslöser verändert wurde.
Um festzustellen, wie stark jemand in seiner Kindheit traumatisiert wurde, empfehle ich den Adverse Childhood Experiences Test – heute besser als ACE-Studie bekannt.
Kommen wir zu dem Kriterium Paranoide dissoziative Störung zurück.
Paranoide Menschen
- werden extrem schnell wütend
- sind außerdem schnell zum Widerstand bereit und
- lassen sich auch nicht von kognitiven Argumenten davon überzeugen, dass ihr Misstrauen oft unbegründet ist.
- Sie reagieren äußerst empfindlich auf Kritik…
- sehen sich ausdauernd in einer Opfer-Rolle. Die schuldigen Täter sind immer die anderen. (Määh määh … die Ziege aus dem Märchen „Tischlein-Deck-Dich“)
- Der Lehrer, der Koch, der Chef, der Kollege und nicht zuletzt der Partner… Schuld sind und haben die Anderen…
Die Folgen solch eines Handelns liegen auf der Hand:
- Durch diese misstrauische und feindselige Art machen sie sich unbeliebt,
- streiten oft mit ihren Mitmenschen
- und haben wegen ihres Misstrauens kaum soziale Kontakte.
16.2. Wie können wir dies zu anderen Störungen abgrenzen?
Manch einen haben diese Kriterien vielleicht an die Schizoide Persönlichkeitsstörung erinnert. Diese können wir aber sehr genau und gut trennen, da Schizoide keine kognitiven oder Wahrnehmungsstörungen wie z.B. Paranoia oder Halluzinationen haben.
Auch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt es eine klare Abgrenzung! Wenn man sich das Kriterium Nummer 9 einmal in Ruhe anschaut, dann kann man erkennen, dass hier von einer zeitweiligen, einer temporären Störung gesprochen wird, die nur unter großem Stress auftritt.
Bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung ist sie dagegen stabil und lang andauernd und lässt sich bis in die Jugend oder das frühe Erwachsenenalter zurückverfolgen.
Neben den Abgrenzungen gibt es aber auch einige Gemeinsamkeiten in den Symptomen:
- Beide reagieren übertrieben empfindlich auf Misserfolge.
- Beide Gruppen neigen lange zu Groll und können Beleidigungen oder Missachtung nicht so schnell vergeben.
- Sie sind streitsüchtig und beharren auf ihrem Recht, auch wenn sie offensichtlich falsch liegen…
- Sie sind misstrauisch, oft auch eifersüchtig ohne Grund und verdrehen Tatsachen, indem sie freundliche oder neutrale Gesten der Umgebung als feindselig interpretieren.
- Sie sind übertrieben überheblich und selbstbezogen
- Gerade in dieser Personengruppe finden sich auffällig viele Personen mit Verschwörungsgedanken zu Ereignissen in ihrer Umgebung oder um die Welt zu erklären.
Was wäre mein wichtigster Tipp im Umgang mit diesem Kriterium? Die paradoxe Intervention.
Paradox stammt aus den beiden griechischen Wörtern:
- Para = gegen oder wider und
- Doxa = Ansicht, Meinung, Vorstellung, Glaube
Paradox bedeutet also: gegen die vorherrschende / allgemeine Meinung.
Einfach etwas tun, womit das Gegenüber gar nicht rechnet.
Denn, um mit Menschen in einer paranoiden, völlig unlogischen Phase richtig umzugehen, muss ihnen anders begegnet werden als mit Kognition oder logischen Argumenten. Da Logik zum Beispiel nichts bringt, kann man auch nicht erwarten, dass die immer wieder wiederholte Logik (wenn ich meine Sätze immer und immer wieder wiederhole) zu anderen, zu besseren Ergebnissen führt … Albert Einstein wird der Satz nachgesagt: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun, jedoch eine andere Reaktion zu erwarten. Oder: Wechsle das Pferd und nicht den Sattel, wenn dein Pferd tot ist…
Was wäre denn nun eine „Trauma-Gehirn-Gerechte Reaktion“?
Diese werden wir im zweiten Teil ansprechen, wenn es um die Werkzeuge geht.
Lass uns zuerst einmal zwei Therapieformen betrachten, die bei einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sehr häufig angewendet werden.
16.3. Aktuell häufig verwendete Therapieformen bei einer paranoiden Persönlichkeitsstörung.
16.3.1. Die KVT – Kognitive Verhaltenstherapie.
Bereits der Name dieser Therapieform zeigt, dass sie darauf abzielt, ungünstige Denkweisen oder Denkmuster zu verändern.
Das Ziel ist, dass der Betroffene
- sein eigenes Misstrauen gegenüber anderen selber hinterfragt
- und neue, soziale Umgangsformen mit anderen erlernt.
- Viele Betroffene leiden unter der Isolation und den Folgen ihres Verhaltens. Darum werden hier soziale zwischenmenschliche Fertigkeiten als Bestandteil der Therapie trainiert.
- Und nicht zuletzt werden neue Strategien für den Umgang mit aggressiven Impulsen
Leider ist diese in den sogenannten akuten, „schwarzen Phasen“, wenn jemand in die Paranoia rutscht, nicht sehr hilfreich. Sie wird in den ruhigen, „weißen Phasen“ trainiert, um die schwierigen Momente später zu reduzieren.
Warum wird sie so häufig verwendet? Nun, die meisten Psychologen lernen sie als festen Bestandteil ihrer Ausbildung. Ursprünglich wurde sie entwickelt, um Phobien wie Angst vor Spinnen, vor dem Fliegen und vor großen Höhen zu behandeln. Sie sollte helfen, neurotische Ängste mit der harmlosen Realität zu vergleichen und dadurch eine Desensibilisierung zu erreichen.
Dies geschieht durch Erzählungen, durch Bilder (Imaginative Exposition) oder indem man die Person in reale aber ungefährliche Situationen versetzt die der traumatisierenden Ursprungssituation ähneln (In–vivo–Exposition)
Diese Therapieform basiert auf dem Gedanken von Sigmund Freud und seinem Mentor Josef Bräuer, dass jemand, der wiederholt einem Angstreiz ausgesetzt wird, ohne dass etwas Negatives passiert, die Angst davor allmählich nachlässt.
Das mag jetzt einfach und logisch klingen, aber bei einer Persönlichkeitsstörung bringt uns das nicht weiter. Persönlichkeitsstörungen entstehen nämlich durch ein Entwicklungstrauma. Und das Wiederbeleben eines Traumas reaktiviert
- das Alarmsystem des Gehirns und
- setzt die für die Integration früherer Erlebnisse erforderlichen Gehirnbereiche außer Kraft.
Die Folge davon: es entsteht eine Retraumatisierung!
Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass die Angst erzeugenden Trigger bis zu 100 Minuten lang intensiv und anhaltend präsentiert werden müssen, bevor es zu einer Reduzierung der Angst kommt. Die KBT ist somit nicht die erste Wahl bei der Behandlung von paranoiden Störungen! Denn im Gegensatz zu ihrer Wirksamkeit bei irrationalen Ängsten (wie zum Beispiel der Höhenangst oder der Angst vor Spinnen) hat sie bei der Behandlung traumatisierter Menschen, weniger gute Ergebnisse erzielt, was vor allem für die Behandlung von Missbrauch und Misshandlung bei Kindern gilt
16.3.2. die Fokaltherapie
Sie wurde von Michael Balint, einem Ungarisch– britischen Psychoanalytiker (1896 – 1970) entwickelt. Die Fokaltherapie konzentriert / bzw. fokussiert sich auf die Klärung und Bearbeitung eines ganz bestimmten und klar umrissenen Kernkonflikts.
Das Ziel wird möglichst klar und so früh wie möglich in der Behandlung definiert. Der Betroffene soll seine Gefühle und seine Gedanken zum Kernkonflikt aussprechen und das wichtigste therapeutische Mittel ist die Interaktion zwischen dem Patienten und seinem Therapeuten.
Die Besonderheit dieser Therapie besteht in der zusammengefassten begrenzten Zeit und Anzahl der dazu benötigten Gespräche. Sie wird auch als Kurz-Psychotherapie bezeichnet.
Das Miteinbeziehen der Angehörigen. Der Helfer am Nest.
Menschen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung haben in der Regel große Schwierigkeiten beim Thema zwischenmenschlicher Beziehungen, da sie ständig erwarten, von anderen hintergangen und verletzt zu werden.
Das schafft natürlich ein sehr unfreundliches Klima, besonders in den Familien.
Für Partner und Familienangehörige ist dieses andauernde Misstrauen eine sehr starke Belastung. Sie fühlen sich hilflos, da sie anscheinend das Verhalten des Betroffenen nicht aktiv beeinflussen können. Dem ist aber nicht so!
Was man als Angehöriger tun kann, ist: Mach Dir immer wieder selbst bewusst, dass dieses unangemessene Verhalten in einer Persönlichkeitsstörung und nicht in dir begründet ist.
- Versuche darum, die ständigen Angriffe auf keinen Fall persönlich zu nehmen.
- Hole dir professionelle Hilfe, auch wenn der Betroffene selbst eine Therapie verweigert kann ein Therapeut oder eine Beratungsstelle Unterstützung darstellen
Und eigentlich sind wir damit bereits bei unserem wichtigen zweiten Teil – den Werkzeugen – angekommen.
16.4. Tipps im Umgang mit paranoiden / dissoziativen Symptomen.
16.4.1. Für eine sichere, angenehme Umgebung sorgen.
Bei einem paranoiden Schub ist die Wahrnehmung der Umgebung stark eingeschränkt. Alles ist irgendwie bedrohlich…
Sorge darum für eine ruhige und vertraute Umgebung mit anderen Menschen, die der Betroffene kennt und denen er auch vertraut.
Distanziere dich von möglichen Waffen und anderen Gefahrenquellen und suche dir einen Ort, von dem aus du den Raum verlassen kannst, wenn du dich selber bedroht fühlst.
Verringere die Menge an Eindrücken für den Betroffenen! Wenn alles bedrohlich ist, dann hilft es bereits enorm, die Anzahl der bedrohlichen Dinge zu reduzieren.
- Bist du in einem Restaurant? Geht nach Hause.
- Bist du am Autofahren? Halte an.
- Ist der Fernseher an oder hört ihr Musik? Schalte das Gerät aus.
- Dringt irgendwoher Lärm durch das Fenster? Schließe alle Fenster und reduziere die Lautstärke.
Das Reduzieren von äußeren Eindrücken ist eine der wirksamsten Methoden in der Akutphase.
16.4.2. Tipp beruhigen
Der 2. Tipp schließt sich dem 1. Tipp gedanklich an, befasst sich aber mit uns als Gegenüber. Was kann ich persönlich tun?
Merke dir: Nicht das MEHR an Tun ist jetzt das was zählt, sondern dass WENIGER an Tun ist das, worauf es in diesem Moment ankommt.
- Tritt nicht auf das Gas, sondern auf die Bremse.
Sorge mit betont leiser, tiefer und beruhigender Stimme für nicht bedrohlich wirkende Interaktionen. Es ist fast schon egal, was du sagst … sprich es nur ruhig aus.
Eltern, die ihre verängstigten Kinder zu beruhigen versuchen, schreien sie ja auch nicht an. Sie summen, singen und wiegen das Kind beruhigend hin und her – ist das Logik? Nein! Aber es beruhigt. Warum wirkt zum Beispiel Katzenschnurren so ungemein beruhigend? Weil die Frequenz von 22 bis 30 Herz ein Ton-Bereich ist, der die Freisetzung von Serotonin bei uns Menschen anregt (unser Glückshormon).
Auf der Seite https://www.doccheck.com/de/detail/articles/13549-katzenschnurren-beruhigt-die-psyche ist nachzulesen, dass immer mehr Psychologen, Homöopathen und Naturheilkundler diese Therapeuten auf 4 Pfoten bei ADHS, Angstneurosen, Depressionen und auch bei Persönlichkeitsstörungen einsetzen um dem Patienten zu helfen. Nimm – wenn möglich – in einer Akutphase ein Tier oder ein kleines Kind in den Arm und streichle es. Wenn dein Gegenüber dies sieht, wird er – dank seiner Spiegelneuronen – selber tief in sich den Wunsch nach Nähe wieder verspüren.
Trost Spenden und ruhige zwischenmenschliche Nähe sind ein elementarer Handlungsteil, da den paranoiden Episoden in der Regel sehr stressige Ereignisse vorhergehen.
16.4.3. direkte Konfrontation vermeiden.
Fast schon logisch und auf der Hand liegend, aber dennoch darf es nicht unerwähnt bleiben: Bitte vermeide jegliche Form von Debattieren oder Selbstverteidigung!
Versuche nicht, deinem Gegenüber das auszureden, was für ihn gerade die Wirklichkeit ist. Für ihn ist es Realität, was er sieht, was er hört und was er fühlt. Und der enorme eigene Stress der ganzen Situation lässt ihn alle logischen Argumente Dritter überhören.
Das heißt jetzt nicht, dass du seine Wahnvorstellungen als korrekt bestätigen musst! Es reicht, wenn du seine Wahrnehmungen im Grunde genommen als das akzeptierst, was sie auch sind … als seine (!) Wahrnehmungen. Und manchmal sind dies genau die goldenen Brücken, die wir für eine Deeskalation nutzen können.
In meinen Gesprächen komme ich sehr häufig mit älteren dementen Personen in Kontakt. Deren innere Wirklichkeit ist oft mit der Realität so weit auseinander, dass man denkt, man befindet sich in zwei unterschiedlichen Welten. Die Kunst der Kommunikation besteht hier nun darin, mit den Aussagen des Gegenübers anfangen zu tanzen. Sagt er / sie z.B. „Sie sind ja verrückt.“ Dann kann man doch auch mal getrost sagen. „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verrückt ich sein kann 😊“ Solche Sätze – mit einem Augenzwinkern begleitet – können der Situation viel an Schärfe entziehen.
16.4.4. Hilfe suchen.
Auch wenn du die schwierigen Situationen bislang immer recht gut selber beruhigen konntest: hole dir auf jeden Fall die Unterstützung Dritter, stelle dir am besten eine Fachkraft zur Beobachtung an deine Seite. Therapeuten sind zwar auch nur Menschen und jeder einzelne Fall von Persönlichkeitsstörung gleicht einem „Neuanfang“, jedoch hat der Therapeut einen Vorteil dir gegenüber:
- Er hat einen großen Erfahrungsschatz.
- Dadurch entwickelt sich eine innere Ruhe und Stabilität im Umgang mit den oft sehr extremen Stimmungsschwankungen des Borderliners. Eine Ruhe, die der Borderliner wirklich dringend benötigt, da seine Welt unruhig, verletzend und gefährlich erscheint.
- Ein weiterer Vorteil einer dritten Person ist folgender: Der Therapeut und Du könnt dem Borderliner – ähnlich einem Theaterstück – eine möglichst stabile Beziehung vorspielen. Die Art und Weise, wie ihr beide in seinem Beisein und trotz seiner Ausbrüche miteinander interagiert, kann ihn dazu motivieren, sich euch beiden anzuschließen.
Der Borderliner ist nicht von Natur aus schlecht! Wir reden hier von einer in seiner Kindheit traumatisierten Person. Dieses Entwicklungstrauma hat ihn so werden lassen, wie er nun ist.
Versuche ihm nun durch dein eigenes Vorbild, unter Zuhilfenahme des Therapeuten erkennen: „so geht eine Beziehung“
16.4.5. Was sollte ich auf alle Fälle NICHT tun?
Worte können einen bis in den Selbstmord treiben, Worte können uns aber auch bis auf den Mount Everest motivieren. Die Macht von Worten ist wirklich enorm. Darum möchte ich in diesem fünften und letzten Unterpunkt den Fokus auf das lenken, was ich mit Worten vermeiden sollte.
- Rede nicht abschätzig über den Anderen.
Auch wenn Du gerade vielleicht sehr würdelos behandelt wurdest, so ist es doch immer das Beste, es nicht mit der gleichen Münze heimzuzahlen.
Dostojewski soll gesagt haben: Der Mensch kann vieles ertragen.
Goethe geht hier aber einen Schritt weiter mit seinem Zitat: Der Mensch ist das einzige Wesen, dass einer noch so aussichtslosen Situation immer noch eine große Würde verleihen kann.
Dies als mahnendes Beispiel im Hinterkopf behalten bitte ich den biblischen Spruch: „Halte auch die andere Wange hin“ zu deinem Motto zu machen. Ein Streit wirft dich nur wieder in alte Handlungsmuster zurück. Sich mit festem Blick umdrehen und den Raum verlassen ist viel würdevoller als alles andere.
- Versuche dich nicht zu verteidigen – stehe zu deinen Handlungen.
Oft wird man in eine Täter-/Opfer-Rolle hineingezogen. Dadurch entwickelt sich schnell eine Abwärtsspirale in der Beziehung. Egal ob du nun Schuld hast oder nicht, halte dich von einer Verteidigungsrede zurück. Sag einfach: „Dann ist das alles wohl so…“ und verlass das Streitfeld. Denke immer daran: Wer sich zurückzieht, hat keinesfalls verloren! Nur wer geschlagen wurde, ist geschlagen. Nur wer einem Vergleich zustimmt hat teilweise verloren. Wer sich aber zurückzieht, kann immer noch sein Gesicht wahren.
- Lügen haben sehr kurze Beine
Die Welt eines Borderliners ist eine Welt voller Narben, traumatischer Erlebnisse und Enttäuschungen. Händeringend sucht er den Halt, den er in der Kindheit nicht finden konnte. Denn nochmals: Eine Persönlichkeitsstörung ist ein Entwicklungstrauma, eine Entwicklungsohnmacht aus der Kindheit heraus. Diese Ohnmacht / Machtlosigkeit gegenüber einer nicht liebenden Welt, beantwortet jedes Kind auf seine eigene Weise…
Um irgendwie Bindung zu generieren
- werden manche Narzissten, um andere zu beeindrucken
- Andere werden Schizoid, da sie sich von der gesamten Welt enttäuscht zurückziehen.
- Wieder andere richten die Wut, die ihrer Ohnmacht entspringt, gegen sich selbst. Sie verletzen sich selbst und werden dadurch noch wütender und rastloser in ihren Beziehungen. Dies sind dann die künftigen Borderliner.
Wenn ich mich nun als nähere Bezugsperson eines Borderliners auch noch in Lügen verstricke … was passiert dann? Klar, der Borderliner wird in seiner Enttäuschung nochmals bestärkt. Das wirkt dann wie ein Brandbeschleuniger auf einem ohnehin brennenden Lagerfeuer. Darum bleibe immer bei der Wahrheit.
Borderline ist eine unreife Stufe in der Entwicklung unserer Bindungsreife. Durch die U.M.W.E.G.©-Methode hältst du ein wirkungsvolles Werkzeug in der Hand, um dich selber zu schützen, die Würde und den Respekt zu wahren und vor allem, dem Borderliner zu helfen, weiter nachzureifen.
Mehr Infos findest du immer auf meiner Webseite www.psychologie-hilft.de
_______________
Zusamenfassung Kapitel 16: U.M.W.E.G. – Kriterium 9 – Paranoide/Dissoziative Symptome
In diesem abschließenden Kapitel haben wir gemeinsam das neunte und letzte Borderline-Kriterium durchdrungen: die paranoiden und dissoziativen Symptome.
Der praktische Nutzen liegt darin, dass wir jetzt die feinen, aber dennoch entscheidenden Unterschiede zwischen Neurose, Psychose und Paranoia nun besser verstehen.
Bei der Neurose bleibt der Realitätsbezug erhalten, bei der Psychose glaubt der Betroffene seinen verzerrten Wahrnehmungen vollständig, und Paranoia bedeutet wörtlich “am Denken vorbei” – ein Missverstehen der Realität.
Besonders wertvoll war die Abgrenzung zur paranoiden Persönlichkeitsstörung F60.0: Bei Borderline treten diese Symptome nur temporär unter großem Stress auf, während sie bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung stabil und lang andauernd sind.
Ruth Lanius’ bahnbrechende Studie hat uns gezeigt, dass chronisch Traumatisierte beim Blickkontakt ihren Präfrontalkortex nicht aktivieren können und stattdessen das Periaquäduktale Grau aktiviert wird – das Zentrum für Erschrecken, Niederkauern und Fluchtreflexe.
Die Erkenntnis, dass diese Menschen nicht verrückt sind, sondern ihre Gehirnstruktur durch frühere Traumata verändert wurde, gibt uns Verständnis und Mitgefühl.
Die beiden Therapieformen KVT und Fokaltherapie haben uns gezeigt, dass kognitive Ansätze in der Akutphase versagen, weil sie bei Entwicklungstraumen zu Retraumatisierung führen können.
Die vier plus eins Werkzeuge sind durch das Lesen des Kapitels nun praktisch umsetzbar geworden:
- Erstens für eine sichere, reizarme Umgebung sorgen – Restaurant verlassen, Auto anhalten, Fernseher ausschalten.
- Zweitens beruhigen mit leiser, tiefer Stimme. Denke immer an das Katzenschnurren-Prinzip bei 22-30 Herz, das Serotonin freisetzt.
- Drittens direkte Konfrontation vermeiden und mit den Aussagen des Gegenübers tanzen – “Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verrückt ich sein kann”.
- Viertens professionelle Hilfe suchen und dem Borderliner gemeinsam eine stabile Beziehung vorspielen wie in einem Theaterstück.
- Fünftens die drei absoluten Verbote: nicht abschätzig reden (nach Goethes Prinzip der Würde), sich nicht verteidigen (Rückzug ist keine Niederlage), und niemals lügen (Lügen wirken wie Brandbeschleuniger).
Die abschließenden Erkenntnisse, dass Borderline eine unreife Stufe in der Entwicklung der Bindungsreife ist, und dass verschiedene Persönlichkeitsstörungen unterschiedliche Antworten auf dieselbe Entwicklungsohnmacht darstellen, runden unser Verständnis ab.
Durch die U.M.W.E.G.©-Methode halten wir nun ein wirkungsvolles Werkzeug in der Hand, um uns selbst zu schützen, die Würde zu wahren und dem Borderliner zu helfen, weiter nachzureifen.
Schlusswort
Du hast es geschafft! Du hast dich durch all die neun Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung gearbeitet und dabei ein ganzes Arsenal an praktischen Werkzeugen kennengelernt. Von der U.M.W.E.G.©-Methode über das Wut-Tagebuch bis hin zum Leuchtturm-Prinzip – jedes einzelne dieser Tools kann dir helfen, die stürmischen Gewässer der Borderline-Kommunikation zu navigieren.
Erinnere dich immer wieder daran: Kommunikation mit einem Borderliner ist kein Kampf, den es zu gewinnen gilt! Es ist vielmehr ein Tanz, bei dem beide Partner aufeinander eingehen müssen. Manchmal führst du, manchmal folgst du. Manchmal stolpert ihr beide, aber genau das macht euch zu einem Team – zu einer Schicksalsgemeinschaft, die gemeinsam wachsen kann.
In diesem Tanz gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Es gibt nur zwei Menschen, die lernen, miteinander im Takt zu bleiben – auch dann, wenn die Musik mal dissonant und nicht passend klingt. Jeder kleine Fortschritt, jede gelungene Kommunikation nach der U.M.W.E.G.©-Methode, jeder Moment, in dem ihr beide als Team funktioniert habt, ist ein Sieg für euch beide!
Sei der Leuchtturm in stürmischer See! Bleib standhaft, sende dein Signal aus und vertraue darauf, dass der Borderliner – auch wenn er gerade in der schwarzen Phase ist – deinen Leuchtturm als sicheren Hafen erkennen wird. Gib ihm Zeit, gib ihm Raum, aber vor allem: Gib nicht auf!
Die Werkzeuge aus diesem Buch sind keine Zauberformeln mit 100%iger Erfolgsgarantie. Aber sie sind erprobt, praxisnah und – das Wichtigste – sie funktionieren! Von der richtigen Reihenfolge beim Ansprechen der Gehirnregionen (Amygdala, Hippocampus, Präfrontaler Cortex) über das Diplomzimmer bis hin zur Exit-Strategie L.M.K. – du hast nun ein komplettes Navigationssystem für den Alltag mit einem Borderliner.
Vergiss niemals: Borderline ist kein Todesurteil für eine Beziehung! Es ist eine Herausforderung, ja. Es verlangt Tapferkeit (Geduld gehört zur Kardinaltugend der Tapferkeit!), Empathie und manchmal auch die Bereitschaft, 77-mal zu vergeben. Aber die weißen Phasen, die Momente echter Verbindung und Intensität – sie sind oft deutlich intensiver und erfüllender als in vielen „normalen” Beziehungen.
Wenn du mehr Unterstützung brauchst, wenn du deine persönliche Situation besprechen möchtest oder wenn du einfach jemanden suchst, der dich versteht – dann besuche mich auf meiner Webseite www.psychologie-hilft.de. Dort findest du nicht nur weitere Videos und Materialien, sondern kannst dich auch für ein persönliches Coaching mit mir in Verbindung setzen. Denn manchmal braucht es einfach einen erfahrenen Begleiter, der mit dir gemeinsam durch das Labyrinth der Borderline-Kommunikation geht.
Du bist nicht alleine! Millionen von Menschen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Und mit den richtigen Werkzeugen, mit Geduld, mit Empathie und – ja – auch mit der nötigen Portion Selbstfürsorge, könnt ihr beide, du und der Borderliner in deinem Leben, nicht nur überleben, sondern wachsen und gedeihen.
Also, nimm diese Werkzeuge, übe sie, mache sie zu deinen eigenen. Und denke immer daran: Jeder Tanz beginnt mit einem ersten Schritt. Und diesen ersten Schritt hast du bereits gemacht, indem du dieses Buch gelesen hast.
Tanze weiter! Und möge euer gemeinsamer Tanz euch beide zu neuen Ufern führen.
Alles Gute auf deinem Weg,
Dein Marcus Jähn
Der Werkzeugkasten dieses Buches
Im Folgenden findest du eine chronologische Auflistung aller Werkzeuge und Tipps, die in diesem für den praktischen Gebrauch im Umgang mit einem Borderliner vorgestellt werden:
Werkzeugkasten für den Umgang mit Borderline-Dynamiken (U.M.W.E.G.©-Methode)
Die U.M.W.E.G.©-Methode dient als systematische Notfallreaktion, um in emotional hoch aufgeladenen Situationen die Kommunikation aufrechtzuerhalten und Eskalation zu vermeiden.
Nr. | Werkzeug / Tool | Kapitel | Beschreibung und Kernprinzipien |
1. | Die U.M.W.E.G.©-Methode (Gesamtsystem) | Kapitel 7 | Ein gehirngerechtes Kommunikationssystem (U.M.W. = Akuter Teil; E.G. = Übergeordnete Haltung). Unterstützung (Hippocampus), Mitgefühl (Amygdala), Wahrheit (Präfrontaler Kortex). Die Methode ist universell einsetzbar, wenn Menschen unter emotionalem Stress stehen. |
2. | Exit-Strategie L.M.K. | Kapitel 7 | Steht für „Lebe mit Konsequenzen“. Sie wird genutzt, wenn alles versucht wurde und die Beschimpfungen anhalten. Sie dient dazu, die Verantwortung für das Leben des Betroffenen klar bei diesem zu belassen. |
3. | Übergangsobjekte einsetzen | Kapitel 8 | Ähnlich wie bei Kleinkindern mit einem Teddy, dienen Gegenstände (z. B. ein getragenes T-Shirt des Partners) als Hilfsmittel, um eine Verbindung bei einer Trennung aufrechtzuerhalten. Dies setzt an der unreifen Persönlichkeitsstufe an. |
4. | Vorbereiten von Trennungen | Kapitel 8 | Bevorstehende, unangenehme Ereignisse (z. B. Geschäftsreisen) sollten klar und deutlich, am besten mehrfach, angesprochen werden, um die explosionsartige Angst vor dem Verlassenwerden zu entschärfen. Positive Rituale am Vorabend helfen. |
5. | Vernünftige Grenzen neu festlegen | Kapitel 8 | Ratschlag: 50% von 100% sind besser als 0% von 100%. Es geht darum, einen Rahmen abzustecken, den beide Seiten auf Dauer erfüllen können, und dadurch Stabilität zu bieten. |
6. | Idealisierungen akzeptieren / Abwertungen distanzieren | Kapitel 9 | Positive Idealisierungen sollen im ersten Moment nicht abgewiesen werden. Ärger des Gegenübers soll registriert und verstanden, aber die Verteufelung der eigenen Person soll nicht akzeptiert werden. |
7. | Die Drei-Schritt-Methode (Kognitive Überforderung) | Kapitel 9 | Diese Hypnosetechnik dient der Ablenkung und Deeskalation bei Wut: (1) Kurze Berührung an der Schulter; (2) Sofortiger Rückzug mit Augenzwinkern; (3) Sagen: “Ich brauche mal einen Kaffee… Möchtest du auch einen?” und den Raum verlassen. |
8. | Die Drei-Spalten-Methode (Vorbereitung) | Kapitel 9 | Strategische Vorbereitung auf Konfrontationen: Redetext, erwartete Angriffe/Einwürfe, rhetorische Konter. Hilft, die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu halten. |
9. | Mentalisieren / Gemeinsame Sprache finden | Kapitel 10 | Durch U.M.W.E.G. erkennen, welche seelischen Vorgänge dem Handeln des Borderliners zugrunde liegen. Gehirngerechte Kommunikation in der Reihenfolge: Emotion (Amygdala), Gedächtnis (Hippocampus), Logik (Präfrontaler Kortex). |
10. | Das Täter-Opfer-Spiel beenden | Kapitel 10 | Die Rollenumkehrung (der Borderliner als “Opferlamm”, die Umgebung als “Täter”) muss konsequent angesprochen werden, um die Eigenverantwortung zu betonen. |
11. | Das Prinzip “So wie es ist, ist es ok” | Kapitel 10 | Notwendige Akzeptanz, Konsequenzen zuzulassen (z. B. Auszug eines volljährigen Kindes). Manchmal muss man den Betroffenen ziehen lassen, damit er zur Besinnung kommt. |
12. | Stabilität von außen (Außenskelett) | Kapitel 10 | Da Borderliner innerlich instabil sind, helfen stabile Gruppen oder Vereine (Sport, karitative Organisationen) als “Außenskelett”, um innere Heilung zu fördern. |
13. | Das Diplomzimmer | Kapitel 10 | Tägliches Ritual: Sich jeden Abend daran erinnern, wofür man an diesem Tag ein Diplom verdient hat (z. B. für Hilfsbereitschaft, Geduld, Entschuldigung). Steigert den Selbstrespekt. |
14. | Der Leuchtturm (Grundhaltung) | Kapitel 10 | Metapher für die eigene Haltung: Dauerhaft und zuverlässig ein konstantes Signal aussenden und nicht bei widersprüchlichem Verhalten des Borderliners hinterherlaufen. Stabilität geben, indem man an der eigenen Position bleibt. |
15. | Das Wut-Tagebuch | Kapitel 11 | Ein “Gegenregister zur Nachprüfung”, um eine Systematik der Impulsivität zu erkennen (Wann, wo, unter welchen Umständen?). Fünf Aspekte: Datum/Uhrzeit, Situation, Verhalten, Gedanken, Gefühle. |
16. | Gemeinsame Aktivitäten in der “weißen Phase” | Kapitel 11 | Gezielte Planung gemeinsamer Erlebnisse (z. B. Kochen, Tanzkurs, Reisen). Gemeinsame Erfahrungen sind es, die ein Paar zusammenhalten und den Partner unersetzbar machen (“Aus einem Kuss ein DU machen”). |
17. | Offenes Visier (WARUM-Frage statt WIESO) | Kapitel 11 | Das Verhalten des Borderliners soll offen und mutig angesprochen werden. Die Frage nach dem WARUM mit anschließender schweigender Pause regt die Selbstreflexion an und verhindert Agieren. |
18. | Kompetente Hilfe holen (Suizid/NSSV) | Kapitel 12 | Jede Suizidandrohung muss ernst genommen und sofort ärztliche Hilfe angefordert werden (z. B. 0800-1110111). Dies dient auch der psychologischen Erziehung, um das Machtspiel zu durchbrechen. |
19. | Umgebung sichern | Kapitel 12 | Alle schädlichen Objekte (Medikamente, scharfe Instrumente, Schusswaffen) müssen auf ein Minimum reduziert und weggeschlossen werden, da die Amygdala ein Kurzstrecken-Sprinter ist und die Minuten zwischen Wunsch und Handlung lebensrettend sein können. |
20. | Alternativprogramm / Am Problem vorbei agieren | Kapitel 12 | Suche nach alternativen Tätigkeiten, die Spannung abbauen (nach Prinzipien der Logotherapie): Intensive sportliche Betätigung, Gestalterische Tätigkeiten, Thermische Reize (z. B. Eiswürfel in der Hand, inspiriert von Wim Hof) oder Roter Filzstift statt Ritzen/Schneiden. |
21. | Das ausweglose Dilemma mit U.M.W.E.G. erklären | Kapitel 13 | Klärung der Dynamik in der Krise, z. B. wenn der Partner sich als Täter fühlt, egal wie er reagiert (Fall Eva und Christoph). Der Partner erklärt die Dynamik mit der U.M.W.E.G.©-Methode. |
22. | Situation intelligent verlängern/hinauszögern | Kapitel 13 | Kurze Verzögerungen (1 bis 5 Minuten) helfen, da die Amygdala ein Sprinter ist. Dies kann durch die Drei-Schritt-Methode oder Verzögerungsantworten (“Lass mich bitte zuerst diese eine wichtige Angelegenheit erledigen”) geschehen. |
23. | Tipp: Mehr Stabilität durch das eigene Vorbild | Kapitel 13 | Wenn der Borderliner kein Wut-Tagebuch führen kann, sollte der Angehörige dies tun. Durch eigenes Vorbild wird der Partner in die richtige Richtung motiviert (“Sie machen uns sowieso alles nach”). |
24. | Körperliche Aktivität / Sport | Kapitel 14 | Wirksamstes Mittel gegen chronische Leere. Bereits 20 Minuten lockeres Laufen erhöhen den Dopaminspiegel nachweisbar. Wirkt als Antidepressivum ohne Nebenwirkungen. |
25. | Zu neuen Interessen/Hobbys anregen | Kapitel 14 | Hobbys dienen der Selbstverwirklichung und Anerkennung, da der Broterwerb oft keine Bestätigung bietet. Sie machen uns um 30 % kreativer und leistungsfähiger. |
26. | Zu sozialem Engagement ermutigen | Kapitel 14 | Aktiver Einsatz für wohltätige Zwecke. Bekämpft Isolation, die das Sterberisiko um 32 % erhöht. Martin Buber: “Wir als Menschen kommen nur über ein DU zu unserem ICH”. |
27. | Zeit geben (Warten bis 10) / Lass Gras über die Sache wachsen | Kapitel 15 | Der Verstand (Präfrontalkortex) braucht länger, um die Amygdala zu kontrollieren. Zeitverzögerung durch Zählen ermöglicht dem Gehirn, die innere Balance wiederherzustellen. |
28. | Deeskalieren (Paradoxe Intervention) | Kapitel 15 | Eine Handlung, die dem eigentlichen Zweck widerspricht (z. B. leiser werden, wenn der Partner brüllt). Van der Kolks Beispiel der “ohrenbetäubenden Stille” bei Kriegsveteranen. |
29. | Sich neu fokussieren | Kapitel 15 | Lenken Sie den Fokus der Sinneseindrücke auf einen anderen Bereich (z. B. den rechten Fahrbahnrand beim Autofahren mit Fernlicht), um die Quelle der Wut zu ignorieren. |
30. | Fair streiten | Kapitel 15 | Vermeidung von Gegenangriffen oder Diagnosen (“Hast du etwa Dein Borderline?”). Konzentration auf die unsichtbare psychologische Botschaft hinter den Worten (Transaktionsanalyse). |
31. | Exit-Strategie nutzen | Kapitel 15 | Wenn nichts mehr geht, den Konflikt verlassen. Flucht ist keine Niederlage, sondern ein Wechsel der Position (Strategem 36). Anwendung der Drei-Schritt-Methode zur Verwirrung. |
32. | Für eine sichere, angenehme Umgebung sorgen | Kapitel 16 | Reduzieren Sie die Menge der bedrohlichen Eindrücke in der Akutphase (Lärmquellen, Fernseher, Gefahrquellen entfernen), da die paranoide Wahrnehmung stark eingeschränkt ist. |
33. | Beruhigen (Katzenschnurren-Prinzip) | Kapitel 16 | Anwendung einer leisen, tiefen Stimme. Die Frequenz von 22 bis 30 Herz (wie beim Katzenschnurren) regt die Freisetzung von Serotonin an und wirkt beruhigend. |
34. | Direkte Konfrontation vermeiden | Kapitel 16 | Nicht versuchen, die Wahnvorstellungen auszureden. Akzeptieren Sie die Wahrnehmung des Gegenübers als seine Realität und nutzen Sie Humor (“Mit Aussagen tanzen”). |
35. | Professionelle Hilfe suchen | Kapitel 16 | Hinzuziehen einer Fachkraft. Dem Borderliner kann durch die Interaktion mit dem Therapeuten und dem Angehörigen eine stabile Beziehung vorgespielt werden. |
36. | Was NICHT tun (Drei Verbote) | Kapitel 16 | 1. Nicht abschätzig reden; 2. Sich nicht verteidigen (“Dann ist das alles wohl so…”); 3. Niemals lügen (wirkt als Brandbeschleuniger auf Enttäuschung). |
Analogie zur Zusammenfassung
Der gesamte Werkzeugkasten der U.M.W.E.G.©-Methode ist vergleichbar mit einem Rettungsring, der in einem Sturm (der emotionalen Krise) geworfen wird.
- Teil 1 des Buches ist die Seekarte, die erklärt, warum das Meer (die Gesellschaft) so stürmisch ist.
- Die M.W.E.G.©-Methode ist die Bedienungsanleitung für das Rettungsboot (die Kommunikation), die genau vorschreibt, in welcher Reihenfolge (Amygdala, dann Hippocampus, dann Kortex) man handeln muss, um nicht im Chaos unterzugehen.
- Die einzelnen Werkzeuge (Diplomzimmer, Roter Filzstift, Leuchtturm, Kaffeepause) sind die spezifischen Ausrüstungsgegenstände, die in bestimmten Notlagen (Identitätsverwirrung, Selbstverletzung, Wutanfall) sofort angewendet werden, um den Überlebenskampf zu stabilisieren und den “weiten Raum” (Chaos) der Gefühle zu ordnen.
Quellenmaterial
1.1 Prävalenz von Borderline & Anteil an Therapieplätzen:
[1] Dahlenburg, S. C. et al. (2024). Global prevalence of borderline personality disorder and comorbidities. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. ScienceDirect [1b] Chapman, J. (2024). Borderline Personality Disorder. In: StatPearls (NCBI Bookshelf). NCBI **[1c] Leichsenring, F. et al. (2024). Borderline personality disorder: a comprehensive review. Psychological Medicine. PMC[1d] Oldham, J. M. (2014). Borderline Personality Disorder. Focus 11(2), 129-146. (Angaben zu 20 % stationären BPD-Patienten) Psychiatry Online
1.2 Suizidrisiko bei Borderline (5–10 %)
[2] Paris, J. (2019). Suicidality in Borderline Personality Disorder. Healthcare, 7(2), 52. PMC [2b] Mental Health America (MHA). Borderline Personality Disorder (BPD) – Factsheet. (bis zu 10 % sterben durch Suizid) Mental Health America
1.3 Selbstverletzendes Verhalten (69–80 % / „2 von 3“ etc.)
[3] Brickman, L. J. et al. (2014). The relationship between non-suicidal self-injury and borderline personality disorder. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 1(1). PMC [3b] Buelens, T. et al. (2020). Comorbidity Between Non-suicidal Self-Injury Disorder and Borderline Personality Disorder in Adolescents. Frontiers in Psychiatry, 11, 580922. Frontiers [3c] Plener, P. et al. (2018). Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen – Hohe Prävalenz in Deutschland. Deutsches Ärzteblatt. Ärzteblatt [3d] Uni Ulm (2018). Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen ist häufig – etwa jeder dritte Jugendliche hat sich mindestens einmal selbst verletzt. Projektbeschreibung. Universität Ulm [3e] BVKJ (2025). Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen – Handout. bvkj.de
1.4 Einsamkeit während Corona (42 %)
[4] Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2021/2022). Einsamkeit in Deutschland – Berichte & Umfragen (z. B. BMFSFJ-Webstatistik, zitiert nach Hochschule Offenburg, 2023). newsroom.mi.hs-offenburg.de+1
1.5 Zukunftsangst (59 % der jungen Menschen)
[5] Hickman, C. et al. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change. The Lancet Planetary Health 5(12), e863–e873. Deutscher Bundest
1.6 Vermögensverteilung – 81 % des Zuwachses an das reichste Prozent
[6] Oxfam Deutschland (2023). „Nur das oberste Prozent gewinnt“ – Auswertung des Berichts zur sozialen Ungleichheit: 81 % des Vermögenszuwachses 2020–2021 gingen an das reichste Prozent in Deutschland. FR.de
📚 LITERATURVERZEICHNIS
Borderline, Epidemiologie & Klinische Psychologie
Dahlenburg, S. C., Özpınar, Ö., Ford, T., Steinberg, L. und Scott, L. N. (2024).
Global prevalence of borderline personality disorder and comorbidities. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
Leichsenring, F., Leibing, E., Kruse, J., New, A. S. & Leweke, F. (2024).
Borderline personality disorder: A comprehensive review. Psychological Medicine.
Chapman, J. (2024). Borderline Personality Disorder. In StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
Oldham, J. M. (2014). Borderline Personality Disorder. Focus, 11(2), 129–146.
Suizidalität & NSSV (Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten)
Paris, J. (2019). Suicidality in Borderline Personality Disorder. Healthcare, 7(2), 52.
Mental Health America (2024).
Borderline Personality Disorder – Factsheet.
Brickman, L. J., Ammerman, B. A. & McCloskey, M. S. (2014).
The relationship between non-suicidal self-injury and borderline personality disorder.
Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 1(1).
Buelens, T., Luyckx, K., Gandhi, A., Molenberghs, G. & Kiekens, G. (2020).
Comorbidity between non-suicidal self-injury disorder and borderline personality disorder in adolescents.
Frontiers in Psychiatry, 11, 580922.
Plener, P. L., Brunner, R., Fegert, J. M. (2018).
Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen – Prävalenz, Hintergründe und Versorgung.
Deutsches Ärzteblatt.
Universität Ulm (UKE) (2018).
Forschungsprojekt „Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen“.
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) (2025).
Handout: Selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen.
Einsamkeit, Stress & gesellschaftliche Trends
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). (2021/2022).
Einsamkeit in Deutschland – Lagebericht und Umfragenauswertungen.
Techniker Krankenkasse (TK) (2016, 2021).
Entspann dich, Deutschland – TK-Stressstudie.
Zukunftsangst & Klimaangst
Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S. et al. (2021).
Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change.
The Lancet Planetary Health, 5(12), e863–e873.
Soziale Ungleichheit & Vermögensverteilung
Oxfam Deutschland. (2023).
Nur das oberste Prozent gewinnt – Bericht zur Vermögensentwicklung 2020–2021.
Gewalt & Schusswaffendaten (USA)
Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions. (2023).
U.S. Gun Violence in 2021 – A Year in Review.
National Center for Education Statistics (NCES). (2022).
School Crime and Safety – School Shootings 2021/22.
Education Week. (2021).
School Shootings This Year – Tracking Incidents.
Kindesmissbrauch
Bundeskriminalamt (BKA).
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021–2023 – Kindesmissbrauch, sexualisierte Gewalt.
Drogenkonsum
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2019–2024).
Drogenaffinitätsstudie & Epidemiologischer Suchtsurvey.
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) (2021–2024).
Suchtberichte & Konsumstatistiken.
Letztes Schlusswort
Warum nehmen Borderline-Dynamiken in unserer Gesellschaft so stark zu?
Warum fühlen sich so viele Menschen leer, überfordert, impulsiv oder orientierungslos?
Und wie können wir wieder stabil kommunizieren – trotz emotionaler Eskalationen?
Dieses Buch liefert Antworten.
Der Autor Marcus Jähn zeigt, wie die neun Borderline-Kriterien heute weit über einzelne Menschen hinausgehen und unser gesellschaftliches Klima prägen: Verlust von Nähe, brüchige Identität, explosive Konflikte, extreme Angst und eine Generation, die zwischen Perfektionismus und Hoffnungslosigkeit schwankt.
Teil 1 – Die Borderline-Gesellschaft
Du verstehst, warum unsere Kultur instabiler wird, warum so viele Beziehungen scheitern, warum Einsamkeit und Angst explodieren und warum wir uns immer mehr in Schwarz-Weiß-Denken verlieren.
Teil 2 – Die U.M.W.E.G.-Methode
Ein praxiserprobtes Kommunikationsmodell, das dir hilft, selbst in hoch eskalierenden Situationen ruhig, klar und verbindend zu bleiben.
Mit konkreten Werkzeuge, Fallbeispielen, Strategien zur Deeskalation und sofort anwendbaren Gesprächsbausteinen.
Dieses Buch ist für dich, wenn du:
• mit einem Borderliner lebst oder arbeitest
• deine Partnerschaft stabilisieren möchtest
• familiäre Konflikte besser verstehen willst
• selbst emotionale Instabilität erlebst
• im therapeutischen, sozialen oder pädagogischen Bereich tätig bist
• unsere Gesellschaft mit psychologischem Tiefgang betrachten möchtest
Ein tief gehendes, klar strukturiertes und praxisorientiertes Buch über eine der wichtigsten psychischen Dynamiken unserer Zeit.
“Borderline verstehen”
und seine Sprache sprechen lernen. Wie unsere Gesellschaft selbst zum Symptom wird und wie wir damit umgehen können. Die U.M.W.E.G.©-Methode.
Warum fühlt sich unsere Welt zunehmend gespalten, orientierungslos und emotional instabil an? Warum nehmen Schwarz-Weiß-Denken, Beziehungskrisen und innere Leere so dramatisch zu?
Ich wage in diesem Buch eine provokante These: Unsere Gesellschaft entwickelt zunehmend Strukturen, die der Borderline-Persönlichkeitsstörung erschreckend ähneln. Social Media, fragmentierte Familienstrukturen, Konsumkultur und politische Polarisierung erzeugen genau jene Dynamiken, die wir aus der Borderline-Therapie kennen.
Aber dieses Buch belässt es nicht bei der Analyse. Im zweiten Teil stelle ich die von mir entwickelte U.M.W.E.G.©-Methode vor – ein wissenschaftlich fundiertes Kommunikationssystem, das in emotional hochexplosiven Situationen greift. Ob bei Borderline-Partnern in der Krise, pubertierenden Jugendlichen oder alltäglichen Konfliktsituationen: Diese Methode gibt konkrete Handlungsstrategien an die Hand.
Für jedes der neun Borderline-Kriterien – von Verlustängsten über Identitätsstörungen bis hin zu Suizidalität – bietet das Buch praxiserprobte Werkzeuge: Wut-Tagebücher, die Drei-Schritt-Methode, Deeskalationstechniken und viele weitere Kommunikationsinstrumente, die sofort umsetzbar sind. Ein Buch, das philosophische Tiefe mit therapeutischer Praxis verbindet. Für Angehörige, Therapeuten, Pädagogen – und alle, die in unserer fragmentierten Welt Stabilität schaffen wollen.
Möge der Tanz mit dem Borderliner beginnen! 😉
Wirksame Skills bei Borderline!
Borderline ist eine Therapie, dies sich sehr von anderen Therapieformen unterscheidet. Ich würde diese Therapieform auch als Training fürs Leben bezeichnen.
Und wie im “normalen Leben” brauchen wir auch in der Borderline-Therapie Softskills, um mit den täglichen Anforderungen dieser Persönlichkeitsstörung besser umgehen zu können.
Borderline hat viel mit Emotionsregulation zu tun. Darum ist es sehr passend, dass die hier angeführten und sehr praxisbezogenen Skills eine wirksame Hilfe darstellen, die eigenen Emotionen effektiv unter Kontrolle zu halten und besser für sich nutzbar zu machen.
Dieses Buch ist nicht nur für Therapeuten eine Schatzkiste an Ratschlägen. Auch für betroffene Borderline und auch für Angehörige ist dieses Buch ein “Augenöffner” und Helfer für den Alltag. Ein tolles Werk für jeden Betroffenen.
Borderline Diagnose? Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen.
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit Borderline oder einer anderen belastenden Störung, aber auch über Future Faking, Love Bombing und Gaslighting die immer häufiger in unsere Gesellschaft zu beobachten sind.
- Was ist das eigentlich, eine Persönlichkeitsstörung, ein Perfektionismus, ein Spaltung oder eine Gegenübertragung?
- Kann ich trotz Borderline oder Narzissmus eine stabile Partnerschaft aufbauen und damit über Jahre hinweg leben?
- Ist eine Kommunikation mit einem Borderliner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Bindungsangst oder Verlustangst irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Ich möchte aber nicht nur über Fragen sprechen, sondern auch praxisgerechte Lösungen anbieten:
- Eine humorvoll und spielerisch – ja fast tänzerisch – eingesetzte Gewaltfreie Kommunikation in Kombination mit der von mir entwickelten
- U.M.W.E.G.-Methode© und nicht zuletzt die Transaktionsanalyse als Sprachkonzept können helfen, auch in schwierigen Situationen noch kühlen Kopf zu bewahren.
Buchen Sie sich einfach auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus