Checkliste für ein Familienpsychologisches Gutachten
Lieber Leser, mit dieser Übersicht, möchte ich dich ein wenig mit dem Konstrukt eines familienpsychologischen Gutachtens vertraut machen. Auf gar keinem Fall möchte ich dir hiermit ein rechtsverbindliches Dokument für deinen Anwalt geben! Es dient lediglich deiner Information und Vorbereitung auf ein eventuell bevorstehendes Gutachten. Bitte sprich mit deinem Fachanwalt für Familienrecht alle notwendigen Themen hierzu und beachte meinen 👉 Disclaimer / rechtlichen Ausschluss
- Literatur als Grundlage zur Prüfung eines Gutachtens: siehe auch den Literaturverweis am Ende:
- Jelena Zumbach et. Al.
- Harry Dettenborn (2021),
- Dettenborn und Walter (2022) und Balloff (2022),
- Lack und Hammesfahr (2024)
- Salzgeber (2022, 2024)
- „Mindestanforderungen“ des Arbeitskreises Familienrechtliche Gutachten (2019)
- „Qualitätsstandards für Psychologische Gutachten“ der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen (2017).
1. Ausbildungsanforderungen an Richter und Gutachter
- GvG § 23b Zusatzausbildung des Familienrichters in Grundlagen der Psychologie … Belegbare Kenntnisse werden gefordert in den Bereichen des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts, des Familienverfahrensrechts und der für das Verfahren in Familiensachen notwendigen Teile des Kinder- und Jugendhilferechts sowie über belegbare Grundkenntnisse der Psychologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie des Kindes, und der Kommunikation mit Kindern verfügen.
- Angaben zur Ausbildung / fachspezifische Qualifikation des Gutachters FamFG § 163 Abs, 1
- Die Pflicht zur Weiterbildung / Arbeiten nach bestem Wissen
- Köhler 2020; Richter OLG Frankfurt 8. Senat.
2. Auftragserteilung
- Wer hat den Auftrag bekommen und wer führt ihn aus? Wer hat den Eid vor Gericht geschworen?
3. Psychologische Fragen
Die psychologischen Fragen, welche sich auf die psychologischen Kriterien (Tatsachenfragen) beziehen. Sie sind zu prüfen, um die gerichtlichen Beweisfragen nachvollziehbar beantworten zu können 👉 (BVerfG v. 19.11.2014 – 1; BvR 1178/14, FamRZ 2015, 112 = NJW 2015, 223 = FamRB 2015, 54)
- Diese sind fallspezifisch und nachprüfbar zu begründen!
- Fragen zu den familiären Beziehungen und Bindungen;
- Fragen zu den Ressourcen und Risikofaktoren in der Familie;
- Fragen zu den
- Kompetenzen der Eltern/Sorgeberechtigten,
- ihrer Erziehungsfähigkeit,
- Kooperationsbereitschaft,
- Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme,
- Bindungstoleranz;
- Fragen über
- den Entwicklungsstand,
- die Bedürfnisse des Kindes,
- was ist der Kindeswillen?
- Was sind die Kompetenzen des Kindes?
Wie sieht die aktuelle Situation des Kindes aus? Bestehen evtl. besonderer Belastungen und Beeinträchtigungen.
👉 Normative Fragen (Fragen nach der Regelung des Rechts) sind unzulässig.
Dieser Punkt wird oft übersehen, wenn ein Gericht z.B. die Aufgabenstellung so formuliert: Es soll Beweis erhoben werden durch Einholen eines familienpsychologischen Sachverständigengutachtens darüber, welcher Elternteil insbesondere unter Berücksichtigung der gefühlsmäßigen Bindungen des Kindes, der eigenen Erziehungsfähigkeit und Bindungstoleranz sowie der jeweils angestrebten Perspektiven für das eigene Leben und das Leben des Kindes besser in der Lage ist, das Kind zu betreuen und zu erziehen.
Ein Sachverständiger darf keine rechtlichen Fragen beantworten, welche sich auf eine Verhältnismäßigkeit, Pflichtverletzung, Fahrlässigkeit, Verschulden oder Sittenwidrigkeit beziehen. Werden diese Fragen trotzdem vom Gericht aus gestellt (und dies geschieht sehr häufig) muss ein Anwalt den Richter hierauf hinweisen. (FamRZ 1997, 1051)
4. Aktenauswertung
- Transparent oder Intransparent?
- Es dürfen vom Gutachter KEINE rechtsnormativen Fragen beantwortet werden. Denn um diese zu verstehen, benötigt man weitere Rechtsvorschriften oder soziale Normen wie z.B. die Begriffe: „gute Sitten“, „Treu und Glauben“, „Verwerflichkeit“, (Unterschied zu deskriptiven). Gutachter dürfen nur die psychologischen Kriterien prüfen.
5. Untersuchungsplan / Einzelfallbezogen
- Kriterienbezogene Begründung der geplanten Maßnahmen
- Begründung der Maßnahmen und besonders des Erfordernisses (Artikel 2 GG)
- Auflistung der Methoden und Termine
- Wird die Auswahl der Untersuchungsmethoden, insbesondere der Persönlichkeitstests, fallspezifisch begründet?
- Wird das Verhältnismäßigkeitsgebot bei der Auswahl der Tests und Fragen beachtet?
6. Lösungsorientierte Gespräche?
- FamFG 156/2 oder §165 FamFG die Einrichtung eines Vermittlungsverfahrens
- FamFG 162 Absatz 2 (Mediationsauftrag im Beschluss?)
7. Die Untersuchungsgespräche / Exploration der Eltern
- Wurden Aufzeichnungen angefertigt? Eventuell anderer Beteiligter als dem Gutachter? (Salzgeber 2024 Rn 331)
- Sind Angaben über Art des Gesprächsrahmens (z.B. Online / Zoom) und Dauer des Gespräches notiert?
- Wurden wertende Aussagen Dritter (z.B. Fachkräfte) und Beurteilungen erfragt und selber vom Gutachter bewertet?
- Stehen Drogen im Spiel … Leitlinien der diagnostischen / gutachterlichen Vorgaben (Salzgeber 2024, Rn 1069, 1071)
- Neue Familiensituation: Wurden die neuen Partner beider Seiten in die Begutachtung mit einbezogen?
8. Exploration des Kindes
- Wurden entwicklungs- und bindungsdiagnostische Untersuchungen durchgeführt?
- Wurde der Kindeswille / Kindeswünsche geprüft und berücksichtigt? Dettenborn / Walter 2022 S.86). FamFG §159 Persönliche Anhörung vor Gericht
9. Exploration Eltern- / Kind – Interaktion
- Sind die gutachterlichen Interpretationen kongruent oder widersprüchlich?
10. Testverfahren:
- Wurden Testverfahren zugrunde gelegt, die eine Vielzahl an Persönlichkeitseigenschaften erfassen? Achtung: Überschreitung der Persönlichkeitsrechte und der Intimsphäre! Köhler 202, S.424. Überschreitung der Verhältnismäßigkeit! (Zumbach et. al. 2020; Salzgeber 2020)
- Wurden die Testergebnisse methodenkritisch bewertet, oder fehlt dies?
- Arbeitsgruppe familienrechtliche Gutachten, 2019: Psychodiagnostische Verfahren müssen konkret zur Beantwortung der psychologischen Fragen beitragen
- Wurde das Kind testdiagnostisch mit untersucht?
- Wurde die aktuelle fachliche, wissenschaftliche Literatur und neueste richtungsweisende Rechtsprechung zugrunde gelegt? (Balloff 2021, S.11)
11. Bewertung der begutachteten Teilnehmer
- Rein defizitfokussiert oder auch Ressourcenorientiert?
- Drogen / Alkoholvergangenheit?
12. Hinwirken auf Einvernehmen …
- Jeder Gutachter muss aktiv auf ein Einvernehmen hinwirken. FamFG §156; Ausnahmen können sein: diagnostizierte Persönlichkeitsstörung / Hochkonflikthaftigkeit (Dettenborn / Walter 2022 S.30)
- Die aktive Suche nach Regelungen, um weiteres Einvernehmen herzustellen.
- Ein Hinwirken auf Einvernehmen stellt regelmäßig erhöhte Anforderung an die psychologischen Kompetenzen der Sachverständigen (z.B. Zumbach et al. 2020, Salzgeber 2024, Lack und Hammesfahr 2024)
13. Befundkapitel
- Die Zusammenfassung aller gutachterlichen Befunde und Schlussfolgerungen müssen in einem gesonderten Bereich übersichtlich und nachvollziehbar dargelegt werden
- Ergebnisse der Begutachtung vor dem Hintergrund der gerichtlichen Fragestellung
- Beantwortung der psychologischen Fragestellung
- Werden fallspezifische Kriterien und Tatsachenfragen – mit denen sich die gerichtlichen Beweisfragen beantworten lassen – benannt?
- Werden Abweichungen in der Kindesentwicklung pauschal oder genau beschrieben?
- Was sind die Ursachen eventueller Abweichungen?
- Werden gutachterliche Schlussfolgerungen mit Tatsachen begründet oder liegen dem nur Floskeln zugrunde wie z.B. „was anzunehmen sei“ oder „wovon sachverständig ausgegangen werden muss…“?
- Bewertung des Verhaltens beider Eltern: Defizitär- oder Ressourcenorientiert?
- Werden offensichtliche Defizite wie eine Persönlichkeitsstörung / Drogenmissbrauch / Hochkonflikthaftigkeit kritisch angesprochen?
- Werden strittige Anknüpfungstatsachen vom Gutachter selbst beurteilt, obwohl dies ausschließlich in der Zuständigkeit des Gerichtes liegt.
- Wird über Wahrheit / Unwahrheit geurteilt, oder Unwahrheit einem Gesprächsteilnehmer unterstellt?
- Gibt es eine klare Trennung zwischen den Untersuchungsergebnissen und Befunden? Werden z.B. Rückschlüsse gezogen wie „der betreffende Elternteil verfügt nicht über ausreichende Kompetenzen“ ohne diese konkret zu benennen und zu erklären, ab wann eine Kompetenz als ausreichend eingestuft werden kann?
- Sind die diagnostischen Schlussfolgerungen logisch und fachlich begründet?
- Werden Diagnosen erstellt, für die es keine klinischen Befunde gibt?
14. Beantwortung der gerichtlichen Fragestellung
- Wurden diese vollständig und / oder fehlerhaft begründet?
- Sollte zum Beispiel zuerst auf Einvernehmen hingewirkt werden und DANN erst weitere Fragen beantwortet werden?
- Geht aus den Protokollen hervor, dass auf ein Einvernehmen hingewirkt wurde? Wenn ja, nach welcher Methode wurde hier vorgegangen?
- Wurden die Fragen durch differenzierte Überlegungen beantwortet, oder eher mit apodiktischen (unumstößlichen) Behauptungen?
- Werden Diagnosen attestiert, für die sich in den testdiagnostischen Untersuchungen (nicht) ausreichende Hinweise finden lassen.
- Werden rechtnormative Fragen beantwortet? Dies steht nur dem Gericht selber zu und stellt einen Fehler in der gerichtlichen Fragestellung dar.
- Werden Sanktionen in dem Gutachten gefordert? Solche Überschreitungen des Beweisauftrags oder auch gezielter Druck auf einen Elternteil rechtfertigen der Literatur zufolge den Eindruck einer Befangenheit (Lack und Hammefahr 2024, Salzgeber 2024).
Literatur:
- Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten (2019). Mindestanforderungen an die Qualität von Sachverständigengutachten im Familienrecht (2. Aufl.). Berlin: Deutscher Psychologenverlag.
- Balloff, R. (2022). Kinder vor dem Familiengericht (4. Auflage). Baden-Baden: Nomos.
- Balloff, R. (2021). Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung, Kindeswille in der familiengerichtspsychologischen Begutachtung. ZKJ, 16 (1), 10-20.
- Bergmann, M. (2016). Der Beweisbeschluss im Kindschaftsverfahren: Schnittstelle zwischen Recht und Spekulation. FamRB, 9, 364-372. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 17. November 2023- 1; BvR 1076/23 – Rn. (1 – 37).
- Dettenborn, H. und Walter, E. (2022). Familienrechtspsychologie (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Dettenborn, H. (2021). Kindeswohl und Kindeswille – psychologische und rechtliche Aspekte (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Diagnostik- und Testkuratorium der Föderation Deutscher Psychologenvereinigungen. (2017). Qualitätsstandards für psychologische Gutachten. https://www.dgps.de/fileadmin/documents/Empfehlungen/GA_Standards_DTK_10_Sep_2017_Final.pdf
- Fichtner, J. (2015). Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung. Göttingen: Hogrefe.
- Heiken, E. und Kilian, S. (2019). Die Qualität von Sachverständigengutachten im Familienrecht – Anhand welcher Merkmale können Familienrichter*innen die Qualität von Sachverständigengutachten einschätzen. ZKJ, 12, 445-450.
- Jacob, A. (2022). Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Köhler, I. (2020). Sachverständigengutachten in Kindschaftssachen – Beweiserhebung und Qualifikation des Sachverständigen. ZKJ, 15 (11), 421-426.
- Korn-Bergmann, M. (2013). Gutachter – „Heimliche Richter“ im Kindschaftsverfahren? – Überblick und rechtliche Grundlagen. FamRB, 9, 302-307.
- Korn-Bergmann, M. und Purschke, A. (2013). Gutachter – „Heimliche Richter“ im Kindschaftsverfahren? – Interdisziplinäre Anforderungen an Gutachter und Gutachten, FamRB. 10, 338-343.
- Lack, K. und Hammesfahr, A. (2024). Psychologische Gutachten im Familienrecht – Handbuch für die rechtliche und psychologische Praxis (2. Auflage). Köln: Reguvis – Bundesanzeiger Verlag.
- Langer, P. (2023). Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Kindschaftssachen im Jahr 2023. ZKJ 9/10, 338-348.
- Salzgeber, J. (2024). Familienpsychologische Gutachten – Rechtliche Vorgaben und sachverständiges Vorgehen (8. Auflage). München: C.H. Beck.
- Salzgeber, J. und Bublath, K. (2019). Soll und kann der familienrechtspsychologische Sachverständige die Fragestellung des Gerichts beantworten? FamRZ, 66 (Heft 21), 1753-183
- Salzgeber, J. Bretz, E. und Bublath, K. (2022). Arbeitsbuch familienpsychologische Gutachten (2. Aufl.). München: C.H. Beck.
- Splitt, A. (2018). Rechtsfragen im Zusammenhang mit familienpsychologischen Sachverständigengutachten. FamRZ, 2, 51-59.
- Zumbach, J., Lübbehusen, B., Volbert, R. und Wetzels, P. (2020). Psychologische Diagnostik im familienrechtlichen Verfahren. Göttingen: Hogrefe.
Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!
Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.
Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?
Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.
Die Familienrechts-Psychologie
Nicht von ungefähr wird dieses Lehrbuch als das Standartlehrbuch zur Familienrechtspsychologie bezeichnet. Psychologische Kompetenz ist überall von Vorteil, besonders aber, wenn Familienkonflikte vor Gerichten ausgefochten werden. In diesem Buch werden sowohl rechtliche Grundlagen, besonders aber ihre psychologische Tragweite sichtbar gemacht. Es zeigt, wie die Themen rund um das Kindeswohl, das Sorgerecht, das Umgangsrecht in die Praxis eines Gutachters, des Jugendamtes, einer Verfahrenspflege und nicht zuletzt in der Beratung eingebracht werden können
Steht ein familienpsychologisches Gutachten im Raum? Meine Unterstützung als beratender Beistand
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
- Was ist, wenn eine Persönlichkeitsstörung, eine Drogenvergangenheit oder andere Probleme die Situation begleiten?
- Ist eine Kommunikation mit dem Ex-Partner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Ängste irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Meine Unterstützung als Beistand nach §13 SGB X und §12 FamFG :
Es ist durch das Gesetz klar geregelt, dass sich jede Person im Familien-Verfahren sowohl vor den Ämtern als auch vor Gerichten (Ausnahme: alle finanziellen Angelegenheiten) durch einen Beistand begleiten lassen kann.
Diese Möglichkeit wird leider noch viel zu wenig genutzt, da sie auch in den Jugendämtern kaum bekannt und nicht gerade populär ist. Eigentlich nachvollziehbar, da sich die gesamte familiale Intervention einschließlich der Familiengerichte gerne im familiären Verfahren unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit bequem einrichtet.
Buchen Sie sich gerne auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

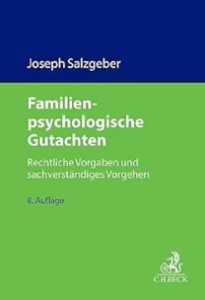
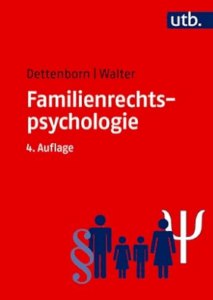
 Hier geht es zum Buchtitel
Hier geht es zum Buchtitel