Teil 4 – Gemeinsame Elterngespräche und Hinwirken auf Einvernehmen
Möglichkeiten des Gerichts, um zwischen den Eltern für „Frieden“ und Einvernehmen zu sorgen FamFG §163 Abs. 2
Ein Familiengerichtsverfahren unterscheidet sich schon sehr deutlich von allen anderen Gerichtsverfahren, wie zum Beispiel ein Strafverfahren …. Gemäß §156 FamFG (dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) soll ein Gericht ausdrücklich IN JEDER LAGE eines Verfahrens auf das Einvernehmen aller Beteiligten hinarbeiten – solange dies dem Kindeswohl nicht widerspricht.
In diesem wesentlichen Punkt eines Sorge- oder Umgangsrechtsstreits – aktiv versuchen, ein Einvernehmen herzustellen – unterscheidet es sich von allen anderen Arten Gerichtsfällen! Denn, wer zum Familiengericht geht, steht in einem Konflikt. Lateinisch „confligere“ bedeutet ein Zusammentreffen beziehungsweise ein Kämpfen. In diesem Konflikt gilt es aber, ein noch nicht rechtsfähiges Kind vor den Folgen des Elternstreits zu schützen. Und diesen Schutz versucht nun das FamFG ein wenig auszukleiden.
👉 Welche Möglichkeiten hat ein Gericht aber, um dieses kämpferisch aufgeladene Zusammentreffen in eine friedlichere Übereinkunft / ein Einvernehmen zu verändern? Nun, dafür stehen ihm folgende abgestufte Möglichkeiten zur Verfügung:
- Elterneinigung (§ 1627 BGB: Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohle des Kindes auszuüben. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.
- Verweisung der Eltern an Jugendamt und Beratung (§§ 17,18, SGB VIII) Der Beratungsanspruch an das Jugendamt.
- Gerichtlicher Vergleich (§156 Abs. 2 FamFG).
- Dieser ist einem Beschluss sogar vorzuziehen.
- Gerichtliche Umgangsregelung (§ 1684 Abs. 1 BGB); auch per einstweiliger Anordnung (eA) wenn es zu keiner Einigung der Eltern kommt oder eine zwischenzeitliche Regelung notwendig wird.
- Vermittlungsverfahren (§ 165 FamFG); bei Konflikten versucht das Gericht nochmals eine Einigung zu erreichen.
- Befristete Anordnung Umgangspflegschaft (§ 1684 Abs. 3 BGB); eine Person wird zur Durchsetzung der gerichtlich festgelegten Umgangsregelung eingesetzt.
- Angeordneter, begleiteter Umgang (§ 1684 Abs. 4 BGB).
- Bei mutwilliger Umgangsverweigerung – unter der Annahme einer darin bestehenden Kindeswohlgefährdung – Anordnungen nach § 1666 BGB: Ergänzungspflegschaft Umgangsregelung (§1909 BGB); die Ausgestaltung des Umgangs wird einem Pfleger übertragen.
- Kurzzeitiger, längerer oder dauerhafter Umgangsausschluss (§ 1684 Abs. 4 BGB). Diese Maßnahme ist nur möglich, um das Kind vor Schäden durch den Umgang zu schützen.
- Sorgerechtsänderung (§ 1696 BGB, § 1666 BGB). Mit dieser Maßnahme wird der Lebensschwerpunkt des Kindes verändert, das Kind kommt entweder zum getrennt lebenden Elternteil oder in eine Institution.
An sich sind diese Schritte recht klar und logisch gegliedert und auch nachvollziehbar. Über all dem schwebt aber noch der Artikel 43 der Istanbuler Konvention – Ein Völkervertrag, der 2011 durch den Europarat in Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder unterzeichnet wurde.
Auch er stellt sicher, dass das Besuchs- oder Sorgerecht nicht die Rechte und / oder die Sicherheit der Opfer / der Kinder häuslicher Gewalt in Gefahr bringt.
(1) FamFG § 163 Absatz 2
Worauf ich mich in diesem Beitrag heute jedoch besonders konzentrieren möchte, ist in dieser Aufzählung aus dem Salzgeber 2024 aber nicht enthalten: 👉 Es ist der Paragraph 163 Absatz 2 FamFG. In diesem interessanten Paragraphen steht, dass ein Gericht etwas besonderes anordnen kann:
Der beauftragte Gutachter soll mit dieser Zusatzbeauftragung nicht nur eine Sachdiagnose erstellen, sondern auch auf ein Einvernehmen zischen den Beteiligten hinwirken. So etwas gibt es in keinem anderen mit bekannten Gesetzestext…
… Ein Gutachter, der – ähnlich einem Mediator – das Gericht darin unterstützen soll, zwischen den beteiligten Eltern eine Ebene der Zusammenarbeit herzustellen. Was ist damit eigentlich gemeint? Oder, was nicht? Es bedeutet nicht, dass er sich um eine Fortsetzung der Eltern-Beziehung bemüht! Seine Aufgabe könnte man auch so beschreiben:
- Er soll alle Familienmitglieder erst einmal darüber aufklären, welche negativen psychologischen Auswirkungen eine Trennung nach sich zieht.
- Zusätzlich sollte er bei den Eltern ein Verständnis und ein Gespür dafür entwickeln, welche Bedürfnisse ihre Kinder haben und in welch anderer Lage diese sich im Vergleich zu den Eltern befinden.
Gelingt ihm das, dann kann er mit den Eltern weiter an einem einvernehmlichen Konzept für den zukünftigen Lebensmittelpunkt und den Umgang mit dem Kind arbeiten. Wie es im Familien Rechtsberater FamRB 2014, 25 steht, werden hierfür aber keine konkreten Verfahren / Handlungswege empfohlen! Siehe auch Korn-Bergmann / Purschke „Gutachter – Heimliche Richter im Kindschaftsverfahren?“
(2) Hinwirken auf Einvernehmen – Wie könnte ein Gutachter vorgehen?
Die erste Vorstellung, die einem hochkommt, ist vielleicht, dass der Gutachter beide Elternteile an einen Tisch holt und mit ihnen eine gemeinsame Ebene versucht, herzustellen. Aber … ob diese Arbeit nach FamFG 163 Absatz 2 an einem gemeinsamen Tisch stattfindet, liegt ganz allein in der fachlichen Entscheidung des Gutachters die er für jeden Fall immer separat entscheiden muss! (Salzgeber, 2015). Wichtig ist dabei, dass man immer unterscheidet, ob ein gemeinsames Elterngespräch eher einer Diagnose oder der Herstellung eines Einvernehmens dient.
Nehmen wir mal an, es geht jetzt um die Diagnose – z. B. in Bezug auf Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft der Eltern (BGB §1627) – dann müssen ethische Aspekte immer mit dem Verhältnismäßigkeitsgebot (OLG Koblenz FF 2009, 329) gegeneinander abgewogen werden. Was darf ich mir darunter vorstellen?
Nehmen wir da nur mal die sogenannten Hochkonfliktfamilien:
👉 Diese hochstrittigen, eskalierten Konflikte mit körperlicher und seelischer Gewalt zwischen den Familienmitgliedern betreffen etwa 5-10 Prozent der Trennungs- und Scheidungsfälle. (Dietrich, Fichtner, Halatcheva & Sandner, 2010; Kinderschutz-Zentrum Berlin, 2009; Menne, 2015; Normann, 2012). Wenn wir solche Personen an einen gemeinsamen Tisch setzen, dann könnten solche Gespräche eher das Gegenteil bewirken, weil eine weitere Eskalation der Gewalt und / oder Verletzungen dann sehr wahrscheinlich sind. Und noch etwas kommt hinzu: Versetz dich mal in die Situation des unterdrückten Elternteils … Allein was sie durch die Anwesenheit des Peinigers (generisches Maskulinum) erlebt, wenn das Thema häusliche Gewalt im Raume steht, kann man nicht mit Worten beschreiben.
Wenn es aber um eine drohende Kindeswohlgefährdung (BGB § 1666) geht und die Eltern außerdem noch räumlich zusammenwohnen, dann könnten (!) gemeinsame Elterngespräche hilfreich sein um die Erziehungsfähigkeit zu fördern und eventuell neue Ressourcen der Eltern zu nutzen. Wie gesagt, ist es mit die erste und wichtigste Aufgabe eines Familiengerichtes mit allen Beteiligten während eines Verfahrens gemäß FamFG 156 Absatz 1 „zuallererst und in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen aller Beteiligten hinzuwirken – sofern es dem Kindeswohl entspricht…“
Leider haben viele diesen zusätzlichen, aus meiner Sicht sehr interessanteren Paragraphen in der Gesetzsammlung des FamFG (dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) … den §163 Absatz 2 einfach nicht auf dem Schirm … oder gehen diesem wegen der Mehrarbeit aus dem Weg.
👉 Zitat FamFG §163 (2) Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, anordnen, dass der Sachverständige bei der Erstellung des Gutachtens auch auf die Herstellung des Einvernehmens zwischen den Beteiligten hinwirken soll. Ein Familiengericht kann also explizit anordnen, dass der Gutachter bereits in seiner Arbeit auf ein Einvernehmen zwischen den Eltern / den Beteiligten hinarbeiten soll.
Dies ist eine absolute Einzigartigkeit in dem großen Feld der Gutachtertätigkeit. Es gibt praktisch keinen anderen Bereich, wo ein Gutachter in seiner Arbeit mit einer Mediationsarbeit sogar gesetzlich beauftragt werden könnte. Nehmen wir mal an, du hast einen Autounfall und ein Gutachter soll den Schaden aufnehmen. Ein Unding wäre es dann, anzunehmen, der Sachverständige solle auf eine Einigung hinarbeiten. Das ist nicht seine Aufgabe.
Im Familiengerichtlichen Verfahren – nach Beauftragung durch das Gericht – jedoch schon. Hier sieht alles etwas anders aus, da es ja nicht nur um die Streitbeteiligten geht. Es stehen hier immer noch die Kinder im Mittelpunkt, um deren Rechte sich das Gericht bemühen muss.
Wie erwähnt, fordert zwar bereits der FamFG §156 alle Beteiligten dazu auf, während des Gerichtsprozesses irgendwie eine Einigung zu erzielen und nicht nur auf den Gerichtsbeschluss zu warten – darum ist es nur konsequent, dass auch dieser Paragraph 163 mit eingeführt wurde – aber: er muss aktiv vom Gericht mit eingebracht werden!
Damit gerät der Gutachter zwar praktisch in einen Hybridstatus / eine Doppelrolle, aber diese rechtliche Ausnahmeregelung – das modifikationsorientiertes Handeln – wird durch die Besonderheit personenbezogener Kindschaftsverfahren gerechtfertigt“ (Prof. Dr. Reinhard Greger Uni Erlangen 2010, 445).
(3) Hinwirken auf Einvernehmen – Wie geht so etwas vor sich?
Voraussetzung bei allem ist, dass zuerst einmal eine vollständige familienrechtspsychologische Diagnostik durchgeführt und auch dokumentiert wurde;
👉 Die Arbeit an einem Einvernehmen kommt nämlich immer erst NACH der Begutachtung!
(b) Zum anderen muss vom Gericht aus immer ein eindeutiger Auftrag hierfür gegeben werden. Dieser kann auch noch nach dem Beschluss– also während der Arbeit des Gutachters – erteilt werden.
Wie das gesamte Gutachten bestehen für solch eine Intervention keine bestimmten Regeln. Sie könnten also auch nach der neuen Tendenz im Rechtssystem – dem ADR (Alternative Dispute Resolution) – durchgeführt werden, dass Konflikte durch selbstbestimmte Verhandlungslösungen anstatt durch autoritäre Entscheidungen beigelegt werden.
Der Gutachter ist erstmal also nicht an eine bestimmte Form gebunden. Normalerweise finden in der Praxis aber gemeinsame Elterngespräche statt, um zu versuchen, dass neue Vereinbarungen oder Zielabsprachen gefunden werden.
Solche „Einigungs-Gespräche“ setzen zwingend voraus, dass die eigentliche Diagnosearbeit des Gutachters bereits abgeschlossen ist und seine Einschätzung des Falls klar und deutlich abgesichert ist.
Die erste Aufgabe eines Gutachters ist es nämlich nicht, für eine Einigung zu sorgen, sondern erst einmal die gerichtlichen Fragen vernünftig zu beantworten. Erst danach darf er – mit dem klaren Auftrag des Gerichts – als „Mediator“ arbeiten. Warum ist dies so wichtig?
Diese Arbeit an einem Einvernehmen ist nämlich kein offenes Gespräch, in welchem die Eltern im Mittelpunkt stehen! Es ist zwar nur natürlich, dass jeder Elternteil eine eigene Meinung hat und diese durchsetzen möchte … aber aufgrund der Trennung ist es fast immer zu Emotionalen Haltungen gekommen, die einen für das eigentliche Thema – das Wohl des Kindes – etwas blind machen.
Ich möchte dies bitte nicht als Anklage verstanden wissen! Nein, eher das Gegenteil möchte ich hiermit ausdrücken… Eltern sind immer mit ihrem vollen Herzen bei der Sache. Ein Herz ist aber immer auf einem Auge blind. Das andere Auge stellt die Kognition dar.
Leider ist bei einem Streit – und das kennen wir alle aus dem täglichen Leben – unser Herz in der Regel lauter als unser Verstand. Und da kommt der „ausgelagerte Verstand“ in Form eines unparteiischen Gutachters mit ins Spiel. Nachdem (!) er sich ein genaues Bild von der Situation in Form eines diagnostischen Befundes gemacht hat, kann er daran mitarbeiten
- dass die Kindeseltern eigenständig und konstruktiv – durch die Moderation des Gutachters – eine Lösung bzw. ein Einvernehmen erarbeiten.
Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Gutachter allen Beteiligten deutlich darlegt, wann die diagnostische Untersuchung endet, und die Intervention startet. Dann sollte auf alle Fälle – so der ausdrückliche Rat im Salzgeber 2024 – immer auch das Gericht und alle weiteren Beteiligten wie zum Beispiel die Anwälte darüber informiert werden, dass nach §163 Abs. 2 die Intervention begonnen wurde.
So gegen Ende meines Beitrages möchte ich noch darauf hinweisen, dass alles – auch das Hinwirken auf ein Einvernehmen nach §163 Absatz 2 – auch für die Eltern freiwillig ist. Beide Elternteile müssen sich hierfür einverstanden erklären. Natürlich hat eine Verweigerung ein gewisses „Geschmäckle“, aber Freiwilligkeit muss immer Freiwilligkeit bleiben und es darf offiziell nicht zum Nachteil ausgelegt werden, wenn einer oder beide Eltern nicht daran teilnehmen wollen.
Wie stehen die Erfolgschancen für solch ein Hinwirken auf Einvernehmen? Nach Ekert und Heiderhoff (2018) wurde nur in etwas weniger als 50% solcher Aufträge eine Einigung erzielt. Wenn es sich also als gescheitert zeigt, dann ist der Weg wieder frei, das Gutachten abzuschließen und die gerichtlichen Fragen umfassend zu beantworten.
(4) Hinwirken auf ein Einvernehmen – Der Verfahrensbeistand
Zum Abschluss noch eine Frage, welche mir ein Klient stellte:
👉Darf ein Verfahrensbeistand (der sogenannte „Anwalt des Kindes“) auch vermittelnd tätig werden?
Hierzu äußert sich Dettenborn und Walter (2022) ganz klar mit „Nein“! Ein Mediator hat die Aufgabe, allparteilich an eine Fragestellung / einen Konflikt heranzugehen.
Der Verfahrensbeistand ist aber von seiner Position aus schon nicht allparteilich, da er die Interessen seines Klienten, des Kindes, zu vertreten hat. Er kann nur Kompromisse aushandeln, die dem Kind dienen, nicht den Eltern.
Weder hat er für eine Mediation eine abgesicherte Qualifikation noch erlauben dies seine Aufgabe und Rolle. Mediation baut grundsätzlich immer auf Vertrauensschutz auf und grenzt sich klar und deutlich von einem gerichtlichen Verfahren ab. Er hat auch nicht die Aufgaben eines Gutachters. Er darf keine Ermittlungen zum Kindeswohl anstellen. Als der Interessenvertreter des Kindes ist er auch nicht an die Weisungen des Gerichtes gebunden. Ihm können weder Aufgaben noch Fragestellungen zur Beantwortung gegeben werden.
Er kann und darf in diesem Verfahren nicht neutral sein. Er dient einzig und allein dem Kindeswillen. Der Verfahrensbeistand kann aber in ganz anderer Hinsicht von Nutzen sein: Er hat zum Beispiel die Aufgabe,
- die Arbeit des Jugendamtes zu hinterfragen, etwa ob es seiner Aufgabe des Wächteramtes gemäß § 8a SGB VIII und seinen Mitwirkungspflichten nach § 50 SGB VIII ausreichend nachkommt
- oder ob die Maßnahmen inhaltlich und zeitlich die Interessen des Kindes schützt.
Der Verfahrensbeistand kann im Gerichtsverfahren genau hier den Finger auf eine eventuelle Wunde legen, indem er Leistungen der Jugendhilfe anregt und auch deren konsequentere Umsetzung verlangt.
Das Standartwerk für Gutachter in einem familienpsychologischen Gerichtsprozess!
Dieses über 1000 seitige Nachschlagewerk für Gutachter, Juristen (aber auch Betroffene), Psychologen und Gerichte befasst sich mit allen rechtlichen Vorgaben und Fragen rund um das sachverständige Vorgehen eines Gutachters.
Wie sieht das diagnostische Vorgehen aus? Welche Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes sind zu berücksichtigen? Hier werden verschiedene diagnostische Verfahren vorgestellt und eine Unmenge an Rechtsfragen beantwortet wie z.B. was mit Aufzeichnungen im Gutachten geschieht? Können Emails oder digitale Chats dem Gutachter vorgelegt werden?
Was wir hier finden sind Leitlinien für den Sachverständigen, rund um die Qualitätssicherung, Kosten und Vergütung, das Thema Kindeswohl und wie ein schriftliches / mündliches Gutachten aufgebaut sein sollte.
Die Familienrechts-Psychologie
Nicht von ungefähr wird dieses Lehrbuch als das Standartlehrbuch zur Familienrechtspsychologie bezeichnet. Psychologische Kompetenz ist überall von Vorteil, besonders aber, wenn Familienkonflikte vor Gerichten ausgefochten werden. In diesem Buch werden sowohl rechtliche Grundlagen, besonders aber ihre psychologische Tragweite sichtbar gemacht. Es zeigt, wie die Themen rund um das Kindeswohl, das Sorgerecht, das Umgangsrecht in die Praxis eines Gutachters, des Jugendamtes, einer Verfahrenspflege und nicht zuletzt in der Beratung eingebracht werden können
Steht ein familienpsychologisches Gutachten im Raum? Meine Unterstützung als beratender Beistand
 Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
Es sind viele Bereiche, die wir ansprechen können: Angefangen vom Umgang mit dem Ex-Partner und den Kinder, aber auch über Erziehungsfähigkeit, Kommunikationsbereitschaft, Loyalität und Kindeswohlgefährdung …
- Was ist, wenn eine Persönlichkeitsstörung, eine Drogenvergangenheit oder andere Probleme die Situation begleiten?
- Ist eine Kommunikation mit dem Ex-Partner möglich? Wie hilft hier die U.M.W.E.G.-Methode©?
- Kann ich meine Ängste irgendwann einmal kontrollieren?
- Was kann ich tun, wenn ich mich gerade in einer Trennung befinde, oder kurz davor bin?
Meine Unterstützung als Beistand nach §13 SGB X und §12 FamFG :
Es ist durch das Gesetz klar geregelt, dass sich jede Person im Familien-Verfahren sowohl vor den Ämtern als auch vor Gerichten (Ausnahme: alle finanziellen Angelegenheiten) durch einen Beistand begleiten lassen kann.
Diese Möglichkeit wird leider noch viel zu wenig genutzt, da sie auch in den Jugendämtern kaum bekannt und nicht gerade populär ist. Eigentlich nachvollziehbar, da sich die gesamte familiale Intervention einschließlich der Familiengerichte gerne im familiären Verfahren unter Ausschluss jeder Öffentlichkeit bequem einrichtet.
Buchen Sie sich gerne auf meinem Online-Kalender ein Zeitfenster oder nutzen Sie mein klassisches Kontaktformular um mit mir in Verbindung zu treten. Ich freue mich auf Sie. Ihr Marcus

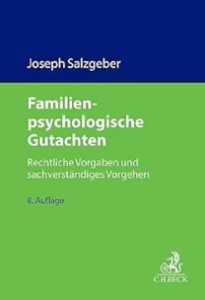
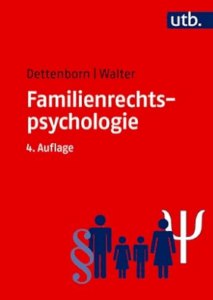
 Hier geht es zum Buchtitel
Hier geht es zum Buchtitel
